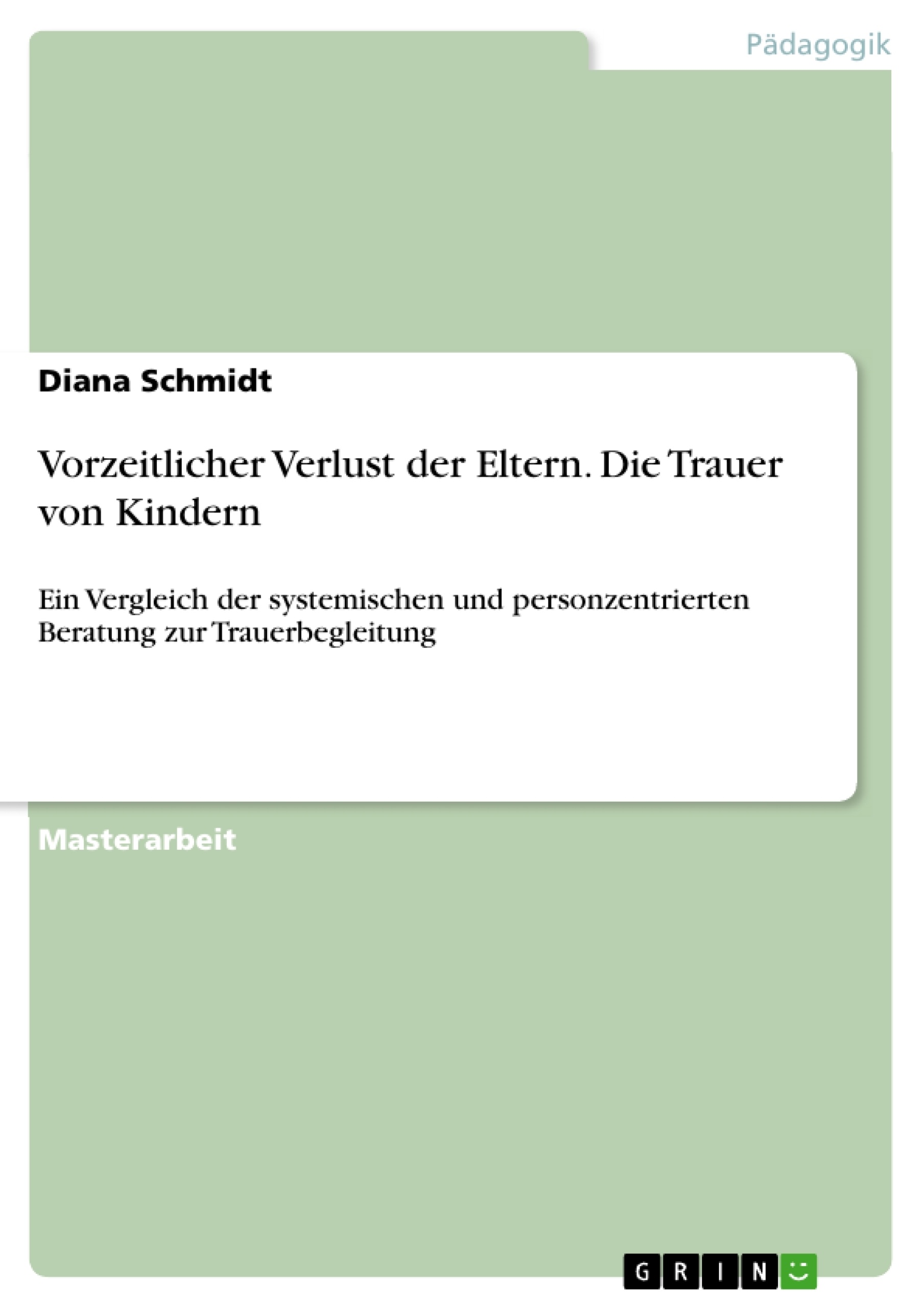Die Leitfrage dieser Arbeit ist, inwiefern die Konzepte der systemischen und personzentrierten Beratung für die Trauerverarbeitung von Kindern indiziert sind. Es werden primär die entwicklungspsychologischen Aspekte des elterlichen Verlustes thematisiert, schwerpunktmäßig wird dabei die frühe und mittlere Kindheit bis zum Übergang in die weiterführende Schule fokussiert (0-10 Jahre).
Diese Arbeit inkludiert eine Halb- und Vollverwaisung, obgleich ersteres quantitativ deutlich häufiger in Deutschland auftritt und dementsprechend in der Literatur umfassender behandelt wird. Dabei gilt es zu beachten, dass die Auswirkungen und Implikationen von sozialer Verwaisung sowie der Verlust eines Elternteils durch Trennung oder Scheidung nicht beleuchtet werden. Methodisch ist diese Arbeit literaturgestützt verfasst worden. Wie in Deutschland gebräuchlich wird der Begriff der Trauerbegleitung synonym zur Trauerberatung verwendet und konzeptionell zusammengeführt.
Im ersten Teil der Arbeit werden der Umgang mit Tod und Trauer in der westlichen Gesellschaft sowie eine Zusammenfassung zum Stand der Forschung als Annäherung an die Thematik dargelegt. Darauffolgend wird als Diskussionsgrundlage das Todeskonzept von Kindern in den verschiedenen Entwicklungsphasen dargestellt.
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird auf der Folie der im ersten Teil dargestellten Erkenntnisse zur Trauerforschung und entwicklungspsychologischer Konzepte zur Trauerverarbeitung im Kindesalter die systemische und personzentrierte Beratung vorgestellt, anschließend gegenübergestellt und diskutiert, um abschließend erste Implikationen für die Beratung zur Trauerbegleitung von Kindern darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Bedeutung der Trauer
- Normale Trauer
- Umgang mit Tod und Trauer in der Gesellschaft
- Komplizierte Trauer
- Depressionen und Traumatisierungen im Kindesalter
- Das Todeskonzept von Kindern
- Die Trauerverarbeitung im Kindesalter
- Trauer und Verlust in der Bindungstheorie
- Trauer und Verlust in der Psychoanalyse
- Trauer und Verlust in den Entwicklungsaufgaben nach Erikson
- Trauer und Verlust in der Stressforschung
- Die Trauerphasen/Traueraufgaben
- Einflussfaktoren auf die Trauerverarbeitung
- Die Familie (verstorbene und lebende Elternteile)
- Die Umstände des Todes
- Das Copingmodell der Kognitiven Stresstheorie
- Vergleich der Beratungskonzepte
- Beratungsansätze zur Trauerarbeit für Kinder
- Systemische Beratung
- Zum Verständnis systemischer Trauerarbeit
- Methoden und Interventionen für Kinder
- Personzentrierte Beratung
- Zum Verständnis personzentrierter Trauerarbeit
- Methoden und Interventionen für Kinder
- Diskussion
- Ausblick und Implikationen für die Beratung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Trauer von Kindern nach dem frühzeitigen Verlust eines Elternteils und vergleicht die Eignung systemischer und personzentrierter Beratungsansätze zur Trauerbegleitung. Der Fokus liegt auf der Entwicklungspsychologie im Kontext von Verlust und Trauer, speziell in der frühen und mittleren Kindheit (0-10 Jahre).
- Entwicklungspsychologische Aspekte des elterlichen Verlustes im Kindesalter
- Vergleich systemischer und personzentrierter Beratungsansätze
- Eignung der Ansätze für die Trauerverarbeitung von Kindern
- Einflussfaktoren auf die Trauerverarbeitung bei Kindern
- Methoden und Interventionen in der Trauerberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem des frühzeitigen elterlichen Verlustes im Kindesalter vor und betont dessen gesellschaftliche Relevanz. Sie führt die hohe Anzahl betroffener Kinder in Deutschland an und hebt die Notwendigkeit adäquater Trauerbegleitung hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf den Vergleich systemischer und personzentrierter Beratungsansätze, um die Trauerverarbeitung von Kindern zu unterstützen. Die Leitfrage der Arbeit zielt darauf ab, die Indikation beider Konzepte zu untersuchen.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Trauer, verschiedene Trauerphasen und deren Konzepte in verschiedenen psychologischen Theorien. Es beschreibt das Todeskonzept von Kindern und wie sie Verlust und Trauer in unterschiedlichen Entwicklungsphasen verarbeiten. Es analysiert den Einfluss von Bindungstheorie, Psychoanalyse, Eriksons Entwicklungsstufen und Stressforschung auf die Trauerverarbeitung. Es werden zudem relevante Einflussfaktoren wie die familiäre Situation und die Umstände des Todes untersucht.
Vergleich der Beratungskonzepte: Dieser Abschnitt vergleicht systemische und personzentrierte Beratungsansätze in der Trauerarbeit mit Kindern. Es werden die jeweiligen theoretischen Grundlagen erläutert, sowie Methoden und Interventionen dargestellt, die in der Praxis eingesetzt werden können, um Kinder in ihrer Trauer zu begleiten.
Schlüsselwörter
Kindliche Trauer, elterlicher Verlust, systemische Beratung, personzentrierte Beratung, Trauerverarbeitung, Entwicklungspsychologie, Bindungstheorie, Psychoanalyse, Coping, Trauerbegleitung, Halbwaisen, Vollwaisen.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Trauer von Kindern nach dem frühzeitigen Verlust eines Elternteils
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Trauer von Kindern nach dem frühzeitigen Verlust eines Elternteils und vergleicht die Eignung systemischer und personzentrierter Beratungsansätze zur Trauerbegleitung. Der Fokus liegt auf der Entwicklungspsychologie im Kontext von Verlust und Trauer in der frühen und mittleren Kindheit (0-10 Jahre).
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Leitfrage der Arbeit zielt darauf ab, die Indikation von systemischen und personzentrierten Beratungsansätzen für Kinder in der Trauerverarbeitung zu untersuchen. Weitere Fragen betreffen die Entwicklungspsychologischen Aspekte des elterlichen Verlustes, den Vergleich der Beratungsansätze, deren Eignung für die Trauerverarbeitung, Einflussfaktoren auf die Trauerverarbeitung bei Kindern und die verwendeten Methoden und Interventionen in der Trauerberatung.
Welche theoretischen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene psychologische Theorien, darunter die Bindungstheorie, die Psychoanalyse, Eriksons Entwicklungsstufen und die Stressforschung. Sie beleuchtet das Todeskonzept von Kindern und deren Trauerverarbeitung in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Außerdem werden Einflussfaktoren wie die familiäre Situation und die Umstände des Todes analysiert.
Welche Beratungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht systemische und personzentrierte Beratungsansätze für die Trauerarbeit mit Kindern. Für jeden Ansatz werden die theoretischen Grundlagen, Methoden und Interventionen im Detail erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zum Vergleich der Beratungskonzepte, eine Diskussion und einen Ausblick mit Implikationen für die Beratung. Die Einleitung stellt das Problem des frühzeitigen elterlichen Verlustes vor und betont dessen gesellschaftliche Relevanz. Die theoretischen Grundlagen befassen sich mit der Bedeutung von Trauer, Trauerphasen und deren Konzepte in verschiedenen psychologischen Theorien. Das Kapitel zum Vergleich der Beratungskonzepte erläutert die jeweiligen theoretischen Grundlagen, sowie Methoden und Interventionen der systemischen und personzentrierten Beratung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindliche Trauer, elterlicher Verlust, systemische Beratung, personzentrierte Beratung, Trauerverarbeitung, Entwicklungspsychologie, Bindungstheorie, Psychoanalyse, Coping, Trauerbegleitung, Halbwaisen, Vollwaisen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Trauer von Kindern nach dem frühzeitigen Verlust eines Elternteils und der Vergleich der Eignung systemischer und personzentrierter Beratungsansätze zur Trauerbegleitung. Die Arbeit möchte dazu beitragen, adäquate Trauerbegleitung für betroffene Kinder zu ermöglichen.
- Quote paper
- Diana Schmidt (Author), 2020, Vorzeitlicher Verlust der Eltern. Die Trauer von Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956407