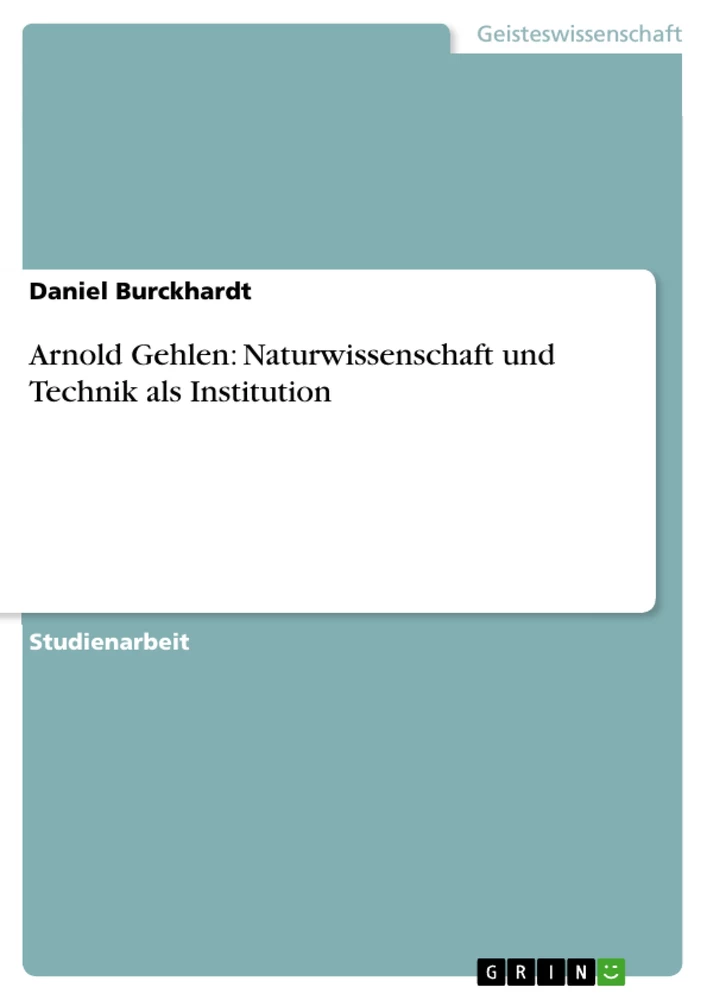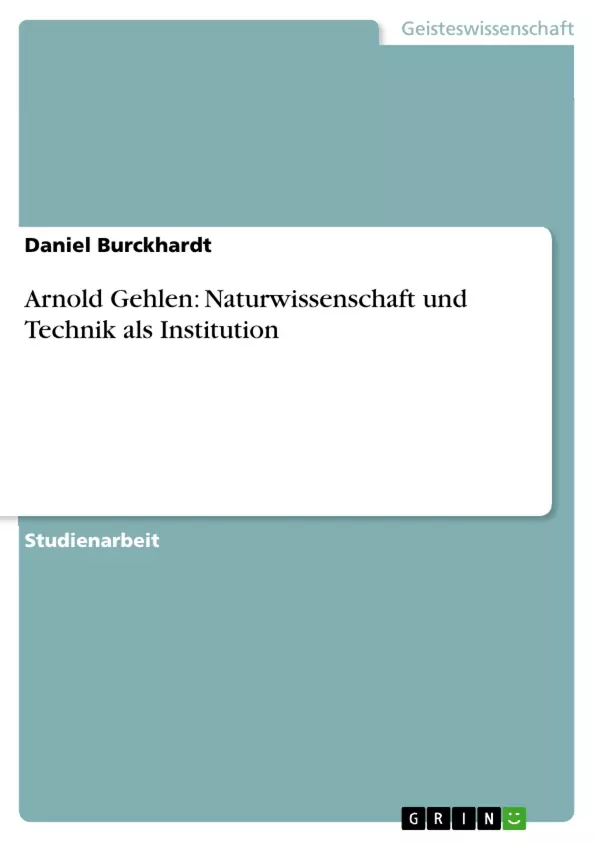Anlass für diese Hausarbeit ist mein Referat über den in den aktuellen Sammelband „Technikphilosophie“ aufgenommenen Text „Neuartige kulturelle Erscheinungen“ von Arnold Gehlen. Dieser bildet das zweite Kapitel der 1957 in „rowohlts deutscher enzyklopädie“ erschienen Schrift „Die Seele im technischen Zeitalter: Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft“.
In dieser phänomenologischen Betrachtung stellt sich Gehlen mit einer kulturkritischen Fragestellung in die Nähe Spenglers3, ohne aber dessen „polemische Tönung gegen Technik“ zu übernehmen, die Gehlen als Zeichen sieht, „dass unsere Gesellschaft die innere Auseinandersetzung mit den tiefgreifenden Veränderungen in ihr selbst, wie sie im Zuge der Industrialisierung vor sich gingen, noch nicht beendet hat.“
Die Aufmerksamkeit der folgenden Arbeit gilt Gehlens Beschreibung von Technik, wie wir sie im ersten Kapitel der „Seele“ ausgeführt finden. Ich versuche sie, in den allgemeineren Rahmen seiner Anthropologie und seiner Institutionenlehre einzubetten. Im letzten Abschnitt will ich aufzeigen, dass Gehlens These von der von den Naturwissenschaften ausgehenden und sämtliche Kulturgebiete erfassenden Abstrahierung und Entsinnlichung nicht der einzige Grund für den in der Gegenwart gering gewordenen Halt eines naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gehlens Anthropologie
- Entlastung - Institution
- Gehlens Technikverständnis
- Der qualitative Übergang zur Superstruktur
- Technik oder technische Denkweise
- Entsinnlichung und Primitivisierung
- Naturwissenschaft und Technik als Institution
- Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung
- Abstraktion als Grund für den geringen Halt von Technik als Institution?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Arnold Gehlens Verständnis von Technik im Kontext seiner Anthropologie und Institutionenlehre. Der Fokus liegt auf der Einbettung seiner Technikbeschreibung in seinen umfassenderen philosophischen Rahmen. Die Arbeit untersucht, inwieweit Gehlens These von der Abstraktion und Entsinnlichung durch Naturwissenschaft und Technik den geringen Halt des naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes erklärt.
- Gehlens Anthropologie und der Mensch als „Mängelwesen“
- Der Technikbegriff bei Gehlen und seine Einbettung in die Institutionenlehre
- Entlastungsprinzip und Institutionalisierung als Reaktion auf menschliche Bedürfnisse
- Abstraktion und Entsinnlichung als Folge naturwissenschaftlich-technischer Entwicklungen
- Kritik an einem rein naturwissenschaftlich-technischen Weltbild
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Hausarbeit, der in einem Referat über Gehlens Text "Neuartige kulturelle Erscheinungen" liegt. Der Autor stellt Gehlens kulturkritische Perspektive vor und betont dessen Auseinandersetzung mit den tiefgreifenden Veränderungen durch die Industrialisierung, ohne die polemische Tönung Spenglers zu übernehmen. Die Arbeit konzentriert sich auf Gehlens Beschreibung von Technik im ersten Kapitel von "Die Seele im technischen Zeitalter", eingebettet in seine Anthropologie und Institutionenlehre. Schliesslich wird die These aufgestellt, dass Gehlens Abstraktions- und Entsinnlichungsthese nicht den einzigen Grund für den geringen Halt eines naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes darstellt.
Gehlens Anthropologie: Dieses Kapitel befasst sich mit Gehlens Hauptwerk "Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt" und dessen anthropologischem Ansatz. Gehlen versucht, das Wesen des Menschen ohne aussermenschliche Kategorien (Gott, Tier) zu definieren und den dualistischen Gegensatz von Leib und Seele zu überwinden. Er betrachtet den Menschen als "noch nicht festgestelltes Tier", das sich durch Kultur und Institutionalisierung seine eigenen Antriebe schafft. Gehlens Beschreibung des Menschen als "Mängelwesen" wird im Kontext seiner biologischen Unangepasstheit und Unspezialisiertheit erläutert. Die notwendige Intelligenz, Sprache und die komplexen Zusammenhänge zwischen körperlichen und geistigen Fähigkeiten werden als essentielle Elemente des menschlichen Systems dargestellt, die sich gegenseitig bedingen.
Entlastung - Institution: Gehlen betrachtet den Menschen als handelndes Wesen, wobei sein Handeln durch den Technikbegriff vereint wird (näher erläutert im folgenden Kapitel). Das Kapitel betont die Notwendigkeit von Selbstzucht und Erziehung für den Menschen, der als "riskiertes Wesen" bezeichnet wird, da er seine Existenz selbst sichern muss. Die "Weltoffenheit" des Menschen, die mit Reizüberflutung und Störbarkeit einhergeht, führt zur Notwendigkeit eines Entlastungsprinzips. Gehlen erklärt die Entstehung von Institutionen als "Systeme verteilter Gewohnheiten", die wichtige Aufgaben (Ernährung, Fortpflanzung) regulieren und ein stabiles gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen. Diese Institutionen entstehen historisch und sind nicht Ergebnis rationaler Zweckberechnung. Die Stabilität einer Institution wird durch die Überlagerung vordergründiger Motive mit dem ursprünglichen Zweck erklärt, was zu einer dauerhaften Hintergrundserfüllung und Stabilisierung führt.
Gehlens Technikverständnis: Dieses Kapitel analysiert Gehlens Technikbegriff und seine drei Unterkapitel (Der qualitative Übergang zur Superstruktur; Technik oder technische Denkweise; Entsinnlichung und Primitivisierung). Es wird detailliert auf die Aspekte der Entsinnlichung und Primitivisierung eingegangen, welche die Auswirkungen der technisch-naturwissenschaftlichen Entwicklungen auf Kultur und Gesellschaft beleuchten. Es wird der Versuch unternommen, die Beziehungen zwischen der Entwicklung von Technik, dem Wandel in der Denkweise und den damit verbundenen Folgen für die menschliche Existenz zu verdeutlichen. Die Bedeutung der Überlegungen zu den verschiedenen Aspekten des Technikverständnisses Gehlens wird betont.
Naturwissenschaft und Technik als Institution: Dieses Kapitel befasst sich mit den beiden Unterkapiteln (Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung; Abstraktion als Grund für den geringen Halt von Technik als Institution?). Es wird hier die These der Abstraktion und Entsinnlichung im Kontext von Naturwissenschaft und Technik und deren Folgen für den Halt eines naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes detailliert untersucht. Die Argumentation setzt die vorherigen Kapitel fort und vertieft die Analyse von Gehlens Position zu den gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Arnold Gehlen, Anthropologie, Technikphilosophie, Institution, Entlastung, Weltoffenheit, Mängelwesen, Abstraktion, Entsinnlichung, Industrialisierung, Kulturkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Gehlens Anthropologie und Technikverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Arnold Gehlens Technikverständnis im Kontext seiner Anthropologie und Institutionenlehre. Der Fokus liegt auf der Einbettung seiner Technikbeschreibung in seinen umfassenderen philosophischen Rahmen und untersucht, inwieweit Gehlens These von der Abstraktion und Entsinnlichung durch Naturwissenschaft und Technik den geringen Halt des naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes erklärt.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Gehlens Anthropologie und den Menschen als „Mängelwesen“, seinen Technikbegriff und dessen Einbettung in die Institutionenlehre, das Entlastungsprinzip und die Institutionalisierung, Abstraktion und Entsinnlichung als Folgen naturwissenschaftlich-technischer Entwicklungen sowie Kritik an einem rein naturwissenschaftlich-technischen Weltbild.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung: Einführung in Gehlens kulturkritische Perspektive und die Forschungsfrage. Gehlens Anthropologie: Darstellung von Gehlens anthropologischem Ansatz und dem „Mängelwesen“. Entlastung - Institution: Erklärung des Entlastungsprinzips und der Entstehung von Institutionen. Gehlens Technikverständnis: Analyse von Gehlens Technikbegriff mit Fokus auf Entsinnlichung und Primitivisierung. Naturwissenschaft und Technik als Institution: Untersuchung der These der Abstraktion und Entsinnlichung im Kontext von Naturwissenschaft und Technik.
Was ist Gehlens Anthropologie und wie wird der Mensch darin beschrieben?
Gehlens Anthropologie beschreibt den Menschen als „Mängelwesen“, das durch seine biologische Unangepasstheit und Unspezialisiertheit auf Kultur und Institutionalisierung angewiesen ist. Er versucht, das Wesen des Menschen ohne aussermenschliche Kategorien zu definieren und den dualistischen Gegensatz von Leib und Seele zu überwinden.
Wie definiert Gehlen den Begriff "Technik" und welche Rolle spielt er in seiner Philosophie?
Gehlens Technikbegriff ist eng mit seinem Verständnis von Entlastung und Institutionalisierung verbunden. Technik wird als ein Mittel verstanden, um die "Weltoffenheit" des Menschen zu bewältigen und die dadurch entstehende Reizüberflutung zu reduzieren. Die Arbeit analysiert die Aspekte der Entsinnlichung und Primitivisierung, die durch die technisch-naturwissenschaftliche Entwicklung entstehen.
Welche Rolle spielen Institutionen in Gehlens Philosophie?
Institutionen werden bei Gehlen als "Systeme verteilter Gewohnheiten" betrachtet, die wichtige Aufgaben regulieren und ein stabiles gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen. Sie entstehen historisch und sind nicht Ergebnis rationaler Zweckberechnung. Ihre Stabilität resultiert aus der Überlagerung vordergründiger Motive mit dem ursprünglichen Zweck.
Was versteht Gehlen unter Abstraktion und Entsinnlichung im Kontext von Naturwissenschaft und Technik?
Gehlen sieht in der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung eine zunehmende Abstraktion und Entsinnlichung. Dies führt zu einem Verlust an unmittelbarer Erfahrung und einem geringeren Halt des naturwissenschaftlich-technischen Weltbildes. Die Arbeit untersucht, ob diese Abstraktion und Entsinnlichung der einzige Grund für diesen geringen Halt ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Arnold Gehlen, Anthropologie, Technikphilosophie, Institution, Entlastung, Weltoffenheit, Mängelwesen, Abstraktion, Entsinnlichung, Industrialisierung, Kulturkritik.
- Arbeit zitieren
- Daniel Burckhardt (Autor:in), 1998, Arnold Gehlen: Naturwissenschaft und Technik als Institution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95887