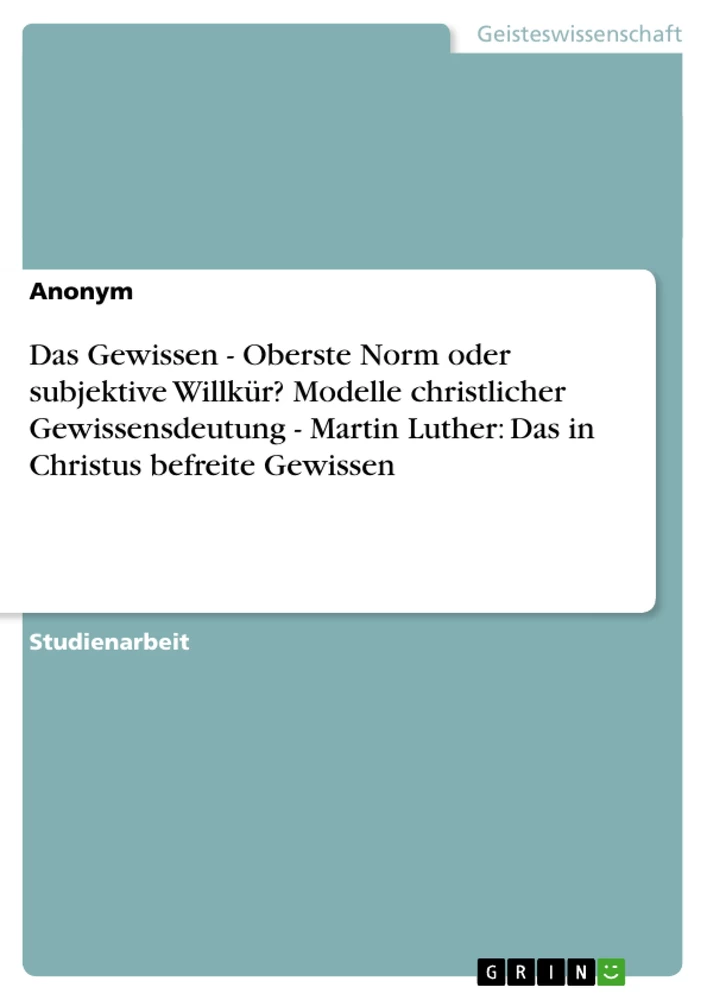Was, wenn das, was Sie über Martin Luther und die Reformation zu wissen glaubten, nur die halbe Wahrheit ist? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse des Lebens und der Lehren des Mannes, dessen Gewissen die Welt veränderte. Diese tiefgründige Erkundung enthüllt nicht nur die bekannten Ereignisse – vom Thesenanschlag in Wittenberg bis zum Reichstag zu Worms –, sondern dringt auch zum Kern von Luthers revolutionärem Verständnis von Glaube, Sünde und Erlösung vor. Entdecken Sie, wie Luther die Autorität der Kirche in Frage stellte, das Konzept des Gewissens neu definierte und die Grundlage für eine persönliche Beziehung zu Gott legte. Untersuchen Sie die Bedeutung von Gesetz und Evangelium, die Zweireichelehre und Luthers Sicht auf die Rechtfertigung, die bis heute theologische Debatten prägen. Dieses Buch bietet einen detaillierten Einblick in Luthers Theologie, beleuchtet seine Auseinandersetzung mit dem Gewissen, seine Betonung der Gnade und seine unerschütterliche Überzeugung von der Autorität der Heiligen Schrift. Erfahren Sie mehr über Luthers frühe Jahre, den Ablassstreit, seine Bibelübersetzung und seine späten Jahre. Analysiert werden das veränderte Autoritätsverständnis, das Sündenverständnis, der Glaubensbegriff bei Luther, Rechtfertigung und Erlösung sowie das Gewissensphänomen. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die Wurzeln des Protestantismus und die anhaltende Bedeutung von Luthers Ideen verstehen wollen. Es ist eine Reise in das Herz einer religiösen Revolution, die die Welt veränderte und die Frage aufwirft: Was bedeutet es wirklich, seinem Gewissen zu folgen? Ergründen Sie die Komplexität von Luthers Denken und entdecken Sie, wie seine Lehren auch heute noch relevant sind. Die Reformation, Martin Luther, Theologie, Gewissen, Glaube, Sünde, Erlösung, Rechtfertigung, Evangelium, Gesetz, Bibel, Kirche, Autorität, Gnade, Protestantismus, Reichstag zu Worms, Wittenberg, Ablassstreit, Heilige Schrift, Thesenanschlag, Gewissensfreiheit, Glaubenslehre, Gottesbild, Menschsein, Religionsfreiheit, Theologische Ethik, Mittelalter, Christentum, Katholizismus, Protestantische Theologie, Reformatorische Theologie.
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
1. DAS LEBEN DES MARTIN LUTHER
1.1 Die frühen Jahre
1.2 Der Ablaßstreit
1.3 ,,Eine Bibel für das Volk"
1.4 Die späten Jahre
2. ,,DAS IN CHRISTUS BEFREITE GEWISSEN" - DIE LEHRE LUTHERS
2.1 Das veränderte Autoritätsverständnis
2.2 Gesetz und Evangelium
2.2.1 Das Gesetz
2.2.2 Das Evangelium
2.2.3 Gesetz und Evangelium bei Paulus
2.2.4 Die Lehre von den zwei Reichen
2.3 Das veränderte Sündenverständnis
2.3.1 Definition der Sünde
2.3.2 Von der Tatsünde zu Luthers Sündenverständnis
2.3.3 Erbsünde
2.4 Der Glaubensbegriff bei Luther
2.5 Rechtfertigung und Erlösung
2.5.1 Der Akt der Rechtfertigung
2.5.2 Die Auswirkungen der Rechtfertigung
2.6 Das Gewissensphänomen
2.6.1 Vom angefochtenem zum gutem Gewissen
2.6.2 Das im Wort Gottes gefangene Gewissen
NACHWORT
GEDRUCKTE QUELLEN & LITERATUR
Vorwort
1. Das Leben des Martin Luther
1.1 Die frühen Jahre
Martin Luther wurde als Sohn des Bergmannes Hans Luder am 10.11.1483 in Eisleben geboren. Nach einer streng christlichen Erziehung verbrachte er seine Schuljahre in Mansfeld, Magdeburg und Eisenacht. In den Jahren von 1501 bis 1505 absolvierte er das Studium der Artes an der Universität Erfurt, schloß mit dem Magistergrad ab und schrieb sich auf Wunsch seines Vaters für ein Jurastudium ein.
Allerdings machte der junge Luther dann während eines schweren Gewitters mit Blitzeinschlag eine anscheinend derart traumatische Erfahrung, daß er gelobte, Mönch zu werden. In Erfüllung dieses Eides gab er dann das Jurastudium auf und trat am 17.7.1505 in das Erfurter Augustiner-Eremitenkloster ein,1 wo er die drei feierlichen Gelübde Gehorsam, Keuschheit und Armut ablegte und nach einer durch hl. Kirchenvater Augustinus bestimmten Lebensweise lebte.2 Anno 1506 legte er dann den Profeß ab und wurde am 3.4.1507 zum Priester geweiht. Im darauffolgendem Jahr, 1508, erfolgte dann die Berufung zum Lektor am Ordensstudium an die neugegründete Universität in Wittenberg durch seinen Gönner Johannes von Staupitz,3 der an dieser von 1502 bis 1512 lehrte.4 Dort las er noch während seines Theologiestudiums über die Ethik des Aristoteles und promovierte am 18.10.1512 zum Dr. Theologie. Anschließend übernahm er die Professur der Hl. Schrift und behielt diese bis zu seinem Tod bei.5
1.2 Der Ablaßstreit
Anno 1517 führte der Erzbischof Albrecht von Mainz den schon durch Julius II. proklamierten Ablaßhandel ein.6 Der Erlös daraus diente angeblich für den Bau der Peterskirche in Rom, es wird jedoch behauptet, Albrecht II, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, hätte das Geld benötigt, um seine Schulden beim Bankhaus Fugger zurückzuzahlen. Anfang Herbst hörte Martin Luther von den marktschreierischen Methoden des Ablaßhändlers Johannes Tetzel, welcher in den Ländern Brandenburg und Magdeburg tätig war. Dies veranlaßte ihn am 31.10.1517 zu einem Schreiben an den Erzbischof in Sachen Ablaßhandel. 7 Unklar ist dabei, ob der Satz ,, Sonst könnte schließlich jemand aufstehen und etwas veröffentlichen, was jene Leute und jenes Büchlein widerlegte, zur höchsten Schmach Eurer durchlauchtigsten Hoheit" 8 aus jenem Brief als Befürchtung oder als Drohung von Seiten Luthers gemeint war.
Mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an die Schloßkirche von Wittenberg, der entgegen weitläufiger Meinung wahrscheinlich erst am 1.11.1517 erfolgte9, wollte Luther nur eine wissenschaftliche Disputation über Sündennachlaß und göttliche Gnade anregen, bewirkte jedoch wesentlich mehr: ,, Er brachte schließlich die Menschen zum Nachdenkenüber die Mißstände in der Kirche schlechthin".10
Der Heilige Stuhl reagierte hierauf und orderte Luther im Juli des darauffolgenden Jahres binnen 60 Tagen nach Rom. Kurfürst Friedrich III. von Sachsen bewirkte jedoch eine Verlegung des Verhörs nach Deutschland, indem er Luther unter seinen landesherrlichen Schutz stellte.11 Auch während des Verhörs vom 12. 10. 1518 bis zum 14.10.1518 durch den zum Augsburger Reichstag entsandte Kardinal Legat Cajetan de Vio, weigerte sich Luther seine Thesen zu widerrufen, ,, wenn er nicht aus der Schrift od. mit Vernunftgründen widerlegt werde".12 Am 20.Oktober floh er dann aus Furcht vor der Verhaftung aus der Stadt. Da Luthers Häresie nach Meinung von Kurfürst Friedrich dem Weisen, ein Gönner Luthers, nicht erwiesen war, verweigerte dieser die Auslieferung.
Im Verlauf der Leipziger Disputation vom 4.7.1519 bis 14.7.1519 ,,leugnete [Luther] die Irrtumslosigkeit der Allgemeinen Konzilien",13 sprich "die Existenz eines höchsten kirchl. Lehramts".14 Die Bulle `Exsurge Domine' vom 15.6.1520 verurteilte hierauf 41 Sätze aus Luthers Schriften als ,, irrig,ärgerniserregend [... und] häretisch".15 Anschließend ,, faßte er seine Glaubenslehre in drei Schriften [zusammen], die dank des Buchdrucks rasche Verbreitung fanden".16 Namentlich waren dies ,,An den christlichen Adel deutscher Nation" vom August 1520, ,,Die babylonische Gefangenschaft der Kirche" vom Oktober 1520 und ,,Von der Freiheit eines Christenmenschen" vom November 1520.17
Am 17.11.1520 appellierte Luther als Reaktion auf die Verurteilung seiner Schriften nochmals an das Generalkonzil und verbrannte am 10.12.1520 ein gedrucktes Exemplar der Bannandrohungsbulle öffentlich. Dies führte am 3.1.1521 zur offiziellen Exkommunikation durch die Bulle `Decret Romanum Pontificem' .
Entgegen das geltende Gesetz, nach dem der Kirchenbann durch die weltliche Autorität vollstreckt werden mußte, beorderte der neugewählte Kaiser Karl V. Luther am 17.4.1521 vor den Wormser Reichstag;18 dies geschah aufgrund des Drucks der Territorialherren und der Reichsstädte im Reichstag, die auf Luthers Seite standen und genügend Einfluß hatten.19 Hier bekannte sich Martin Luther zu seinen Schriften, verweigerte jedoch am 18.4.1521 die Widerrufung seiner Lehren20 mit den Worten ,, Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründeüberzeugt werde ..., so bin ichüberwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes"21 und endete mit den Schlußworten ,,Gott helfe mir.
Amen". Dies führte am 26.Mai (mit dem Datum vom 8. Mai) zum sogenannten Wormser Edikt, welches über Luther die Reichsacht verhängte und damit auch die Verbrennung seiner Schriften gebot.22 23
1.3 ,,Eine Bibel für das Volk"
Während seiner Rückkreise wurde Luther dann im Auftrag seines Schirmherrn, des Kurfürsten von Sachsen, auf die Wartburg entführt. Dort lebte er als ,,Junker Jörg".24
Während seines zehn Monate dauernden Aufenthalts25 schrieb er zahlreiche Abhandlungen und Briefe und begann erst während der letzten Wochen mit der Übersetzung des griechischen Neuen Testaments ins Deutsche. Trotz der geringen Zahl von Büchern, die ihm hier zur Verfügung stand, gelang es Luther, die ganze Übersetzung innerhalb von zehn Wochen niederzuschreiben.26
Noch während seines Aufenthalts auf der Wartburg kam es jedoch zu Unruhen aufgrund seiner Lehren. Um ein Einschreiten der weltlichen Macht zu verhindern, begab sich Luther am 6.3.1522 nach Wittenberg und stellte durch seine Predigten die öffentliche Ordnung wieder her.27
Ende September 1522 erschien im sächsischen Wittenberg, einer Stadt von circa 3000 Einwohnern, das von Martin Luther aus dem griechischen ins deutsche übersetzte Neue Testament unter dem Titel ,,Das Newe Testament Deutzsch. Vuittenberg" in einer Auflage von 3000 Exemplaren28 bei dem Wittenberger Drucker Melchior Lotther. Später wird es auch ,,Septembertestament Luthers" genannt.29 Hierin ließ sich jedoch kein Erscheinungsjahr, kein Name des Übersetzers, kein Drucker, kein Verleger und kein Holzschneider finden. Begründet war diese Geheimhaltung darin, daß Luther zu dieser Zeit noch unter der Reichsacht Karls V. stand, exkommuniziert und gebannt war. Da der kaiserliche Erlaß die Unterstützung des Häretikers verbot, wollte keine der beteiligten Personen genannt werden. Trotz allem wurde das Buch - wahrscheinlich aufgrund des Buchdruckerkunst als Massenmedium - ein voller Erfolg und es erschienen zahlreiche Nach- und Raubdrucke. Anno 1534 wurde dann die komplette Bibel veröffentlicht. Während jedoch der Drucker Hans Lufft aus Nürnberg mit seiner ,,Luther-Bibel" reich wurde, erhielt Martin Luther niemals ein Honorar.30
Als Luther sah, daß seine Lehren zur Bildung von radikalen Gruppen wie Schwärmer und Täufern führten, grenzte er sich von diesen Gruppen ab.31
Die Forderungen der Bauern nach einem ,, Gottesstaat auf Erden, in dem alle Menschen gleich sind"32 führten zu den Bauernkriege von 1524 und 1525. Im Mai und Juni 1525 wurden die Bauern durch die Armeen des Adels und der Landesherren endgültig besiegt. Diese Bauernerhebung kostete etwa 100.000 Menschen das Leben.33
1.4 Die späten Jahre
Nach dem Rückgang der lutherischen Volksbewegung widmete sich Martin Luther seinen Vorlesungen und heiratet am 13. 6.1525 Katharina von Bora.
Am 18.2.1546 starb er dann in Eisleben an Angina pectoris, wohin er zur Schlichtung eines Streits zwischen Mansfelder Grafen gereist war.34
2. ,,Das in Christus befreite Gewissen" - Die Lehre Luthers
2.1 Das veränderte Autoritätsverständnis
Wie schon das Studium vom Leben des Martin Luther zeigt, billigte er der katholischen Kirche keine absolute Autorität zu. Dies belegt sein gesamtes Auftreten, insbesondere jedoch seine Verweigerung des Widerrufs 1518 und das Abstreiten eines höchsten kirchlichen Lehramts 1519.35
Doch was war diesem Mann `heilig', wenn nicht die Kirche, in der er aufgewachsen ist? Wahrscheinlich entwickelte Martin Luther seine `neue' Ethik während seiner ersten Jahre in Wittenburg, war sich jedoch des Gegensatzes zur kirchlichen Autorität nicht bewußt. Bis zum Jahre 1517, dem Beginn des Ablaßstreits, war für Luther das Wort der Kirche bindend.36 Auch in seinen darauffolgenden Zweifeln an der Autorität der Kirche beschränkte er sich nur auf die Frage, ,, ob die Kirche die Vollmacht habe, neue Glaubensartikel festzusetzen",37 oder nicht. Die Zweifel, die er innerlich fühlte, betrafen ,, das Gegenüber für das Gewissen",38 also die Autorität, der das Gewissen des Menschen verpflichtet ist. Er kam für sich zu der Überzeugung, daß diese einzig und allein das Wort Gottes ist.39 Allerdings meinte Luther damit nicht die Bibel, sondern Christus selbst und damit die Gnadenzusage Gottes gegenüber der Menschheit.40 Somit darf sich das Gewissen nicht ,, menschlichen Satzungen oder Lehren" 41 unterordnen. Erläßt die Kirche jedoch Beschlüsse, die dem Wort der Verheißung widersprechen, so wird die kirchliche Autorität zur Tyrannei, da ,, sie die ihr gegebene Vollmachtüberschreitet"42 und somit gottwidrig handelt. So stellte er etwa in seiner Abhandlung `De potestate concilii' anno 1536 fest, daß Bischofs- und Konzilversammlungen nicht die Kirche selbst seien, sondern diese nur repräsentieren, und daß es die Aufgabe eines Konzils ist, bei der Lehre der Apostel, die einzigartige Autorität besessen haben, zu bleiben. Überhaupt hatten die Apostel, allen voran Paulus, in der Vorstellung Luthers, nach Christus, aufgrund ihrer einzigartigen Stellung, höchste Autorität. Diese ,,gründete sich auf die ihnen zuteil gewordene Verheißung des Hl. Geistes".43 Daraus folgerte er auch, daß die Heilige Schrift, auch wenn sie menschlichen Ursprungs ist, doch das Wort Gottes widerspiegelt, da die Reden der Apostel ,,von Gott befohlen und mit großen Wundern bestätigt und bewiesen worden"44 sind.
Zusammenfassend kann man sagen, daß es Luther also nicht darum ging, daß die Kirche zu stark in das Weltgeschehen eingegriffen hätte, sondern ,, vielmehr um die Freiheit der Gewissen vor Gott".45 Somit trat für ihn nicht ,, eine neue Autorität an die Stelle einer anderen [...], sondern die Autorität selbst [...wurde] durch die radikale Unterscheidung zwischen göttlich und menschlich neu begriffen".46
2.2 Gesetz und Evangelium
Einer der zentralen Punkte der reformatorischen Theologie ist die Zwei-Reiche-Lehre und damit Verbunden die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium.47
2.2.1 Das Gesetz
Luther sah im Gesetz vor allem die judikatorische Funktion der Weisungen Gottes, verkörpert im ,, Zorngericht [...] Gottes, das den Menschen seiner Sünde [... und] Rettungslosigkeitüberführt".48 Inhaltlich läßt sich dieses Gesetz einerseits in den Zehn Geboten oder der Bergpredigt finden,49 andererseits repräsentiert die Gesamtheit der Gebote und Satzungen der fünf Bücher Moose - und somit der gesamte Pentateuch - das Gesetz.50
2.2.2 Das Evangelium
,, Das Evangelium dagegen ist Gottes erbarmendes, rettendes, neuschöpferisches Handeln, das zwar nur Hand in Hand mit jenem ergeht, jedoch [...] vom Gesetz zu unterscheiden ist". 51 Besondere Betonung fanden hierbei die Gnadenmittel im Zusammenhang mit dem Evangelium, welches ein Geschenk Gottes an die Sünder ist52 und somit immer auf die Person Jesu Christi hinweist. Dabei wird Jesus jedoch nicht nur als Verkünder und somit erster Evangelist verstanden, sondern ist aufgrund seines Heilswerkes selbst Bestandteil und Träger des Evangeliums.53 Somit stellt das Evangelium kein neues Gesetz dar, sondern ,, der Glaubende bleibt [...] um eines getrosten Gewissens willen auf die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium angewiesen ... Vom reformatorisch erfaßten Evangelium her schließt sich das Gesetz zu einer unteilbaren Einheit zusammen. In all seinen mehr oder weniger verworrenen Erscheinungsformen will es auf Gott als Gesetzgeber hin [...] ausgelegt werden".54 Also ging es Luther also nicht ,, um ein zweifaches Gesetz, sondern um einen zweifachen Gebrauch des Gesetzes".55
2.2.3 Gesetz und Evangelium bei Paulus
Luther schloß sich damit der Lehre des Apostels Paulus an. Wie später Luther, lehrte auch dieser, daß ,, das [... Gesetz] als Heilsweg unmöglich ist" und ,, verkündete das [... Evangelium] von der rettenden Gnade Gottes, die im Kreuz Christi sich offenbart, als den einzigen für alle Menschen [... und] alle Zeiten geltenden Heilsweg".56 Daher kann der sündige Mensch nur durch den Glauben an das Evangelium und damit Verbunden an den Gnadenakt Gottes, welcher in Jesus Christus präsent wird, Erlösung erlangen, nicht jedoch durch die buchstabengetreue Befolgung der Gebote.57
2.2.4 Die Lehre von den zwei Reichen
Die Zweireichenlehre Luthers spricht somit einerseits vom Reich Christi, dessen Inhalt das Evangelium ist, und andererseits von seinem Gegenüber, dem Reich der Welt, manifestiert im Fleisch, der Sünde, dem Verstand und dem Teufel. Der Inhalt dieses Reiches der Welt steht unter der Herrschaft des Gesetzes.58
2.3 Das veränderte Sündenverständnis
2.3.1 Definition der Sünde
Sünde wird als ,, eine gottwidrige Grundverfassung menschlicher Existenz, aus der die einzelnen sündigen Wollungen [... und] Akte schon hervorkommen"59 definiert. Der Sünder verliert durch seine Taten die Gemeinschaft mit Gott, was die ewige Verdammnis zur Folge hat. Um eine Vergebung der Sünden zu erhalten, forderte bereits Jesus eine totale Umkehr zurück zu Gott, welcher sich, aufgrund seiner unbegreiflichen `Vaterliebe', des Sünders annimmt und ihm vergibt.60
2.3.2 Von der Tatsünde zu Luthers Sündenverständnis
In der scholastischen Tradition hing das Sündenverständnis immer mit einer bestimmten Tat zusammen. Man ging davon aus, daß eine bestimmte Tat eine Verfehlung gegen Gott darstellte und gesühnt werden muß. Durch dieses Sündenverständnis wurde zu dieser Zeit die Absolution für einzelne Sünden, sprich für einzelne Taten, gegeben. Den Höhepunkt dieses Verständnisses stellte dann sicherlich der 1517 eingeführte Ablaßhandel dar, durch welchem man sich sogar im voraus die Vergebung der Sünde, also für eine `geplante' Sünde, ohne jegliche Metanoia, erkaufen konnte.
Eben von diesem Sündenverständnis distanzierte sich Martin Luther aufs schärfste. Seinen Lehren zu folge bleibt die Sünde und das damit verbundene Gewissensurteil nicht an einer bestimmten Tat haften, sondern trifft die ganze Person.61 Das heißt, der sündige Mensch entfernt sich mit jeder Sünde weiter von Gott; die Sünde ist damit nicht, daß er dies oder jenes begangen hat, sondern die Tatsache, daß er sich wieder besseren Wissens von Gott abgekehrt hat. Aus diesem Sündenverständnis heraus, können auch keine Einzelsünden vergeben werden, sondern eine Vergebung der Sünde kann nur global durch ,,Gottes erbarmendes, rettendes, neuschöpferisches Handeln",62 also durch einen Gnadenakt Gottes,63 erwirkt werden. Dieser Sünden- und Erlösungsbegriff Luthers ist dabei eindeutig eschatologisch geprägt.64
2.3.3 Erbsünde
Wie schon Augustinus vor ihm, ging Luther davon aus, daß jeder Mensch durch eine von Generation zu Generation weitergegebene `Erbsünde' von Natur aus zum Schlechten neigt. Diese ,, nach der Taufe zurückbleibende böse Begierlichkeit (Konkupiszenz), die den Menschen unfähig [... zum] Guten macht [... und] als Selbstgerechtigkeit jedes seiner Werke vergiftet, ist Sünde schlechthin".65 Trotz der Tatsache, daß der Mensch ,, aus ihr nicht durch eigene Kräfte heraus- [... und] in das rechte Verhältnis zu Gott kommen [kann ...] bleibt die Sünde Schuld des Menschen, für die er verantwortlich ist. [...] Dabei bleibt der sündige Mensch Geschöpf Gottes".66
Seit der Zeit Papst Gregors des Großen ,, zählt man 7 Ausstrahlungen des erbsündl [... ichen] Hochmuts auf: Hoffart, Neid, Zorn, Geiz, Unkeuschheit, Unm äß igkeit und rel.-sittl. Trägheit. Aus ihnen quellen nicht nur andere [... Sünden], sie selbst wachsen sich wegen der Nähe zu menschl [... ichen] Urantrieben auch leicht zu Lastern aus".67
2.4 Der Glaubensbegriff bei Luther
Die Grundbegriffe seiner Glaubenslehre entwickelte Luther wohl während seines Lebens als Mönch im Erfurter Augustinerkloser. Seine starke Beschäftigung mit der Bibel und den Schriften des Philosophen Wilhelm Ockham riefen Zweifel an der vorherrschenden scholastischen Glaubenslehre hervor.68 Indem er zu der Überzeugung gelangte, daß der Mensch seine Erlösung alleine durch den Glauben, also ohne eine Vermittlung durch den Klerus, erlangen konnte, distanzierte er sich - zuerst unwissentlich - von der katholischen Kirche.69
Für den Glauben im Sinne Luthers war es wichtig, daß sich der Sünder nach dem Wort Gottes, manifestiert in der Schrift, richtet, und so eine Verbindung mit Christus eingeht;70 daher nahm die Heilige Schrift bei Luthers Religionsverständnis eine zentrale Rolle ein.71 Allerdings mahnte Luther auch vor `übertriebener Schrifttreue'. So unterschied er die Kompetenzen des Glaubens und der Vernunft, die er in die Verantwortung des Christen mit einbezog. Diese darf sich zwar ,, nicht in das Gottesverhältnis einmischen",72 soll jedoch über die Verhältnismäßigkeit richten, da die ,, Menschlichkeit im Umgang mit dem Recht [...] höher eingeschätzt [wird,] als das Insistieren auf dem Buchstaben".73 Weiterhin wies er darauf hin, daß der Mensch geduldig sein solle und dem Handeln Gottes nicht vorgreifen soll.74
Voraussetzung jedoch für die Fähigkeit des Menschen zum Glauben, war die Taufe. Diese war bei Luther absolut heilsnotwendig. Von ihr ging die ,, Vergebung der Sünde, [...] Erlösung von der Macht des Todes [... und] des Teufels, Wiedergeburt, Einpflanzung in das Auferstehungsleben [... und] Hineinnahme in das Reich Christi sowie Aufnahme in die Kirche"75 aus. Dabei sind diese Auswirkungen der Taufe nicht im Glauben begründet, sondern vielmehr ist sie Voraussetzung für den Glauben selbst.76
2.5 Rechtfertigung und Erlösung
Die Lehre von der Rechtfertigung bildete bei Luther den Mittelpunkt seiner Theologie.77 Sie ist seinen Lehren zufolge das ,, Ereignis des Christwerdens"78 und das ,, Fundament des Christseins".79 Luther sah in ihr einen Akt der Gnade von Seiten Gottes, durch den der sündige Mensch von seiner Schuld losgesprochen und in den Stand des Friedens mit Gott erhoben wird. Sie ist die ,, Verheißung der Errettung zum ewigen Leben".80
2.5.1 Der Akt der Rechtfertigung
Die Begründung für diesen Gnadenakt liegt nach reformatorischen Verständnis in der ,, dreifache [n] Exklusivformel: allein aus Gnade, allein durch Christus, allein durch den Glauben":81
1. ,,Allein aus Gnade": Wie schon erwähnt, ist der Mensch in seiner Gesamtheit der Gnade Gottes ausgesetzt. Weder aufgrund seiner Werke82 noch durch sonstige Umstände kann er die Erlösung erlangen; allein durch die unverdiente Gnade Gottes, welche in der ,, barmherzigen Liebe",83 die Gott für seine Schöpfung hat, begründet liegt, kann er auf das Himmelreich hoffen.84 Nur kraft dieser Gnade kann der Mensch von seiner Schuld losgesprochen und somit in das ,, Kindschaftsverhältnis zu Gott"85 aufgenommen werden. Daher ist Gnade nicht ,, die mit dem Sündennachlaßunlöslich verbundene ü bernatürliche Seinserhöhung des Menschen, sondern die persönl [... iche] Annahme des Sünders durch Gott um Christi willen, der ein [... vom] Hl. Geist gewirkter Heilungsprozeßnachfolgt".86
2. ,,Allein durch Christus": Jesus Christus ist nach reformatorischen Verständnis nicht nur Verkünder und Überbringer der Gnade Gottes, sondern,87 begründet in dem Verständnis der Verkörperung des Evangeliums Gottes durch Jesus Christus,88 gleichzeitig Teil und Medium dieser Gnade. Somit ist Christus ,, die leibhafte Gegenwart der Gnade Gottes, der eine Grund, unserer [... Rechtfertigung]".89 Luther definierte den Gerechtfertigten als denjenigen, ,, von dem Christus im Gewissen Besitz ergriffen hat".90
3. ,,Allein durch Glauben": Der Sünder kann allein durch den ,, im Glauben ergriffene [n] gekreuzigte [n] Christus"91 gerechtfertigt werden. Dabei verstand Luther ,, die vertrauensvolle Hingabe des Sünders an das Wort des verheißenden Gottes in der Schrift; allein durch den Glauben wird der Sünder mit Christus verbunden, bleibt Sünder [... und] ist zugleich gerecht".92 Die Rechtfertigung kann somit kein `automatischer' Akt sein, da sie ,, das Ich des Menschen mit Gott verbinden will"93 und somit die Bereitschaft des Individuums voraussetzt.
2.5.2 Die Auswirkungen der Rechtfertigung
Wie schon erwähnt, wird der Mensch durch den Akt der Rechtfertigung in das rechte Verhältnis zu Gott und Jesus gerückt und ihm wird die Vergebung der Sünden und somit das Himmelreich versprochen. Er wird durch dieses Ereignis zum `wahren Gläubigen'.94 Aber auch der Gerechtfertigte, also der, von dessen Gewissen Christus Besitz ergriffen hat, bleibt Sünder, wird sich seiner Sünde gewiß,95 und benötigt daher die Befreiung durch das Evangelium.96
Da nach Luther der Glaube und die Hingabe an das Wort Gottes als Voraussetzung für die Rechtfertigung gelten, und dieses, manifestiert in der Bibel, den Menschen lehrt, ein guter Christ zu sein, ging er davon aus, daß Gute Werke notwendigerweise Auswirkungen dieser Gerechtmachung durch Gottes freisprechendes Urteil sind. Sie sind somit ,, Früchte der neuschöpferischen Gnade Gottes".97 Daher kann die Rechtfertigung auch nicht durch gute Taten erlangt werden, da diese schließlich `Auswirkung der Gerechtfertigung' sind, und ihr darum nicht vorausgehen können.98
2.6 Das Gewissensphänomen
Luther ist ,, der Entdecker des Gewissens";99 zumindest in den Augen von Bernhard Lohse. Auch Karl Holl schreibt ,, Luthers Religion ist Gewissensreligion im ausgeprägtesten Sinne des Wortes".100 Da es sich bei diesen Personen um namhafte Theologen handelt, zeigen diese Aussagen, wie zentral der Gewissensbegriff in Luthers Lehren war.
2.6.1 Vom angefochtenem zum gutem Gewissen
Das scholastische Gewissensverständnis, welches zur Zeit Luthers in der katholischen Kirche vorherrschte, unterschied im Gewissen zwischen synteresis und conscientia. Die conscientia bildete dabei die grundsätzlichen Regeln, die jedem Menschen eingeschrieben waren und durch die Synteresis, ein ,, durch den Sündenfall nicht ganz verderbtes Vermögen der Seele, zum Guten hinzuneigen",101 auf eine bestimmte Situation hin ausgelegt wurde. Das so entstehende Gewissensurteil stellte dann ein moralisches Phänomen dar,102 welches sich am Gesetz orientierte und auf eine bestimmte Tat abzielte. Nach diesem Verständnis lobte, bzw. tadelte das Gewissen die betroffene Person für eine bestimmte Handlung, traf sie jedoch ,, nicht in ihrem Selbstsein".103
Eben dieser Auffassung stellte sich Luther mit seinem Verständnis von Gewissen entgegen. Er bezeichnete das Gewissen, welches sich auf Werke stützt als das `angefochtene Gewissen' und lehrte, daß man dadurch nicht zum Frieden kommen kann.104,, Durch das Evangelium hingegen als die Lehre von dem Glauben, daßwir um Christi willen einen versöhnten Gott haben, empfangen die Gewissen Trost und Gewißheit".105 Das `gute Gewissen', welches der Rechtfertigung durch die Gnade Gottes entspringt,106 geht daher dem gutem Werk voraus. Somit geht es beim Gewissen, ebenso wie bei der Sünde, nicht um einzelne Handlungen, sonder um ,, das Sein des Menschen"107 in seiner Gesamtheit als Person; das Urteil des Gewissens ist also ein108,, Urteilüber das Sein des Menschen".109
Setzt sich ,, im Gewissen gegen die Herrschaft des Gesetzes das Evangelium durch - und das geschieht durch das Wort der Verheißung nur in ständiger Überwindung der Anfechtung -, so wird das Gewissen befreit. Allein solch freies Gewissen ist nach Luther gutes Gewissen".110
2.6.2 Das im Wort Gottes gefangene Gewissen
,,... So bin ich durch die Stellen der Hl. Schrift, die ich angeführt habe,überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes [...]. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen zu tun weder sicher noch heilsam ist".111 Diese, seine Antwort in Worms anno 1521 zeigt sehr schön sein Gewissensverständnis: Er sah im Gewissen nicht einfach ein ,, Organ des sittlichen Bewußtseins, dasüber Recht oder Unrecht menschlichen Tuns befindet",112 sondern einen Ort, an dem der Mensch Gott erfährt. Hier, im Innersten des Menschen, wird er sich seiner Mangelhaftigkeit bewußt, erfährt das Strafgericht Gottes und damit die Anfechtung seiner Person durch Gott. Somit war für ihn ,, gutes Gewissen und Glaube identisch".113 Die Weiterführung dieses Gedankens führte ihn dazu, daß er die ,, traditionelle Fegefeuerlehre umprägt und selbst die Hölle als gegenwärtig in der Anfechtung erfahrbar"114 ansah, und man daraus folgern kann, daß für Luther der Mensch kein Gewissen hatte, sondern Gewissen war.115
Beschäftigt man sich mit der Lehre Luthers, so stößt man auch oft auf die von ihm proklamierte `Freiheit des Gewissens'. Hierbei meinte er jedoch nicht die ,, Autonomie des Menschen",116 sondern die Rettung des Gewissens ,, aus der Anklage, aus der Angst vor dem Zorn Gottes, zu dem guten Gewissen, das allein der Glaube selbst ist".117 Dieses ,, Gefangensein in Gottes Wort und damit verbunden [... die] Unmöglichkeit, etwas gegen das Gewissen zu tun",118 bezeichnete er als `Gewissensfreiheit' in dem Sinne, daß das Gewissen dank dem ,, Freispruch durch Gott in Jesus Christus"119 die Zusage Gottes auf die Erlösung repräsentiert und dem Menschen ,, kraft der Verheißung, wie sie im Evangelium zugesprochen wird"120 die rechtfertigende Gnade zuteil wird und damit ,, das Gewissen ganz im Worte Gottes verankert".121 Aufgrund dieses Gesichtspunktes läßt sich feststellen, daß Luther ,, das Gewissen nicht moralisch, sondern theologisch"122 sah. Zusammenfassend kann man sagen, ,, daßdas Gewissen für die Rechtfertigung von der gr öß ten Bedeutung ist. So wie der Mensch von sich aus die Selbstrechtfertigung sucht und dabei in Hochmut oder Verzweiflung verfällt, so ist das Gewissen des Gerechtfertigten frei geworden von jener Knechtschaft unter dem Gesetz. Darum ist es fähig, sofern es an Christus gebunden ist 123, zwischen Verurteilung und Freispruch des Menschen zu unterscheiden und so den Glauben gewißzu machen".124 Sein Gegenüber ist das Wort, jedoch keine menschliche Lehre125 und sein Urteil ist nicht autonom, sondern ein ,, Akt innersten Gehörs".126 Luthers Gewissensbegriff hat, ebenso wie seine gesamte Lehre, einen eschatologischen Charakter.
Nachwort
Martin Luther war sicherlich ein sehr mutiger und gläubiger Mensch. Die inneren Konflikte, die ihn belasteten und zur Entwicklung einer reformierten Glaubenslehre, basierend vor allem auf dem Gewissen, führten, waren wohl in den Mißständen der Katholischen Kirche im späten Mittelalter zurückzuführen.
Sein insistieren auf die Relation des Gewissens zu Gott ist meiner Meinung nach eine einleuchtende Weiterführung seiner Überzeugung als gläubiger Mensch. Da das Gewissen nicht real greifbar ist, jedoch von jedem Menschen erfahren wird, ist und war es sicherlich ein zentrales Bestreben der Theologen und Philosophen, eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Da Luther das gesamte Leben von Gott gegeben und bestimmt sah, definierte er das Gewissen als `gefangen in Gottes Wort' und verfolgte somit seine Lehre konsequent.
Obwohl sein Bild des Gewissens im großem und ganzen gut durchdacht ist, weist es einige Schwachpunkte auf.
So läßt sich bei Luther beispielsweise nicht erklären, wie die Gewissen verschiedener Individuen zu unterschiedlichen Gewissensurteilen kommen können - und die Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens macht, zeigen, daß hier oft verschiedene Meinungen und Einstellungen auftreten können.
Weiterhin sehe ich Probleme bei der absoluten Abgrenzung von der Tatsünde. Meinen persönlichen subjektiven Erfahrungen zufolge meldet sich das Gewissen auf zwei verschiedene Arten: Erstens als Urteil über mich selbst (nach Luther das `gute Gewissen', welches in Gott gefangen ist) und andererseits bezüglich einer bestimmten Handlung (nach Luther das `angefochtene Gewissen').
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Luther sicherlich viel für den Fortschritt der katholischen Kirche - auch wenn er schmerzhaft war - getan hat.
Seine Lehre, in der er viel Gedankengut von Paulus und Augustinus aufgegriffen hat, enthält zahlreiche Aspekte, die zum nachdenken aufrufen und man kann alles in allem sagen, daß sie gut durchdacht und konsequent durchgeführt wurde.
Ein endgültiges Urteil über seine Theologie und seinen Gewissensbegriff abzugeben kann und will ich mir jedoch nicht anmaßen.
Gedruckte Quellen & Literatur
1 Brandenburg, A., Luthertum, in: LThK Band 6, Freiburg, 21961, 1231-1241
2 Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Stuttgart, 1980
3 Friedenthal, Richard, Eine Bibel für das Volk, in: Weidenfeld C. Georg / Nicolson, Weltgeschichte. 5000 Jahre Fakten in Text und Bild vom Pharaonenstaat bis zur Demokratisierung in Osteuropa, Frankfurt, 1991, 325-329
4 Harenberg, Bodo, Chronik der Menschheit (="Chronik"-Edition Band 3), Dortmund, 11984
5 Heim, Manfred, Augustiner-Eremiten, in: Schwaiger, Georg, Mönchtum Orden Klöster. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München, 21994, 66-72
6 Honecker, Martin, Einführung in die Theologische Ethik. Grundlagen und Grundbegriffe, Berlin, 1990, 126-136
7 Jedin, H., Luther , in: LThK Band 6, Freiburg, 21961, 1223-1230
8 Joest, W., Rechtfertigung, in: LThK Band 8, Freiburg, 21963, 1033-1050
9 Jungmann, J. A., Evangelium, in: LThK Band 3, Freiburg, 21959, 1255-1259
10 Lohse, Bernhard, Gewissen und Autorität bei Luther, in: Kerygma und Dogma. Zeitschrift für theologische Forschung und kirchliche Lehren 20. Jahrgang (1974), 1-22
11 Luther und die Reformation, in: Weidenfeld C. Georg / Nicolson, Weltgeschichte. 5000 Jahre Fakten in Text und Bild vom Pharaonenstaat bis zur Demokratisierung in Osteuropa, Frankfurt, 1991, 315
12 Mörsdorf, K., Gesetz, in: LThK Band 4, Freiburg, 21960, 815-825
13 Rahner, K., Gnade, in: LThK Band 4, Freiburg, 21960, 977-1000
14 Schlögel, Herbert, Nicht moralisch, sondern theologisch. Zum Gewissensverständnis von Gerhard Ebeling (=Theologische Reihe Band 15), Mainz, 1992, 26-44
15 Scholz, F., Sünde, in: LThK Band 9, Freiburg, 21964, 1170-1183
[...]
1 Jedin, Luther, 1223
2 Heim, Augustiner-Eremiten, 66f
3 Jedin, Luther, 1223
4 Heim, Augustiner-Eremiten, 70
5 Jedin, Luther, 1223
6 Jedin, Luther, 1225
7 Chronik der Menschheit, 395
8 Chronik der Menschheit, 394
9 Jedin, Luther, 1225
10 Luther und die Reformation in: 5000 Jahre Weltgeschichte, 315
11 Chronik der Menschheit, 399
12 Jedin, Luther, 1226
13 Jedin, Luther, 1226
14 Jedin, Luther, 1226
15 Jedin, Luther, 1226
16 Chronik der Menschheit, 392
17 Chronik der Menschheit, 399
18 Jedin, Luther, 1226f
19 Chronik der Menschheit, 401
20 Jedin, Luther, 1227
21 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 326
22 Jedin, Luther, 1227
23 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 326
24 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 326
25 Jedin, Luther, 1227
26 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 326
27 Jedin, Luther, 1227f
28 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 325
29 Chronik der Menschheit, 402f
30 Friedenthal, Eine Bibel für das Volk, 325
31 Jedin, Luther, 1228
32 Chronik der Menschheit, 407
33 Chronik der Menschheit, 407
34 Jedin, Luther, 1228
35 Jedin, Luther, 1226
36 Lohse, Gewissen und Autorität, 10
37 Lohse, Gewissen und Autorität, 12
38 Lohse, Gewissen und Autorität, 13
39 Lohse, Gewissen und Autorität, 13 Wahrscheinlich lehnte er sich bei dieser Aussage an den Apostel Petrus an. So heißt es in der Bibel, APG 5,29: ,,Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen"
40 Lohse, Gewissen und Autorität, 19
41 Lohse, Gewissen und Autorität, 13
42 Lohse, Gewissen und Autorität, 13
43 Lohse, Gewissen und Autorität, 14f
44 Lohse, Gewissen und Autorität, 20
45 Lohse, Gewissen und Autorität, 13
46 Lohse, Gewissen und Autorität, 18f
47 Lohse, Gewissen und Autorität, 7
48 Brandenburg, Luthertum, 1237
49 Ebeling, Gerhard, Umgang mit Luther, Tübingen, 1983, 141f nach: Schlögel, Nicht moralisch, 36
50 Mörsdorf, Gesetz, 820
51 Brandenburg, Luthertum, 1237
52 Brandenburg, Luthertum, 1237
53 Jungmann, Evangelium, 1256 Jesus beanspruchte für sich das Amt des eschatologischen Freudenboten; siehe Mt 11,5; Lk 7,22 und Lk 4, 16-21
54 Ebeling, Gerhard, Umgang mit Luther, Tübingen, 1983, 142, nach Schlögl, Nicht moralisch, 36
55 Schlögel, Nicht moralisch, 36
56 Brandenburg, Luthertum, 1237
57 Mörsdorf, Gesetz, 821f
58 Schlögel, Nicht moralisch, 35
59 Brandenburg, Luthertum, 1236
60 Scholz, Sünde, 1174
61 Schlögel, Nicht moralisch, 30f
62 Brandenburg, Luthertum, 1237
63 Schlögel, Nicht moralisch, 43
64 Joest, Rechtfertigung, 1036
65 Jedin, Luther, 1224
66 Brandenburg, Luthertum, 1237
67 Scholz, Sünde, 1183
68 Chronik der Menschheit, 395
69 Chronik der Menschheit, 392
70 Jedin, Luther, 1224
71 vergleiche das Kapitel ,,Das veränderte Autoritätsverständnis"
72 Schlögel, Nicht moralisch , 41
73 Schlögel, Nicht moralisch , 41
74 Schlögel, Nicht moralisch , 41
75 Brandenburg, Luthertum, 1237f
76 Brandenburg, Luthertum, 1238
77 Joest, Rechtfertigung, 1046
78 Joest, Rechtfertigung, 1041
79 Joest, Rechtfertigung, 1041
80 Joest, Rechtfertigung, 1047
81 Joest, Rechtfertigung, 1047
82 siehe auch das Kapitel ,,Die Auswirkungen der Rechtfertigung"
83 Joest, Rechtfertigung, 1047 Vergleiche auch Röm 3,24
84 Joest, Rechtfertigung, 1047f Vergleiche auch Röm 3,24
85 Brandenburg, Luthertum, 1236
86 Jedin, Luther, 1224
87 Joest, Rechtfertigung, 1048
88 Jungmann, Evangelium, 1256 Siehe auch ,,Gesetz und Evangelium"
89 Joest, Rechtfertigung, 1048
90 Schlögel, Nicht moralisch, 42
91 Jedin, Luther, 1224
92 Jedin, Luther, 1224 Siehe Gal 2,16 und Röm 1,17
93 Joest, Rechtfertigung, 1048
94 siehe Einleitung zu ,,Rechtfertigung und Erlösung"
95 Schlögel, Nicht moralisch, 33
96 Schlögel, Nicht moralisch, 42
97 Brandenburg, Luthertum, 1236
98 Brandenburg, Luthertum, 1236
99 Lohse, Gewissen und Autorität, 2
100 Holl, Karl, Was verstand Luther unter Religion? in: Holl, Karl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Band 1. Luther, 71948, S. 35 nach: Lohse, Gewissen und Autorität, 1
101 Lohse, Gewissen und Autorität, 3; Auch Luther übernahm diese scholastische Unterscheidung zwischen synteresis und conscientia, grenzte sie jedoch nicht mehr voneinander ab, sondern vereinte sie zu Gewissen; siehe Lohse, Gewissen und Autorität, 4f
102 Schlögel, Nicht moralisch, 29 in der Scholastik war somit das Gewissen nicht als religiöses Phänomen begriffen.
103 Schlögel, Nicht moralisch, 30
104 Schlögel, Nicht moralisch, 29f
105 G. Ebeling, Der Lauf des Evangeliums und der Lauf der Welt. Die Confessio Augustana einst und jetzt, in: Lutherstudien. Band III. Begriffsuntersuchungen - Textinterpretationen Wirkungsgeschichtliches, Tübingen, 1985, 339-365, nach: Schlögel, Nicht moralisch, 30
106 siehe auch das Kapitel ,,Die Auswirkungen der Rechtfertigung"
107 Schlögel, Nicht moralisch, 31
108 Schlögel, Nicht moralisch, 28
109 G. Ebeling, Der Lauf des Evangeliums und der Lauf der Welt. Die Confessio Augustana einst und jetzt, in: Lutherstudien. Band III. Begriffsuntersuchungen - Textinterpretationen Wirkungsgeschichtliches, Tübingen, 1985, 112, nach: Schlögel, Nicht moralisch, 28
110 Schlögel, Nicht moralisch, 31
111 Luther, Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe (,,Weimarer Ausgabe"), Weimar, 1883ff, 7, 838, 1ff, nach Honecker, Theologische Ethik,133
112 Lohse, Gewissen und Autorität, 6
113 Lohse, Gewissen und Autorität, 6
114 Lohse, Gewissen und Autorität, 6
115 Lohse, Gewissen und Autorität, 5f
116 Schlögel, Nicht moralisch, 30
117 Schlögel, Nicht moralisch, 30 So lehrte er etwa in einer späten Galaterbriefvorlesung 1531: ,, Unsere Theologie ist darum gewiß, weil sie uns außerhalb unserer selbst stellt: ich darf mich nicht auf mein Gewissen , mein persönliches Gefühl, mein Werk stützen, sondern auf die göttliche Verheißung und Wahrheit, welche nicht trügen kann". (Luther, Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe (,,Weimarer Ausgabe"), Weimar, 1883ff, 40, I, 589, 8-10, nach Lohse, Gewissen und Autorität,7)
118 Somit kann man bei Luther von keiner wirklichen Gewissensfreiheit sprechen. Seiner Auffassung nach, führt ,, die Bindung der Gewissen an das Wort zu voller Einmütigkeit". (Lohse, Gewissen und Autorität, 21f)
119 G. Ebeling, Der Lauf des Evangeliums und der Lauf der Welt. Die Confessio Augustana einst und jetzt, in: Lutherstudien. Band III. Begriffsuntersuchungen - Textinterpretationen Wirkungsgeschichtliches, Tübingen, 1985, 117, nach: Schlögel, Nicht moralisch, 33
120 Schlögel, Nicht moralisch, 31
121 Schlögel, Nicht moralisch, 33
122 Honecker, Theologische Ethik, 134
123 Luther, Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe (,,Weimarer Ausgabe"), Weimar, 1883ff, 8, 609, 40f, nach Lohse, Gewissen und Autorität, 9f
124 Lohse, Gewissen und Autorität, 9f
125 Lohse, Gewissen und Autorität, 13
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des vorliegenden Dokuments über Martin Luther?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Einführung in das Leben und die Lehre Martin Luthers. Es beginnt mit einer detaillierten Biographie, die Luthers frühe Jahre, den Ablassstreit, seine Bibelübersetzung und seine späten Lebensjahre abdeckt. Der zweite Hauptteil widmet sich Luthers Lehre, insbesondere dem Verständnis von Gewissen, Gesetz und Evangelium, Sünde, Glauben, Rechtfertigung und Erlösung. Es enthält auch ein Nachwort und ein Literaturverzeichnis.
Welche wichtigen Ereignisse im Leben Martin Luthers werden behandelt?
Das Dokument behandelt unter anderem Luthers Geburt und Erziehung, seinen Eintritt ins Augustinerkloster, den Ablassstreit und die Veröffentlichung seiner 95 Thesen, die Leipziger Disputation, seine Verurteilung durch die Bulle `Exsurge Domine', seinen Auftritt vor dem Wormser Reichstag, die Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche und seinen Tod.
Was sind die zentralen Elemente von Luthers Lehre?
Zu den Kernpunkten von Luthers Lehre gehören das veränderte Autoritätsverständnis (das Wort Gottes als höchste Autorität), die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, das veränderte Sündenverständnis (Sünde als grundlegende Verfassung des Menschen), der Glaubensbegriff, die Lehre von Rechtfertigung und Erlösung (allein durch Gnade, Christus und Glauben) und das Gewissensphänomen (das im Wort Gottes gefangene Gewissen).
Wie unterscheidet sich Luthers Sündenverständnis von dem der Scholastik?
Luther distanzierte sich von der scholastischen Vorstellung, Sünde sei an bestimmte Taten gebunden. Er lehrte, dass Sünde die gesamte Person betrifft und eine Abkehr von Gott darstellt. Vergebung kann daher nur global durch einen Gnadenakt Gottes erfolgen.
Was bedeutet Luthers Lehre von der Rechtfertigung?
Die Lehre von der Rechtfertigung besagt, dass der Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus und die Gnade Gottes von seiner Schuld befreit wird. Gute Werke sind demnach nicht die Grundlage der Rechtfertigung, sondern vielmehr deren Folge.
Wie versteht Luther das Gewissen?
Luther sieht das Gewissen nicht nur als moralisches Urteilsvermögen, sondern als einen Ort, an dem der Mensch Gott erfährt. Er unterscheidet zwischen dem "angefochtenen Gewissen" (das sich auf Werke stützt) und dem "guten Gewissen" (das aus der Rechtfertigung durch Gottes Gnade entspringt). Das Gewissen ist dem Wort Gottes "verhaftet" und ermöglicht so die Unterscheidung zwischen Verurteilung und Freispruch.
Was bedeutet die "Freiheit des Gewissens" bei Luther?
Luther meint damit nicht die Autonomie des Menschen, sondern die Befreiung des Gewissens aus der Anklage und der Angst vor dem Zorn Gottes. Es ist die Rettung zu dem guten Gewissen, das allein der Glaube selbst ist. Das Gewissen ist "gefangen in Gottes Wort".
Welche Quellen und Literatur werden in diesem Dokument verwendet?
Das Dokument stützt sich auf eine Vielzahl von gedruckten Quellen und Literatur, darunter Werke von Martin Luther selbst, theologische Lexika und Sekundärliteratur zur Reformation und zur Theologie Luthers.
Wo finde ich das Literaturverzeichnis?
Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende des Dokumentes, unmittelbar nach dem "Nachwort".
Was sind die Hauptkritikpunkte, die im "Nachwort" angesprochen werden?
Das "Nachwort" kritisiert, dass Luther nicht erklären kann, wie unterschiedliche Individuen zu unterschiedlichen Gewissensurteilen kommen und dass er die tatsächliche Erfahrung der "Tatsünde" nicht berücksichtigt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 1997, Das Gewissen - Oberste Norm oder subjektive Willkür? Modelle christlicher Gewissensdeutung - Martin Luther: Das in Christus befreite Gewissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96028