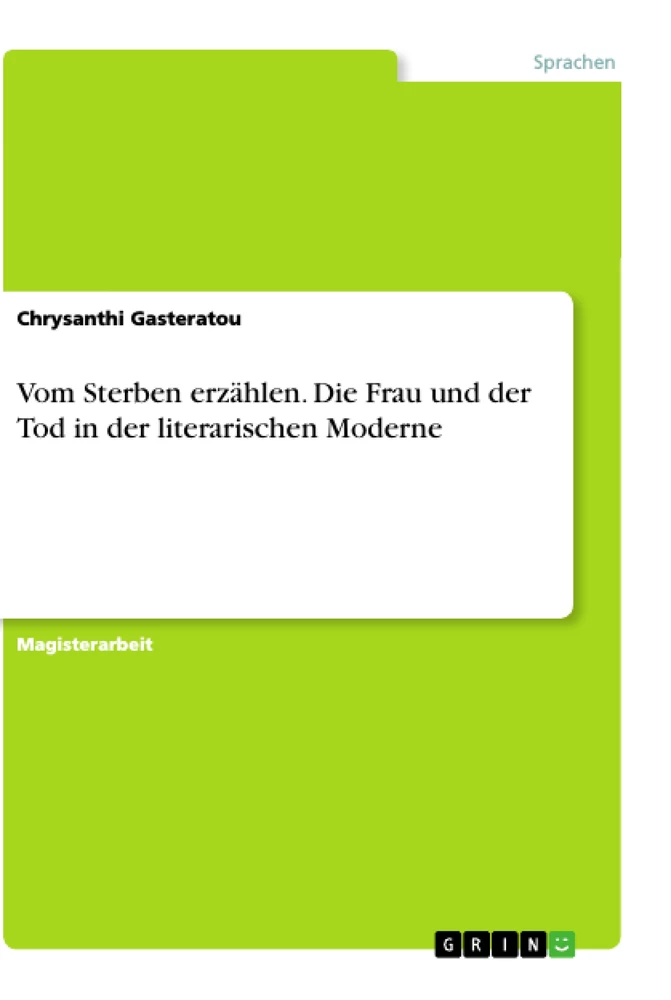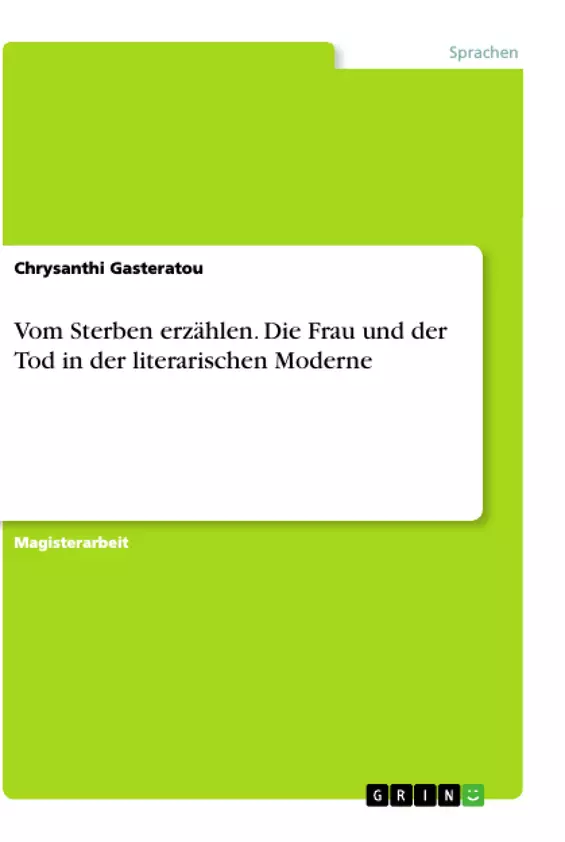Gegenstand der Arbeit ist die unauflösliche Verknüpfung des Todes mit der Weiblichkeit in der Literatur des 19. Jahrhunderts, betrachtet hauptsächlich aus der ästhetischen Perspektive. Der Autor beschäftigt sich mit dem Thema der Darstellung des weiblichen Todes und hauptsächlich der Funktion eines schönen toten Körpers in der fiktiven und deshalb auch in der realen kulturellen Gemeinschaft in literarischen Werken. Die Thematik wurde angeregt durch die Frage, wie und warum eine große künstlerische Textproduktion aus der Motivik des weiblichen Sterbens und dessen Andenken als Bild so erfolgreich schöpfen kann. Wie es aus der literarischen Geschichte festzustellen ist, wirkt die Erzählung vom Tode einer schönen Frau sehr effektiv im Lesepublikum, besonders wenn es von der Hand des trauenden überlebenden Liebhabers verfasst wurde.
Edgar Allan Poe schloss den Charme dieser schauerlichen Thematik in der Formulierung ein: „the death, then, of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world — and equally is it beyond doubt that the lips best suited for such topic are those of a bereaved lover." Das Resultat, das aus diesem männlichen Gedankengang folgt, bezieht sich vor allem auf die – fast alle Kulturen betreffende – bedrohliche Wirkung des Todes und der Tabuisierung des sich zersetzenden Körpers, wobei der tote Körper paradoxerweise nicht nur mit Schreck, sondern auch mit faszinierender Schönheit verbunden wird. Denn in den hier untersuchten Beispielen – Gustave Flauberts „Madame Bovary“ und Heinrich Heines „Florentinische Nächte“ – wird die Verstorbene sogar zum imaginierten Begehrensobjekt des lebenden Liebhabers. Die Schilderung des romantischen Todes Emma Bovarys und der erotisierten weiblichen Leichen im Leben von Heines Held, Maximilian, beweist dennoch die Voraussetzung eines immer überlebenden Zuschauers, sei es der Schriftsteller, der Leser oder die fiktiven Handlungsfiguren. Daher wird das Sterben als ein Prozess der Ansicht eines erschaffenen, zur Schau gestellten Objekts manifestiert, wodurch der weibliche Körper als ästhetischer Gegenstand wahrgenommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung...
- 1. Der Tod und der weibliche Leichnam
- 1. 2. Das Bild und die Verdoppelung des Leichnams ..
- 1. 3. Die Todeseinstellung im 19. Jahrhundert
- 1. 4. Die Verwissenschaftlichung des Leichnams..
- 1. 6. Die Ästhetisierung des weiblichen Leichnams
- 1. 7. Die Fetischisierung des weiblichen Leichnams.
- 1. 8. Zusammenfassung...
- 2. Madame Bovary.
- 2. 1. Inhalt
- 2. 2. Die doppelte Präsenz des Todes..
- 2. 2. 1. Die Auffassung des imaginären Todes
- 2. 2. 2. Die Auffassung des realen Todes..
- 2. 3. Zusammenfassung...
- 3. Florentinische Nächte
- 3. 1. Inhalt
- 3. 2. Die sprachliche Auffassung des Todes in den „Florentinischen Nächten“.
- 3.2.1. Der Tod und der Leichnam in der Binnenerzählung..
- 3. 2. 2. Der Tod und der Leichnam in der Rahmenhandlung....
- 3. 3. Zusammenfassung...
- 4. Vergleich und Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die unauflösliche Verbindung zwischen Tod und Weiblichkeit in der Literatur des 19. Jahrhunderts, mit besonderem Fokus auf die ästhetische Perspektive. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung des weiblichen Todes, insbesondere der Funktion eines schönen toten Körpers, in der fiktiven und somit auch in der realen kulturellen Gemeinschaft. Sie fragt, wie und warum eine große künstlerische Textproduktion so erfolgreich aus der Motivik des weiblichen Sterbens und dessen Andenken als Bild schöpfen kann.
- Die Darstellung des weiblichen Todes als ästhetisches Objekt
- Die Bedeutung des weiblichen Todes als textuelles Zeichen
- Die Wichtigkeit des körperlichen Todes der Hauptfigur in Bezug auf sich selbst und die Gemeinschaft
- Die Inszenierung des Todes als aktive Handlung oder passive Erwartung
- Die Erotisierung des Todes und der weiblichen Leiche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem komplexen Motiv des Leichnams, indem es die beiden zentralen Aspekte der Funktion des toten Körpers analysiert: seine Rolle als untersuchtes Element des medizinischen Wissenstriebs und als Objekt fetischisierter Schaulust. Es untersucht den Einfluss des leblosen Körpers auf den Lebenden und umgekehrt. Die Studien von Philippe Ariès und Michel Foucault über die wachsende Bedeutung der Todeseinstellung und die Leichnamspositionierung in der Weltanschauung des 19. Jahrhunderts werden herangezogen, um die Entwicklung der Leiche vom Objekt wissenschaftlichen Interesses zum ästhetischen Objekt zu beleuchten.
Das zweite Kapitel analysiert Gustave Flauberts „Madame Bovary“, indem es die doppelte Präsenz des Todes im Roman untersucht. Der imaginäre Tod als Wunsch und der reale Tod als tragische Tatsache werden in Bezug auf Emmas Lebensweg und die Darstellung des weiblichen Körpers beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert Heinrich Heines „Florentinische Nächte“ und untersucht die sprachliche Auffassung des Todes in den „Florentinischen Nächten“. Der Tod und der Leichnam in der Binnenerzählung und in der Rahmenhandlung werden in Bezug auf die erotische Vorstellung des Todes und die Bedeutung der weiblichen Leiche als Zeichen untersucht.
Schlüsselwörter
Weiblicher Tod, Leichnam, Ästhetisierung, Fetischisierung, Repräsentation, Zeichen, Literatur des 19. Jahrhunderts, Madame Bovary, Florentinische Nächte, Gustave Flaubert, Heinrich Heine, Maurice Blanchot, Philippe Ariès, Michel Foucault.
- Quote paper
- Chrysanthi Gasteratou (Author), 2009, Vom Sterben erzählen. Die Frau und der Tod in der literarischen Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962570