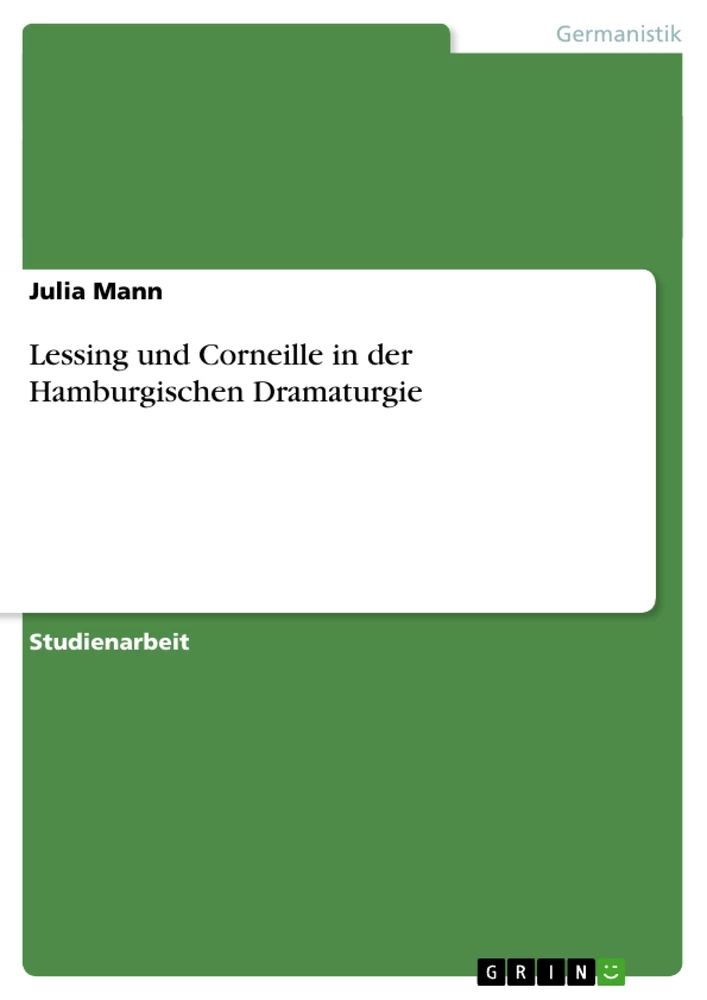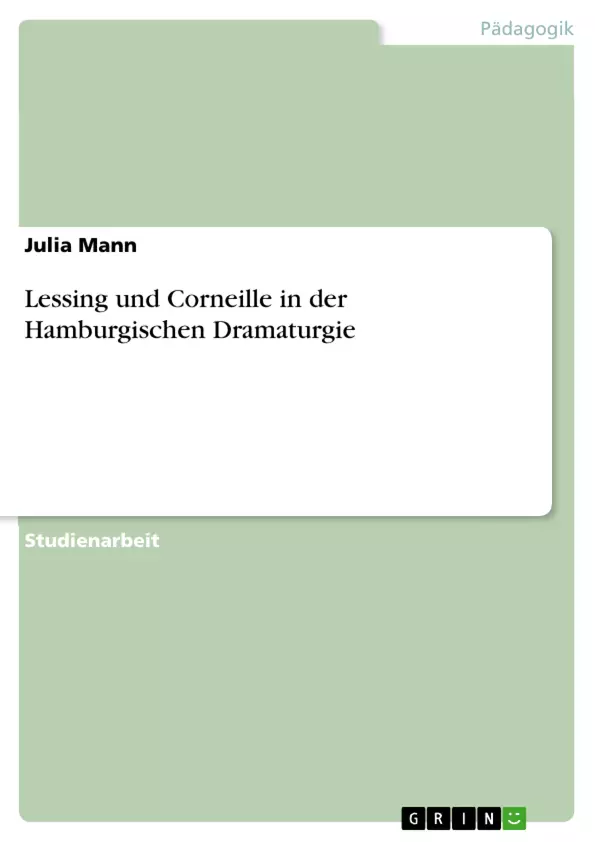Der Theologe, Schriftsteller und Theatertheoretiker Lessing wurde von seinen Zeitgenossen nicht selten als "Frankzosenhasser" benannt. Insbesondere gegen Corneille, Racine und Voltaire ging seine ausgiebige Kritik, die nicht zuletzt von seinem Bestreben das deutsche Theater zu kräftigen beeinflusst wurde. Seine theoretischen Abhandlung "Hamburgische Dramaturgie", die er während seiner Zeit am Hamburger Nationaltheater verfasste, benutzte er, um dieser Kritik eine geeignete Plattform zu geben. In dieser Arbeit soll einmal etwas näher beleuchtet werden, mit welchen Mitteln er dies vollzog. Insbesondere die Aristotelische Poetik bekommt hierbei eine besondere Bedeutung zugewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Tragödie bei Aristoteles
- Die Tragödie bei Corneille
- Corneille und der französische Klassizismus
- Die Theorie der Tragödie nach Corneille
- Die Tragödie bei Lessing
- Die Theatersituation im 18. Jh.
- Lessings Auseinandersetzung mit Corneille
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit Lessings Kritik an der Dramentheorie des französischen Dichters Pierre Corneille, wobei die „Hamburgische Dramaturgie“ als Textgrundlage dient. Die Arbeit zielt darauf ab, Corneilles Tragödientheorie verständlich zu erklären und Lessings Kritik daran zu analysieren. Hierzu werden die wichtigsten Elemente der Tragödientheorie des Aristoteles beleuchtet, da diese sowohl für Corneilles als auch für Lessings dramatische Lehren von Bedeutung sind.
- Die Tragödientheorie des Aristoteles
- Die Tragödientheorie des Pierre Corneille
- Lessings Kritik an Corneille
- Die Rolle der Katharsis in der Tragödie
- Die Bedeutung der drei Einheiten in der Dramenstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentralen Fragestellungen sowie die methodische Vorgehensweise dar. Der Fokus liegt auf Lessings Kritik an Corneilles Dramentheorie, wobei die "Hamburgische Dramaturgie" als primäre Quelle dient. Die Arbeit strebt eine verständliche Darstellung der Tragödientheorie Corneilles an, wobei die wichtigsten Elemente der aristotelischen "Poetik" beleuchtet werden, um die theoretischen Grundlagen der beiden Autoren zu verstehen.
Die Tragödie bei Aristoteles
Dieses Kapitel analysiert die Tragödientheorie des Aristoteles, die hauptsächlich in seinem Werk "Poetik" festgehalten ist. Es werden die wichtigsten Aspekte der Theorie erläutert, darunter die Nachahmung (Mimesis), die Katharsis und die Rolle von Furcht und Mitleid. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung der "Poetik" als Grundlage für die dramatischen Lehren sowohl von Corneille als auch von Lessing.
Die Tragödie bei Corneille
Dieses Kapitel befasst sich mit Corneilles Dramentheorie und seiner Rolle im französischen Klassizismus. Es werden die wichtigsten Punkte von Corneilles Theorie beleuchtet, die später von Lessing kritisiert werden, wie die drei Einheiten, der mittlere Charakter und die Rolle von Furcht und Mitleid in der Katharsis.
Die Tragödie bei Lessing
Dieses Kapitel analysiert Lessings Auseinandersetzung mit der Dramentheorie von Corneille, insbesondere im Kontext der "Hamburgischen Dramaturgie". Es beleuchtet Lessings Kritik an den französischen Klassizismus und die Rolle der Theatersituation im 18. Jahrhundert. Das Kapitel untersucht auch die Frage, ob Lessing Aristoteles korrekt interpretiert hat.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Tragödie, Dramentheorie, Aristoteles, Poetik, Corneille, französischer Klassizismus, Lessing, Hamburgische Dramaturgie, Katharsis, Furcht, Mitleid, drei Einheiten, mittlerer Charakter, Kritik, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Warum kritisierte Lessing den französischen Dramatiker Corneille?
Lessing wollte das deutsche Theater reformieren und warf Corneille vor, die aristotelische Poetik falsch interpretiert und durch starre Regeln (wie die drei Einheiten) die emotionale Wirkung der Tragödie geschwächt zu haben.
Was bedeutet „Katharsis“ bei Aristoteles und Lessing?
Katharsis bezeichnet die Reinigung der Affekte durch Furcht und Mitleid. Während Corneille dies eher formal sah, betonte Lessing die moralische Besserung des Zuschauers durch echtes Mitgefühl.
Welche Rolle spielen die „drei Einheiten“ im französischen Klassizismus?
Es handelt sich um die Einheiten von Ort, Zeit und Handlung. Corneille hielt streng an ihnen fest, während Lessing argumentierte, dass sie zweitrangig gegenüber der inneren Wahrscheinlichkeit der Handlung seien.
Was ist die „Hamburgische Dramaturgie“?
Es ist eine Sammlung von Theaterkritiken und theoretischen Abhandlungen Lessings, die er während seiner Zeit am Hamburger Nationaltheater verfasste, um seine Theatertheorie zu verbreiten.
Was versteht Lessing unter einem „mittleren Charakter“?
Ein mittlerer Charakter ist ein tragischer Held, der weder vollkommen gut noch völlig böse ist. Nur mit einem solchen Charakter kann der Zuschauer Mitleid empfinden, da er sich in ihm wiederkennt.
- Quote paper
- MA Julia Mann (Author), 2000, Lessing und Corneille in der Hamburgischen Dramaturgie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9781