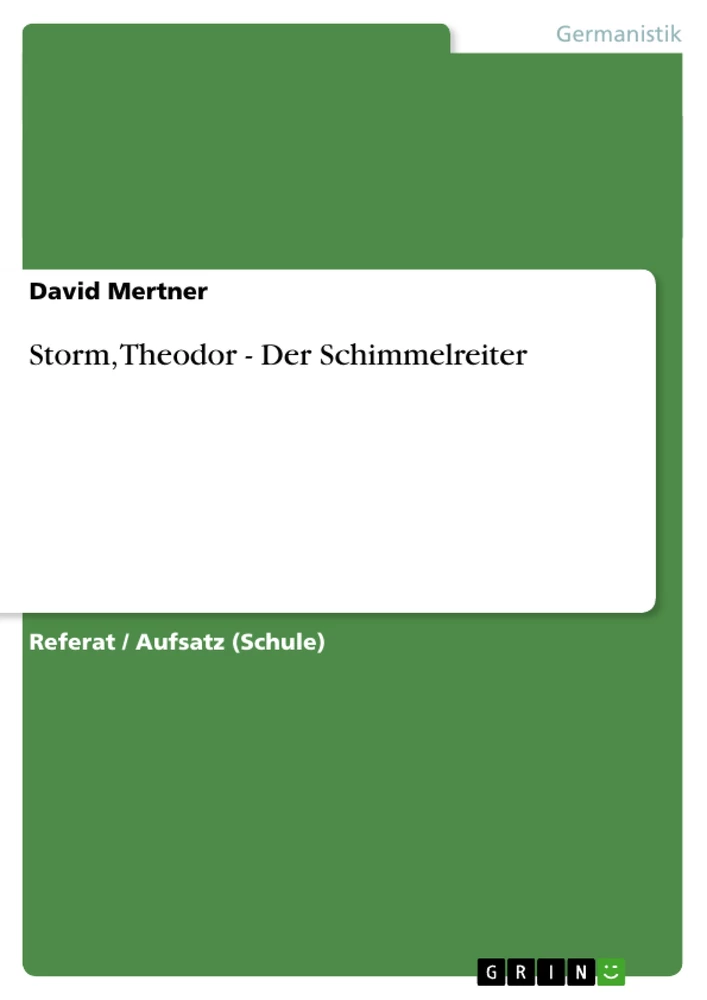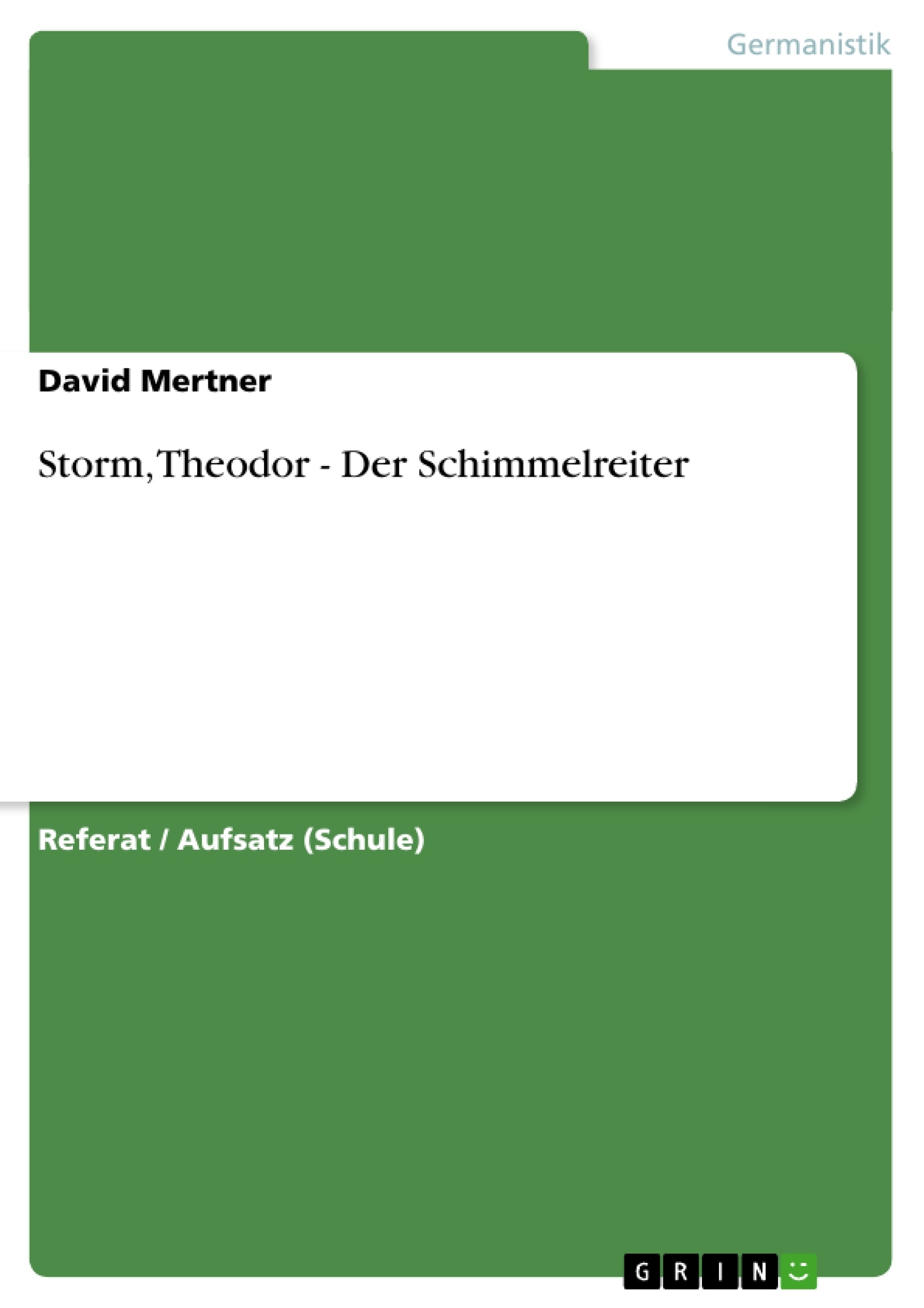Zum Autor:
am 14.9.1817 in Husum geboren, Vater: Johann Casimir Storm (Rechtsanwalt), Mutter: Lucie Woldsen
1826-35 Husumer Gelehrtenschule
1835-37 Besuch eines Gymnasiums in Lübeck 1837-42 Jura-Studium in Kiel und Berlin
1843 Veröffentlichung des ersten Werkes: "Liederbuch dreier Freunde" (Brüder Mommsen)
1843 Rechtsanwalt in Husum
1846 Heirat mit seiner Kusine Constanze Esmarch (1825-1865) am 15. September 1852 Verliert sein Amt und flieht nach Potsdam (Dänische Besatzungszeit) 1864 Rückkehr nach Husum, wird Landvogt, später Amtsrichter 1865 Seine Frau Constanze stirbt am 20. Mai im Alter von 40 Jahren 1866 Heirat mit seiner ehemaligen Geliebten Doris Jensen (1828-1903) am 13. Juni 1880 Bezug der 'Altersvilla' in Hademarschen
1886 Tod des ältesten Sohnes Hans (1848 geboren)
am 4.7.1888 an Magenkrebs in Hademarschen / Holstein gestorben, drei Tage später ohne Beisein eines Priesters beigesetzt
Einige Werke: (insgesamt 58 Novellen)
1849 Immensee (erste reine Novelle mit Erfolg zu Lebzeiten), 1849 Der kleine Häwelmann (Märchen)
1873 Viola tricolor, 1873/74 Pole Poppenspäler, 1875 Psyche, 1877 Carsten Curator
1888 Der Schimmelreiter (Erstveröffentlichung: April 1888 Berlin, Storms letztes Werk vor seinem Tod, Zwei deutsche Verfilmungen: 1933 und 1978)
Inhaltsangabe:
Ein Mann reitet bei schlechtem Wetter an einem Deich entlang, als er einen Reiter trifft, der völlig lautlos auf einem Schimmel an ihm vorbeigaloppiert. Etwas später kommt er in einer Ortschaft an und betritt die Stube des Gasthauses. Dort ist gerade eine Versammlung der Deichgevollmächtigten im Gange. Als der Neuankömmling jedoch von seinem Erlebnis erzählt, verstummt alles, denn der Reiter auf dem Schimmel taucht nur auf, wenn der Deich bricht. Dann beginnt der anwesende Schulmeister die Geschichte des Schimmelreiters zu erzählen:
Einst lebte ein junger Kerl, sein Name war Hauke Haien, bei seinem Vater Tede Haien in einer kleinen Hütte am Deich. Er beschäftigte sich in seiner Jugend vor allem mit mathematischen Berechnungen aller Art. Später, als er erwachsen wird, ist Hauke am Hof des Deichgrafen Volkerts als Kleinknecht beschäftigt. Dort hat er jedoch einige Differenzen mit dem Großknecht Ole Peters. Als dieser schließlich kündigt, steigt er zum Großknecht auf. Nach dem Tod seines Vaters Tede erbt er dessen Grundbesitz, doch das ist für einen potentiellen Deichgraf einfach zu wenig. Darum strebt er die Freundschaft mit Elke, der Tochter des alten Deichgrafen, an. Als dieser dann stirbt, erklärt sich Elke bereit, Hauke zu heiraten. So wird er der neue Deichgraf. Da der alte Deich seiner Meinung nach nicht stabil genug ist beschließt er diverse Reperaturmaßnahmen und später den Bau eines neuen Deiches - gegen den Willen der Bevölkerung.
Seit geraumer Zeit sieht man auf einer kleinen Hallig in der Nacht einen Schimmel, am Tag jedoch sind nur noch dessen Gebeine vorhanden. Kurze Zeit später bringt Hauke einen abgemagerten Schimmel mit nach Hause, der sich nur von ihm reiten läßt. Das Knochengerüst auf der Hallig ist daraufhin plötzlich verschwunden und die Leute in der Umgebung vermuten eine Verbindung zum Schimmel des Deichgrafen.
Der Bau des neuen Deiches gestaltet sich als etwas kostspieliger als geplant und schafft ihm so noch ein paar Feinde im Dorf. Hauke kann sich jedoch durchsetzen und der Bau geht weiter.
Seine Frau Elke bekommt ein Kind, das sie Wienke nennen. Nach der Geburt erkrankt Elke an Kindbettfieber, darum spricht Hauke ein Gebet, in dem er die Allmacht Gottes etwas anzweifelt. Dieses Gebet wird belauscht, im ganzen Dorf verbreitet und als Fluch ausgelegt.
Elke überlebt zwar die Krankheit, doch dann stellt sich heraus, daß Wienke geistig etwas zurück geblieben ist. Währenddessen gehen die Bauarbeiten am Deich weiter. Eines Tages bemerkt Hauke, wie Arbeiter einen Hund in den Deich einschaufeln wollen. Er unterbindet diese Aktion und nimmt den Hund als Spielgefährten für seine Tochter mit nach Hause. Nach einiger Zeit ist der neue Deich fertig. Von da an lebt die Familie von Hauke etwas ruhiger und nimmt die gealterte Dienstmagd Trin Jans zu sich auf. Die kleine Wienke hat von nun an zwei Spielkameraden, nämlich den Hund Perle, den ihr Vater beim Deichbau gerettet hat, und die Möwe Klaus, die Trin Jans gehört. Als Trin Jans später stirbt, kümmert sich das Kind um die Möwe.
Eines Tages zieht ein Sturm über das Land und Hauke reitet auf dem Schimmel zum Deich. Versehentlich kommt die Möwe Klaus unter die Hufe. Dann entdeckt er, dass Arbeiter seinen neuen Deich durchstechen wollen, um den alten zu retten. Er verbietet ihnen dies zu tun. Ein Stück weiter bricht der alte Deich. Seine Frau Elke und Wienke, die aus Sorge um ihn mit einer Kutsche in der Nähe sind, werden von der Flut erfasst. Daraufhin stürzt sich Hauke mit dem Schimmel in die Fluten.
Hier endet die Geschichte des Schulmeisters. Kurz bevor sich der Fremde auf sein Zimmer begeben will, trifft er den Deichgrafen, der ihm mitteilt, dass der Deich gebrochen ist.
Herkunft der Handlung:
Am Anfang der Novelle werden als Quelle die "Hamburger" oder "Leipziger Lesefrüchte" (zwei beliebte Zeitschriften der damaligen Zeit) angegeben. Eine andere Quelle besagt, dass Storm die Sage vom "gespenstischen Schimmelreiter" in seiner Kindheit von Lena Wies, einer guten Bekannten der Familie, erzählt bekommen hat.
Kennzeichen einer Novelle:
- Wahrheits- /Repräsentantzanspruch: siehe Herkunft
- Rahmenerzählung: Ich-Erzähler (Theodor Storm) - Ich-Erzähler (Der Reiter) - Er-Erzähler (Der Schulmeister) Ich-Erzähler (Der Reiter)
- Dingsymbole: Schimmel, Kater, Hund
- Wendepunkt: Deichbruch
- dramatische Steigerung: Tod von Trin Jans - Tod der Möwe - Deichbruch - der Verlust von Frau und Kind Tod Haukes
- kurze Sätze, knappe Dialoge (oft nur mit Gesten)
Interpretation:
In diesem Werk wird besonders gut auf den Aberglauben der Menschheit eingegangen. Der Aberglaube dichtet der Gestalt des Deichgrafen die Aura des Unheimlichen an und bringt sein Lebenswerk in Verbindung mit Teufelsspuk und Gespensterseherei. Der Haß schlägt Hauke offen entgegen, als er mit Gewalt den Aberglauben unterdrückt, dass "etwas Lebendiges" in den neuen Deich eingegraben werden müsse, damit er Bestand habe. Wegen seiner technisch- rationalen Weltsicht steht Hauke im Konflikt mit der Bevölkerung, die den Hang zum Mystischen und Unheimlichen hat. Trotzdem wird auch er in diese nebelhafte Sphäre mit hineingezogen. Von wem hat er den Schimmel gekauft?
"Er hat eine Hand ... wie eine Klaue" und lacht hinter ihm her "wie der Teufel". Das erzählt Hauke selbst.
Die Bevölkerung verbindet daraufhin den seltsamen Schimmelkauf des Deichgrafen mit dem geheimnisvollen Schimmelspuk auf Jeverssand.
Durch die gestaffelte Form der Erzähler macht der Autor weiter darauf aufmerksam, wie einfach man Legenden mit wahren Geschichten vermischen kann, und wie schwer es dann dem Leser fällt, das Wahre vom Erfundenen zu trennen. So vertritt zum Beispiel der erste Erzähler (also Storm selbst) die Auffassung, man könne zwischen Realität und Mystik nicht mehr klar differenzieren, da die Übergänge fließend seien, die beiden anderen Erzähler (Der Reiter und der Schulmeister) hingegen erleben die Existenz des Schimmelreiters als unmittelbare Wirklichkeit.
Außerdem lassen sich auch gesellschaftliche Konflikte erkennen, wie z.B. die Reibereien zwischen Hauke und Ole Peters. Dieser bemerkt, dass Hauke ihm intellektuell überlegen ist und ihm unter Umständen seine Position als Großknecht streitig machen könnte. Darum versucht er auch, Haukes Teilnahme beim "Eisboseln" zu verhindern.
Aber dank Ole Hensen gelingt ihm das nicht. Später, als Hauke Deichgraf ist, muss er sich vor allem mit der Bevölkerung auseinandersetzen und er vereinsamt im Laufe der Zeit zusehends. Hauke scheitert letztendlich jedoch nicht am Widerstand der Menschen oder der Natur, sondern am Tod von Frau und Kind. Nach seinem Tod läßt die Sage den gespenstischen Schimmelreiter immer dann erscheinen, wenn Unwetter die Deiche bedroht.
Primärliteratur : Theodor Storm: Der Schimmelreiter, Ernst Klett Verlag, 1. Auflage, Stuttgart 1996
Häufig gestellte Fragen zu Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
Wer war Theodor Storm?
Theodor Storm wurde am 14.9.1817 in Husum geboren und starb am 4.7.1888 in Hademarschen. Er war ein deutscher Schriftsteller, bekannt für seine Novellen, darunter "Der Schimmelreiter". Er arbeitete als Rechtsanwalt und später als Richter.
Was ist der Inhalt von "Der Schimmelreiter"?
Die Novelle erzählt die Geschichte von Hauke Haien, einem Mann, der als Deichgraf versucht, einen neuen, stabileren Deich zu bauen. Sein rationales Vorgehen und seine Ablehnung des Aberglaubens führen zu Konflikten mit der Bevölkerung. Die Geschichte wird als Rahmenerzählung präsentiert, eingebettet in verschiedene Erzählebenen.
Was sind die Hauptthemen in "Der Schimmelreiter"?
Zentrale Themen sind Aberglaube versus Rationalität, der Konflikt zwischen Mensch und Natur, gesellschaftliche Isolation und der Preis des Fortschritts. Die Novelle thematisiert auch die Schwierigkeit, Wahrheit von Legende zu trennen.
Was sind die Kennzeichen einer Novelle, die in "Der Schimmelreiter" zu finden sind?
Die Novelle weist typische Merkmale auf, wie den Wahrheitsanspruch, eine Rahmenerzählung, Dingsymbole (z.B. der Schimmel), einen Wendepunkt (der Deichbruch), dramatische Steigerung und eine knappe Sprache mit kurzen Sätzen und Dialogen.
Was ist die Bedeutung des Schimmels in der Geschichte?
Der Schimmel ist ein Dingsymbol, das sowohl für Haukes Ehrgeiz und Rationalität als auch für den Aberglauben und die mystische Verbindung zur Natur steht. Die Bevölkerung verbindet ihn mit dem gespenstischen Schimmelreiter, der bei drohenden Deichbrüchen erscheint.
Wie wird die Geschichte erzählt?
Die Geschichte wird durch verschiedene Erzähler vermittelt: einen Ich-Erzähler (Theodor Storm selbst), einen Reiter, der die Rahmengeschichte einleitet, und einen Schulmeister, der die Haupthandlung erzählt. Diese gestaffelte Erzählweise verdeutlicht, wie Legenden und Wahrheit miteinander verschmelzen können.
Was ist die Interpretation von Hauke Haiens Charakter?
Hauke Haien ist ein ambivalenter Charakter. Einerseits ist er ein fortschrittlicher Denker, der sich für den Bau eines besseren Deiches einsetzt. Andererseits wird er als arrogant und unnachgiebig dargestellt, was zu Konflikten mit der Bevölkerung führt. Sein tragisches Schicksal zeigt die Grenzen der menschlichen Vernunft auf.
Welche Rolle spielt der Aberglaube in der Novelle?
Der Aberglaube ist ein zentrales Motiv. Die Bevölkerung glaubt an Geister und übernatürliche Kräfte, was zu Misstrauen und Ablehnung gegenüber Hauke führt. Sein Versuch, den Aberglauben zu unterdrücken, scheitert letztendlich.
Was passiert am Ende der Geschichte?
Ein Sturm verursacht einen Deichbruch. Haukes Frau und Kind sterben in den Fluten. Hauke stürzt sich mit seinem Schimmel in die Fluten und stirbt ebenfalls. Nach seinem Tod erscheint die Sage vom gespenstischen Schimmelreiter immer dann, wenn Unwetter die Deiche bedrohen.
Welche Quellen verwendete Theodor Storm für "Der Schimmelreiter"?
Als Quellen werden die "Hamburger" oder "Leipziger Lesefrüchte" genannt. Eine andere Quelle besagt, dass Storm die Sage vom "gespenstischen Schimmelreiter" in seiner Kindheit von Lena Wies erzählt bekommen hat.
- Quote paper
- David Mertner (Author), 2000, Storm, Theodor - Der Schimmelreiter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98463