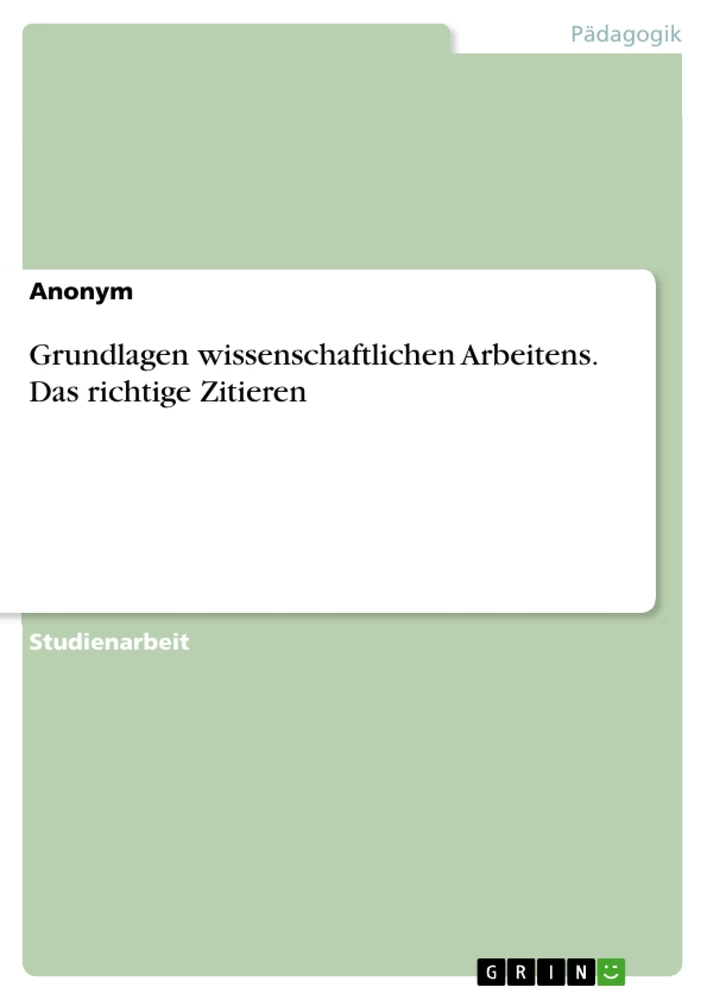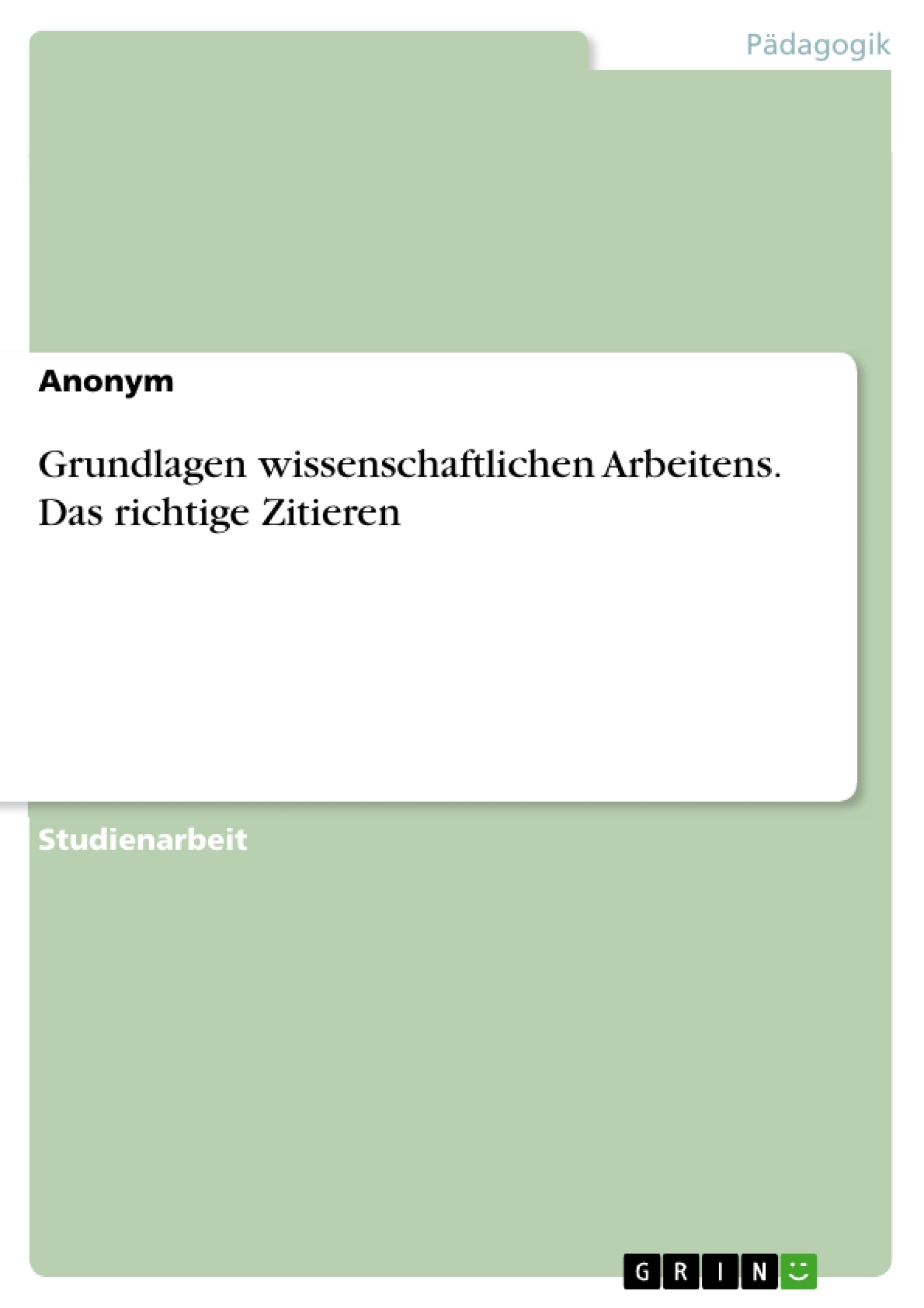Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen des korrekten Zitierens und dem Umgang mit Satzungeheurern und gibt einen Einblick in die Vorgehensweisen des wissenschaftlichen Arbeitens.
Bei der Verfassung von wissenschaftlichen Texten ist es notwendig, bestimmte wissenschaftliche Kriterien einzuhalten sowie über die erforderlichen Kompetenzen zu verfügen. Durch die Einhaltung dieser Kriterien ist es den Lesern besagter Texte möglich, den Inhalt leichter zu interpretieren und zu überprüfen. Die Nichteinhaltung dieser Standards können von Missverständnissen zwischen Autor und Leser, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen reichen. Strafrechtlich relevant kann das Verfassen eines Plagiats sein. Ebenjene notwendigen Standards für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten lernten wir im vergangenen Sommersemester kennen.
Dazu zählt unteranderem die Fähigkeit des korrekten Zitierens, auf welche im Laufe dieser Arbeit eingegangen wird. Zitate sind in wissenschaftlichen Arbeiten nahezu unumgänglich, denn durch sie können Textpassagen auf inhaltliche Richtigkeit sowie auf Plagiate überprüft werden. Zudem wurde der der richtige Umgang mit Satzungeheuern vermittelt. In diesem Portfolio soll dargestellt werden, wie sich die erlernten Fähigkeiten praktisch umsetzten lassen. Dies wird anhand eines Lehrbuchtextes zum Thema des korrekten Zitierens, der Aufarbeitung von Satzungeheuern und eines Exzerpts dargestellt. Abschließend stehen in dieser Arbeit die Lerntagebucheinträge sowie ein Resümee, welche über den Lernprozess Aufschluss geben sollen. Für diese Arbeit wurde die deutsche Zitierweise verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Portfolioarbeit
- Lehrbuchtext
- Satzungeheuer
- Exzerpt
- Lerntagebuch
- Relevanz des Erlernten für den beruflichen Alltag
- Resümee
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Portfolioarbeit hat das Ziel, die im Sommersemester erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen in der Praxis anzuwenden. Dazu werden die erlernten Fähigkeiten anhand eines Lehrbuchtextes zum Thema Zitieren, der Bearbeitung von Satzungeheuern und eines Exzerpts veranschaulicht.
- Korrekte Zitierweise
- Umgang mit Satzungeheuern
- Erstellen eines Exzerpts
- Relevanz wissenschaftlicher Kompetenzen für den beruflichen Alltag
- Vermeidung von Plagiaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text erläutert die Bedeutung wissenschaftlicher Kriterien und Kompetenzen für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. Er betont die Wichtigkeit korrekter Zitierweise, die Vermeidung von Plagiaten und den Umgang mit Satzungeheuern.
Portfolioarbeit
Lehrbuchtext
Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen Zitierformen, sowohl mit direkten als auch indirekten Zitaten. Er erklärt die korrekte Kennzeichnung von Zitaten, inklusive der Verwendung von Anführungszeichen, Klammern und Fußnoten. Zudem wird die Harvard-Zitierweise im Vergleich zur deutschen Zitierweise vorgestellt.
Satzungeheuer
Dieser Abschnitt behandelt die Erkennung und Korrektur von fehlerhaften Satzstrukturen, sogenannten "Satzungeheuern", und zeigt auf, wie man diese in wissenschaftlichen Texten vermeiden kann.
Exzerpt
Dieser Abschnitt beschreibt die Erstellung eines Exzerpts als eine Methode zur Zusammenfassung und Analyse von wissenschaftlichen Texten. Er erläutert die verschiedenen Arten von Exzerpten und gibt Tipps für die effiziente Bearbeitung von Texten.
Lerntagebuch
Dieser Abschnitt beinhaltet die Reflexion des Lernprozesses und die Analyse der Relevanz der erworbenen Kompetenzen für den beruflichen Alltag.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen wissenschaftliches Arbeiten, Zitierweise, Plagiat, Satzungeheuer, Exzerpieren und die Relevanz dieser Kompetenzen für den beruflichen Alltag.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist korrektes Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten so wichtig?
Es dient der inhaltlichen Überprüfbarkeit, schützt vor dem Vorwurf des Plagiats und ermöglicht es dem Leser, Quellen eindeutig zuzuordnen.
Was versteht man unter „Satzungeheuern“?
Satzungeheuer sind übermäßig lange, verschachtelte oder fehlerhafte Satzstrukturen, die die Lesbarkeit und Verständlichkeit wissenschaftlicher Texte beeinträchtigen.
Was ist der Unterschied zwischen der deutschen und der Harvard-Zitierweise?
Die deutsche Zitierweise nutzt meist Fußnoten am Seitenende, während die Harvard-Zitierweise (Autor-Jahr-System) Kurzhinweise direkt im Text verwendet.
Wozu dient ein Exzerpt?
Ein Exzerpt ist eine Methode zur systematischen Zusammenfassung und Analyse von Textpassagen, um die wichtigsten Argumente für die eigene Arbeit festzuhalten.
Welche Konsequenzen hat ein Plagiat?
Die Nichteinhaltung wissenschaftlicher Standards kann von der Ablehnung der Arbeit bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen und dem Verlust akademischer Grade führen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Das richtige Zitieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988092