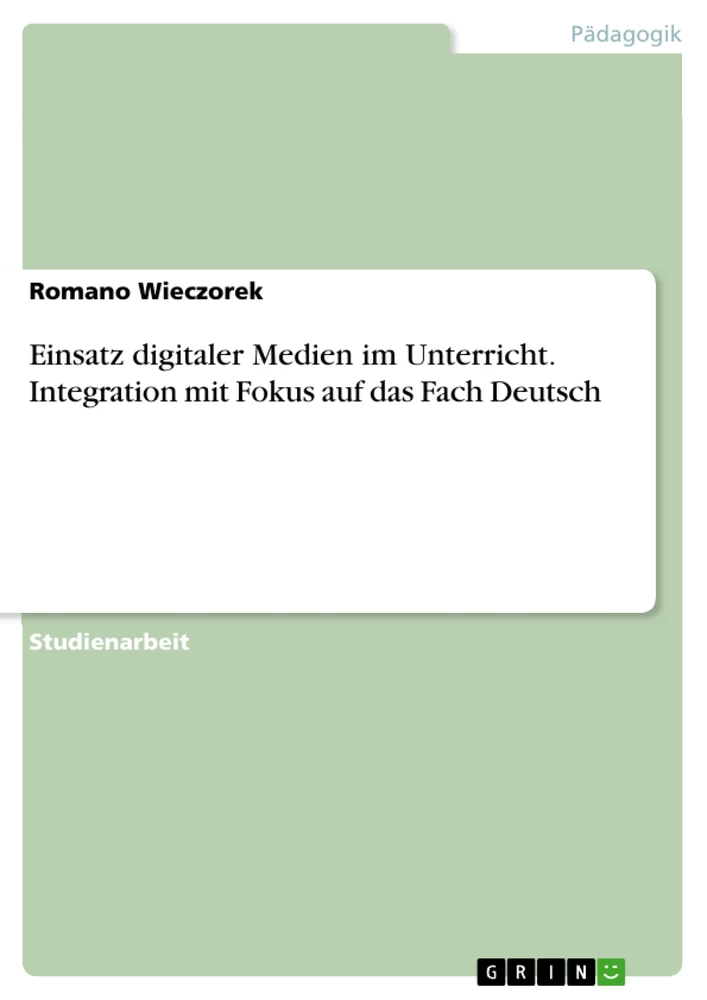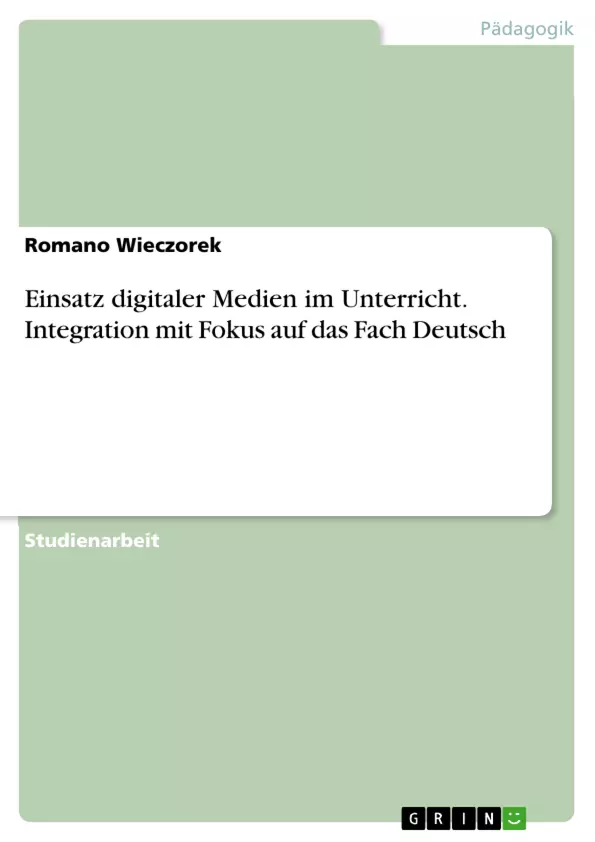In dieser Arbeit geht es um die Verwendung digitaler Medien im Schulunterricht. Es wird hierbei unter anderem auf die aktuelle Corona- Situation und die Potentiale digitaler Medien eingegangen. Der Fokus liegt auf dem Deutschunterricht.
Wenn man einen Blick auf die technischen Entwicklungen unserer Alltagsgegenstände in den letzten beiden Jahrzehnten wirft, wird schnell klar, wie rasant diese sich entwickeln und sich von Jahr zu Jahr aus technischer Sicht enorm verbessern. Wo Computer vor 2 Jahrzehnten noch als Gerät zum Arbeiten fungierten und lediglich einige simple Strategiespiele boten, sind die Läden heute voll mit Hochleistungscomputern, die immer kleiner werden und immer erstaunlichere Leitungen zu bieten haben. Das Gerät, welches wohl den meisten Einfluss auf den Alltag der Menschen einnimmt, ist das Smartphone.
Auch hier hat die technische Entwicklung in den letzten Jahren erstaunliches geleistet und jedes Jahr kommen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten hinzu. Doch nicht nur die Geräte an sich haben sich verändert, auch die Gruppe der Nutzer ist eine andere geworden. Es ist zur Normalität geworden, dass Kinder eigene Smartphones besitzen und online Videospiele auf dem Computer oder Laptop spielen. Es ist außerdem zu erkennen, dass die digitalen Medien, gerade für die nachkommenden Generationen die ursprünglichen Medien teilweise ablösen. So wird nach Möglichkeit zum Lesen teilweise eher das Tablet oder Smartphone anstelle eines Buches benutzt. Auch das Schreiben, welches noch vor einigen Jahren in den Schulen ausschließlich per Hand stattfand, wird heutzutage immer mehr am Computer gemacht. Zu den Vor- und Nachteilen diesbezüglich gibt es unzählige unterschiedliche Meinungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Digitale Medien im Unterricht
- Digitale Medien im Deutschunterricht
- Kommunikation
- Auditive Medien
- Audiovisuelle Medien
- Schreib- und Publikationsmedien
- Lernen mit digitalen Medien in Zeiten von Corona
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration digitaler Medien in den Schulunterricht, insbesondere im Deutschunterricht. Es wird die Frage beleuchtet, inwieweit und wie digitale Medien sinnvoll eingesetzt werden können. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Implementierung, berücksichtigt die Rolle der Lehrkräfte und die Notwendigkeit von Fortbildungen.
- Der Stellenwert digitaler Medien in unserer Gesellschaft
- Herausforderungen und Chancen der Integration digitaler Medien im Unterricht
- Die Bedeutung von Lehrerausbildung und -fortbildung im Umgang mit digitalen Medien
- Der Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Bereichen des Deutschunterrichts
- Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Medieninhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den rasanten technologischen Wandel der letzten Jahrzehnte und den damit einhergehenden Einfluss digitaler Medien auf den Alltag, insbesondere auf Kinder und Jugendliche. Sie führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Inwieweit sollten digitale Medien im Unterricht, speziell im Deutschunterricht, integriert werden? Die rasante Entwicklung von Computern und Smartphones wird hervorgehoben, ebenso wie die zunehmende Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche zum Lesen und Schreiben. Der Text betont die unterschiedlichen Meinungen zu den Vor- und Nachteilen dieser Entwicklung und kündigt die fokussierte Auseinandersetzung mit der Integration digitaler Medien im Unterricht an.
Digitale Medien im Unterricht: Dieses Kapitel verdeutlicht den hohen Stellenwert digitaler Medien in unserer Gesellschaft, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Es wird die Notwendigkeit eines Wandels im Schulsystem angesprochen, um auf die modernen Gegebenheiten zu reagieren. Der Text betont den Unterschied zwischen früheren Ansätzen der Medienkompetenz-Vermittlung und dem heutigen Ansatz der Integration digitaler Medien in alle Fächer. Die Arbeit unterstreicht, dass die digitale Welt die soziale Kommunikation, den Berufsalltag und die Persönlichkeitsbildung prägt und die Frage nach dem *Wie* der Integration, nicht mehr nach dem *Ob*, im Vordergrund steht. Wirtschaftliche Aspekte wie die Ausstattung der Schulen werden zwar angesprochen, aber nicht im Detail behandelt.
Schlüsselwörter
Digitale Medien, Schulunterricht, Deutschunterricht, Medienintegration, Lehrerausbildung, Medienkompetenz, Digitalisierung, Herausforderungen, Chancen, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zu: Integration digitaler Medien im Deutschunterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration digitaler Medien in den Schulunterricht, insbesondere im Deutschunterricht. Sie beleuchtet die sinnvolle Anwendung digitaler Medien, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Implementierung sowie die Rolle der Lehrkräfte und die Notwendigkeit von Fortbildungen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu digitalen Medien im Unterricht und im Deutschunterricht (mit Unterkapiteln zu Kommunikation, auditiven, audiovisuellen und Schreib-/Publikationsmedien), ein Kapitel zum Lernen mit digitalen Medien in Zeiten von Corona, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Es werden der Stellenwert digitaler Medien in der Gesellschaft, Herausforderungen und Chancen der Integration, die Bedeutung von Lehrerausbildung, der Einsatz in verschiedenen Bereichen des Deutschunterrichts und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Medieninhalten behandelt.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: Einleitung, Digitale Medien im Unterricht, Digitale Medien im Deutschunterricht (mit Unterkapiteln zu Kommunikation, auditiven Medien, audiovisuellen Medien und Schreib- und Publikationsmedien), Lernen mit digitalen Medien in Zeiten von Corona, Fazit und Literaturverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Stellenwert digitaler Medien in unserer Gesellschaft, die Herausforderungen und Chancen ihrer Integration im Unterricht, die Bedeutung von Lehrerausbildung und -fortbildung im Umgang mit digitalen Medien, den Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Bereichen des Deutschunterrichts und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Medieninhalten.
Wie werden digitale Medien im Deutschunterricht behandelt?
Das Kapitel "Digitale Medien im Deutschunterricht" unterteilt sich in Unterkapitel zu Kommunikation, auditiven Medien, audiovisuellen Medien und Schreib- und Publikationsmedien. Es wird untersucht, wie diese Medienarten im Deutschunterricht sinnvoll eingesetzt werden können.
Welche Rolle spielt die Lehrerausbildung?
Die Lehrerausbildung und -fortbildung spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit betont die Notwendigkeit von entsprechenden Maßnahmen, um Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien zu schulen und sie in die Lage zu versetzen, diese effektiv im Unterricht einzusetzen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im entsprechenden Kapitel zusammengefasst und bietet eine abschließende Bewertung der Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitale Medien, Schulunterricht, Deutschunterricht, Medienintegration, Lehrerausbildung, Medienkompetenz, Digitalisierung, Herausforderungen, Chancen, Kommunikation.
Wie wird der Einfluss der Corona-Pandemie behandelt?
Ein separates Kapitel widmet sich dem Lernen mit digitalen Medien in Zeiten von Corona und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Erfahrungen während dieser Zeit.
- Quote paper
- Romano Wieczorek (Author), 2020, Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Integration mit Fokus auf das Fach Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988200