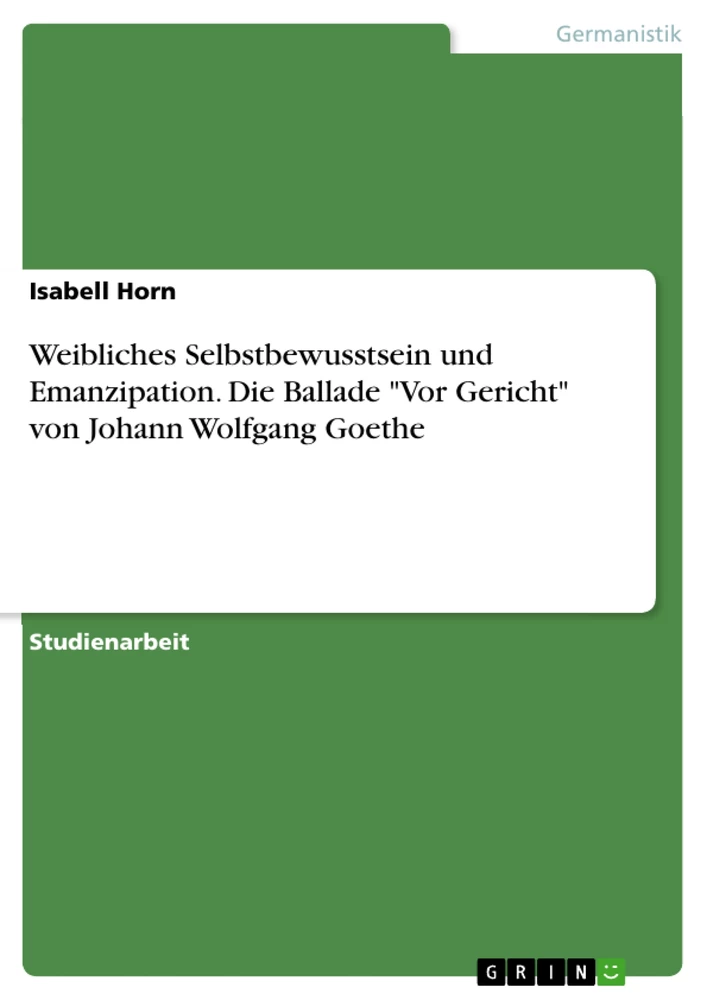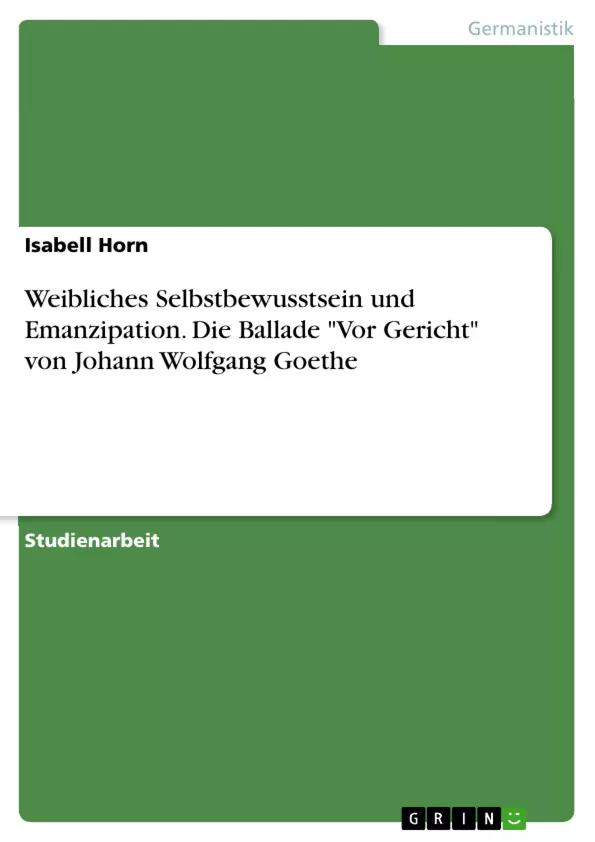Goethes Ballade „Vor Gericht“ erhielt in der Tat nur wenig Beachtung von ‚Anthologisten‘ und Interpreten, bietet jedoch genügend interpretatorischen Spielraum und verdeutlicht zugleich, dass Goethe die historischen Möglichkeiten der Frauenrollen bedeutend überschritt. Um die Besonderheit dieses Gedichts ausarbeiten zu können, ist es daher unumgänglich, die gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit etwas umfassender darzustellen, weshalb unter anderem auf die Stellung lediger Frauen im 18. Jahrhundert, Unzucht als Straftatbestand und der Kindsmord als häufige Konsequenz näher eingegangen wird. Abschließend soll die Kritik am Justizsystem und die damit einhergehende öffentliche Auflehnung gegen Kirche und Staat thematisiert werden. Als Grundlage für die Analyse in dieser Seminararbeit dient mitunter die Interpretation des Literaturwissenschaftlers Walter Müller-Seidel, die er im Jahr 1983 verfasste.
Inhaltsverzeichnis
- Weibliches Selbstbewusstsein und Emanzipation: Goethes Vor Gericht
- Die Ballade im sozialkritischen Kontext
- Die Reime und die metrische Struktur
- Die Redeform und ihre Bedeutung
- Die Frau und ihre Rolle als Mutter in der spätfeudalistischen Gesellschaft
- „Hure“ oder „ehrlich Weib“?
- Das Verhältnis zum Vater des ungeborenen Kindes
- Unzucht als Straftatbestand und das Motiv des Kindsmords
- „Herr Pfarrer und Herr Amtmann“: Widersetzen gegen geistliche und weltliche Obrigkeit
- Über den Sinn und Zweck des Gedichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Goethes Ballade „Vor Gericht“ und untersucht die Darstellung weiblichen Selbstbewusstseins und Emanzipation im Kontext der spätfeudalistischen Gesellschaft. Ziel ist es, die Position der Frau in einem Gerichtsprozess, ihre Rolle als Mutter und ihre Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Konventionen und der obrigkeitlichen Macht zu beleuchten.
- Weibliche Selbstbehauptung und Widerstand gegen gesellschaftliche Normen
- Kritik am Justizsystem und den gesellschaftlichen Machtstrukturen
- Die Rolle der Frau in der spätfeudalistischen Gesellschaft
- Die Bedeutung von Sprache und Redeform in Goethes Ballade
- Soziale Missstände und Kritik an der moralischen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Charaktereigenschaften der Frau in der Verhörszene vor Gericht und beleuchtet ihre entschlossene Haltung gegenüber den vorgegebenen Konventionen. Kapitel zwei fokussiert sich auf die formalen Aspekte der Ballade, wie Reime, Metrik und Redeform, und zeigt deren Bedeutung für die Darstellung der weiblichen Protagonistin. Das dritte Kapitel untersucht die Rolle der Frau als Mutter in der spätfeudalistischen Gesellschaft, beleuchtet die soziale Stigmatisierung lediger Mütter und die damit verbundenen strafrechtlichen Konsequenzen.
Schlüsselwörter
Goethes „Vor Gericht“, Weibliches Selbstbewusstsein, Emanzipation, Spätfeudalistische Gesellschaft, Balladendichtung, Sozialkritik, Justizkritik, Frau und Mutterrolle, Straftatbestand Unzucht, Kindsmord, Redeform, Sprache, Moral, Obrigkeit, Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Goethes Ballade „Vor Gericht“?
Die Ballade thematisiert eine junge Frau, die sich vor Gericht wegen Unzucht oder Kindsmord verantworten muss und dabei ein außergewöhnliches Selbstbewusstsein zeigt.
Welche gesellschaftlichen Missstände kritisiert Goethe in diesem Werk?
Goethe kritisiert das starre Justizsystem, die moralische Doppelmoral der Kirche und des Staates sowie die prekäre Lage lediger Mütter im 18. Jahrhundert.
Wie wird das Thema „Emanzipation“ in der Ballade behandelt?
Die Protagonistin widersetzt sich der geistlichen und weltlichen Obrigkeit („Herr Pfarrer und Herr Amtmann“) und überschreitet damit die historischen Grenzen der damaligen Frauenrolle.
Was war der historische Kontext für das Motiv des Kindsmords?
Im 18. Jahrhundert war Unzucht ein Straftatbestand; die soziale Stigmatisierung und die Verzweiflung lediger Frauen führten damals häufig zum Motiv des Kindsmords.
Welche Rolle spielt die Redeform in dem Gedicht?
Die direkte Rede und die entschlossene Haltung der Frau im Verhör dienen dazu, ihre innere Stärke und ihren Widerstand gegen die patriarchale Gesellschaft zu unterstreichen.
- Quote paper
- Isabell Horn (Author), 2020, Weibliches Selbstbewusstsein und Emanzipation. Die Ballade "Vor Gericht" von Johann Wolfgang Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/989770