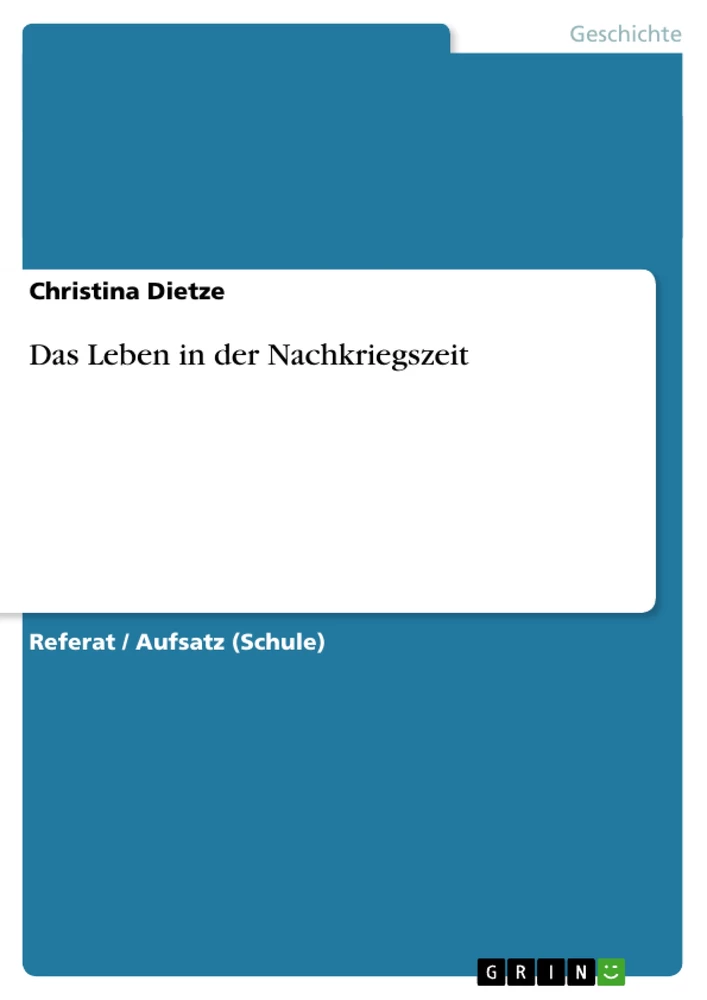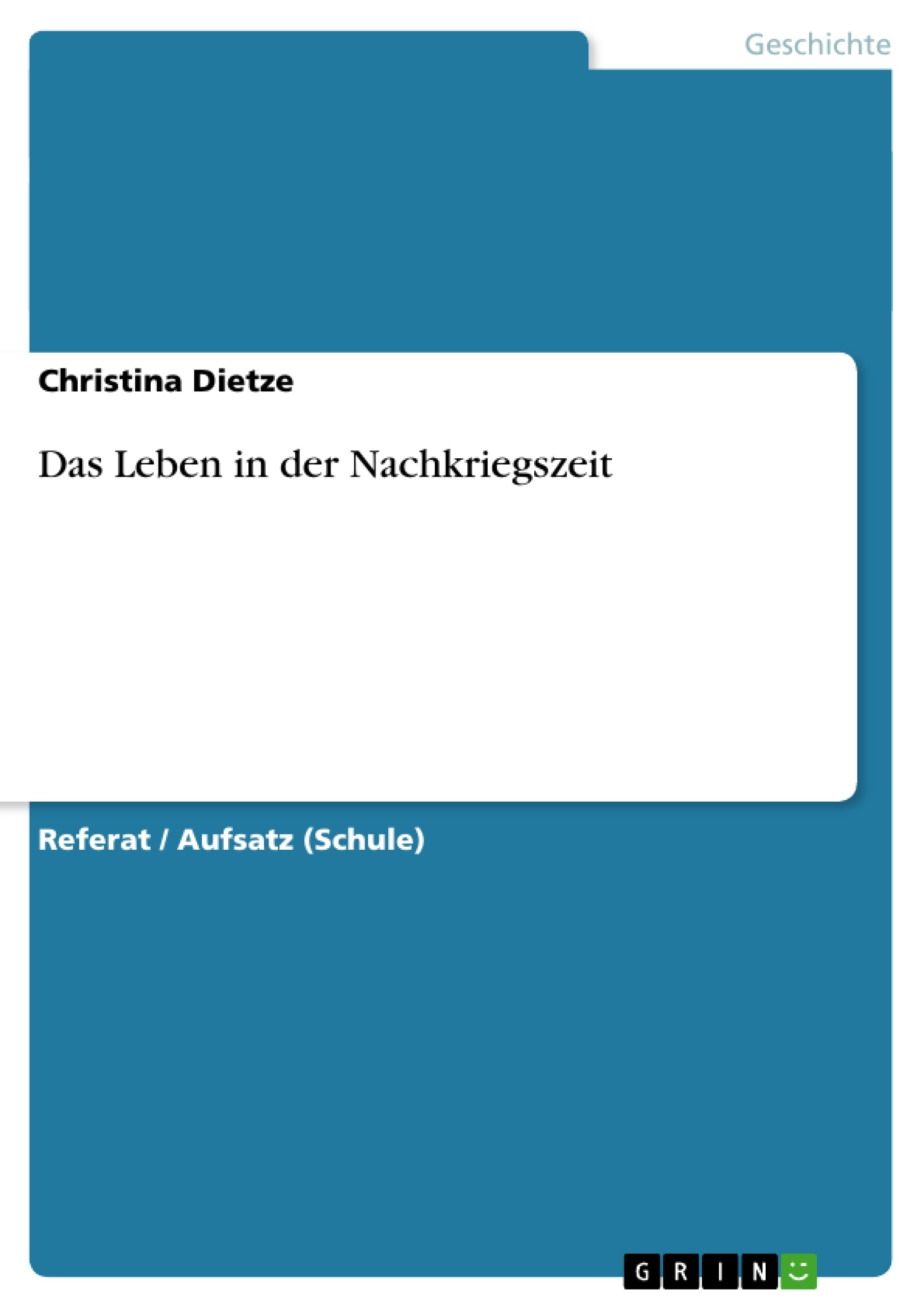Situation der Menschen in der Nachkriegszeit
- Mit 55 Millionen Toten, dem Verlust unermesslicher Sachwerte, mit Flucht, Vertreibung und Verschleppung endete der 2. Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands
- Es begann die Aufteilung Deutschlands in 4 Sektoren.
- Die Wirtschaft entwickelte sich dementsprechend auch weiter, aber nach dem Krieg war zunächst einmal völlig danieder
- Der 2 WK führte zur vollständigen Zerstörung vieler deutscher Handelsschiffe und es gingen etwa 72% der gesamten Handelsflotte verloren
- Durch die Kriegseinwirkungen waren die meisten Fabriken und industriellen Ballungsgebiete vernichtet und dadurch konnte auch nicht neu produziert werden
- Kraftwerke waren zerstört und damit war die Stromversorgung völlig zusammengebrochen
- In der Landwirtschaft gab es kein Saatgut mehr, keine Geräte und auch keine Pferde, die den Flug hätten ziehen können, weil diese für Kriegswichtige Zwecke benutzt wurden sind
- Aber was war eigentlich mit den Menschen ?
- Welche Not welches Maß an Verzweiflung sie traf war wohl unbeschreiblich
- Nicht was das Leben eines Menschen ausmachte war mehr funktionsfähig oder gar vorhanden
- Die ersten Maßnahmen nach der Befreiung des Landes konzentrierten sich auf den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und die Beseitigung unmittelbarer Kriegsschäden
- In dieser Zeit tragen vor allem die sogenannten Trümmerfrauen die Hauptlast der Aufbauarbeiten, ein Begriff, der für das Schicksal einer ganzen Frauengeneration bezeichnend ist
- Da die Männer alle im Krieg geblieben waren oder in Kriegsgefangenschaft waren sie diejenigen die sämtlichen Schutt wegräumten um wieder neue Wohnunterkünfte daraus zu schaffen
- Doch nicht nur das machte den Nachkriegsalltag aus : - Es mangelte besonders in der sowjetischbesetzten Zone an Nahrungsmitteln und Heizstoffen
- Der Bedarf konnte aus der eigenen daniederliegenden Produktion nicht mehr gedeckt werden und für Importe hatte man keine Devisen
- So wurde mit Hilfe von Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen die Armut verwaltet
- Wer alleine darauf angewiesen war hatte zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel
- Geld war nicht viel wert, zu viel war in Folge der Kriegswirtschaft im Umlauf
- Wer in den zerbombten Städten nicht gerettet Wertgegenstände - Teppiche, Tafelsilber oder Schmuck - für Tauschgeschäfte auf Bauernhöfe tragen konnte, musste zur Erntezeit Ähren, Rüben oder Kartoffeln von den abgeernteten Feldern nachlesen, Stoppeln, konnte Torf stechen und ließ sich mit Torf entlohnen oder sammelte kiloweise Bucheckern, was meine Uroma auf dem Dorf auch gemacht hat um überhaupt zu existieren.
- Für Bucheckern konnte man 100g -Marken zum Bezug von Margarine bekommen
- Aber das Sammeln war eine äußerst Zeitraubende Arbeit und brachte bei der großen Konkurrenz von Hungernden nur sehr wenig Erträge ein
- Da das Jahr 1946 auch noch zu allem übel schlechte klimatische Bedingungen hatte, hatten die Bauern in den Dörfern auch sehr geringe Erträge und es mangelte an Saatgut
- So konnten die Felder auch nicht für das nächste Jahr bestellt werden
- Überhaupt herrschte auf dem Dorf in vielen Gegenden Deutschlands besonders in der Röhn eine extremere Armut als in den Städten
- Kaffe wurde aus Kartoffelschalen gekocht und Kuchen aus Kaffeeersatzpulver als Hauptbestandteil, Mehl, Zucker und einem Ei gebacken
- Ein weiteres ganz berühmtes Gericht zu der Zeit war die Zudelsuppe, das waren geriebene rohe Kartoffeln in heißem Wasser mit etwas Salz und Kräutern die im Garten wuchsen abgeschmeckt
- Da man für die Tauschgeschäfte mit dem Bauern auch nicht viel bekam lernte man den Wert seines Lebens und dessen was man verdiente ganz anders einzuschätzen
- Wenn man ganz früh mit dem Zug hinten auf offnen Waggons hinaus in ein anders Dorf fuhr zum Stoppeln und abends wieder kam brachte man trockenes Brot und ein kleines Stück Wurst mit und das ( so war es in unserer Familie) wurde dann zusammen gegessen, da man auch kein Strom hatte saß man oft Abend zusammen und unterhielt sich im Schein der Petroleumlampen
- In einer Familie zu der Nachkriegszeit, sofern sie noch existent war, war ein unglaublich starker Zusammenhalt da alles wurde geteilt und man war trotz der großen Verluste auch glücklich
- Neben solchen Aktivitäten auf dem Lande bildete sich in den Städten ein üppig blühender Schwarzmarkt heraus, an dem sich ein Großteil der Bevölkerung beteiligte
- Gegen viel Geld oder im Tauschhandel war hier sehr vieles zu bekommen
- Eine große Rolle spielte die Zigarettenwährung:
- Jedem Erwachsenen standen Marken zum Bezug von rationierten Zigaretten zu
- Da aber nicht jeder Raucher war konnten solche Anrechtsscheine gegen Milch oder Butter eingetauscht werden
- Wer darüber hinaus in alliierten Dienststellen zu sogn. Ami - Zigaretten kam, konnte Eier, Butter und Wurst erstehen
- Und seit dem Jahre 1946 rettete die Hilfe des amerikanischen Steuerzahlers mit dem Programm „Goverment Aid and Relief in Occupied Areas sowie auch die Hilfe der amerikanischen Wohlfahrtsverbände mit Schulspeisungen und Care - Paketen in der Bi-Zone Hundertausenden vor dem Verhungern
- Nicht ganz so rosig sah es dagegen im sowjetischbesetzten Gebiet aus, da die russ. Bevölkerung selbst sehr arm war konnte man auch nicht viel Hilfe erwarten
- Während die Amerikaner, Franzosen und Engländer den Schwarzmarkthandel verboten und selbst die Ausfuhr von Lebensmitteln in eine andere Zone nicht genehmigt wurde, konnte man aber mit den Russen selbst Tauschgeschäfte machen
- Der örtliche Treffpunkt hier befand sich im Park in Weimar und wenn man dort als Frau hingegangen ist um mit ihnen irgendwelche Tauschgeschäfte abzuwickeln, verlangten sie nicht die Bezahlung in materiellen Dingen und so blühte auch hier der Schwarzmarkthandel
- Nicht nur die Lebensmittelversorgung war schlecht es gab auch keine Medikamente, man konnte nur Holz sammeln im Wald mit Erlaubnis, es gab Stromsperren und niemand durfte nach 20 Uhr mehr das Haus verlassen, viele LKW’s fuhren mit Holzvergasern, es konnte nicht repariert werden, weil die Maschinen und die Fachkräfte dafür fehlten
- Es gab weder Lehrer, weil diese alle in den Krieg mussten, noch Schulen und Ärzte, daher war auch fast kein Bildungssystem vorhanden und es gab nur wenige Schulen, die nach dem Krieg gleich wieder öffneten
- Die Gefühle der Menschen waren zweischneidig zu dieser Zeit
- Es herrschte Wut wegen der ungerechten Behandlung, dass Verlierergefühl war da
- Hoffnungslosigkeit, Resignation und Apathie, wegen der unzähligen Toten und den Lebensumständen
- Auf der andern Seite war man aber auch froh das alles vorbei war
- Ein wichtiger sozialer Bereich, den Hitler während des Krieges ausgelagert hatte war die Kunst und Kultur, sie drückte in der Zeit nach dem Krieg die Gefühle der Menschen aus, aber versuchte auch die Kriegszeit zu überspringen um sich dann weiter zu entwickeln
- Der Topos Theater lokalisierte in besonderem Maße die alt-neu Mentalitätsstruktur
- Zum einen war es ein faszinierendes Zeichen von kultureller Überlebenskraft, dass in Mitten der Trümmerlandschaft das Theaterleben wie Phönix aus der Asche aufblühte.
- Klassiker wie Iphigenie auf Tauris sollten Signal für die innere Einkehr und Umkehr sein
- Die Toten, die Trümmer und das Elend im Nacken hinderten nicht daran, dass man sich von einer alles versöhnenden Menschlichkeit beflügelt fühlte.
- Neben diesen Stücken wurden zu dieser Zeit auch neu geschriebene Stücke gespielt, obwohl die Schubladen der Dramatiker leer waren, versuchte man doch erste Kriegserlebnisse zu verarbeiten wie
Häufig gestellte Fragen
Wie war die Situation der Menschen in der Nachkriegszeit in Deutschland?
Die Situation war katastrophal. Der Zweite Weltkrieg endete mit 55 Millionen Toten, enormen Sachschäden, Flucht, Vertreibung und Verschleppung. Deutschland wurde in vier Sektoren aufgeteilt, und die Wirtschaft lag am Boden.
Welche Auswirkungen hatte der Krieg auf die deutsche Wirtschaft?
Die deutsche Handelsflotte wurde fast vollständig zerstört, Fabriken und Industriegebiete waren vernichtet, und die Stromversorgung war zusammengebrochen. In der Landwirtschaft fehlten Saatgut, Geräte und Zugtiere.
Welche Rolle spielten die Trümmerfrauen beim Wiederaufbau?
Die Trümmerfrauen trugen die Hauptlast der Aufbauarbeiten. Da viele Männer im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft waren, räumten sie den Schutt weg, um neue Wohnungen zu schaffen.
Wie sah die Versorgungslage in der sowjetisch besetzten Zone aus?
Es mangelte an Nahrungsmitteln und Heizstoffen. Die eigene Produktion reichte nicht aus, und es fehlten Devisen für Importe. Die Armut wurde mit Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen verwaltet.
Wie versuchten die Menschen zu überleben, wenn Geld wertlos war?
Viele tauschten Wertgegenstände auf Bauernhöfen gegen Lebensmittel. Andere sammelten Ähren, Rüben, Kartoffeln, stachen Torf oder sammelten Bucheckern, um sich Lebensmittelmarken zu sichern.
Wie war die Armutssituation auf dem Land im Vergleich zu den Städten?
In vielen ländlichen Gebieten, insbesondere in der Rhön, herrschte oft extremere Armut als in den Städten.
Welche Rolle spielte der Schwarzmarkt im Nachkriegsdeutschland?
Der Schwarzmarkt florierte in den Städten. Gegen Geld oder im Tauschhandel waren viele Waren erhältlich. Zigaretten dienten oft als Währung.
Welche Hilfsmaßnahmen gab es für die Bevölkerung?
Das amerikanische Hilfsprogramm "Government Aid and Relief in Occupied Areas" und die Hilfe amerikanischer Wohlfahrtsverbände mit Schulspeisungen und Care-Paketen retteten Hunderttausende vor dem Verhungern.
Wie unterschied sich die Situation in der sowjetisch besetzten Zone?
Die russische Bevölkerung war selbst sehr arm, daher war die Hilfe begrenzt. Tauschgeschäfte mit russischen Soldaten waren jedoch möglich, oft unter fragwürdigen Bedingungen.
Welche Probleme gab es neben der Lebensmittelversorgung?
Es fehlten Medikamente, es gab Stromsperren, und niemand durfte nach 20 Uhr das Haus verlassen. Transportmittel und Maschinen konnten oft nicht repariert werden, und es mangelte an Fachkräften.
Wie war die Situation in Bezug auf Bildung und medizinische Versorgung?
Es gab einen Mangel an Lehrern und Ärzten, da viele im Krieg waren. Das Bildungssystem war stark eingeschränkt, und nur wenige Schulen öffneten bald nach dem Krieg.
Welche Gefühle beherrschten die Menschen in der Nachkriegszeit?
Es gab Wut über die ungerechte Behandlung, ein Gefühl des Verlierens, Hoffnungslosigkeit und Apathie. Gleichzeitig waren viele froh, dass der Krieg vorbei war.
Welche Rolle spielte die Kunst und Kultur in der Nachkriegszeit?
Kunst und Kultur drückten die Gefühle der Menschen aus und versuchten, die Kriegszeit zu verarbeiten und sich weiterzuentwickeln. Das Theater erlebte eine Renaissance und thematisierte sowohl klassische Werte als auch die kalte Realität des Krieges.
- Quote paper
- Christina Dietze (Author), 2000, Das Leben in der Nachkriegszeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99018