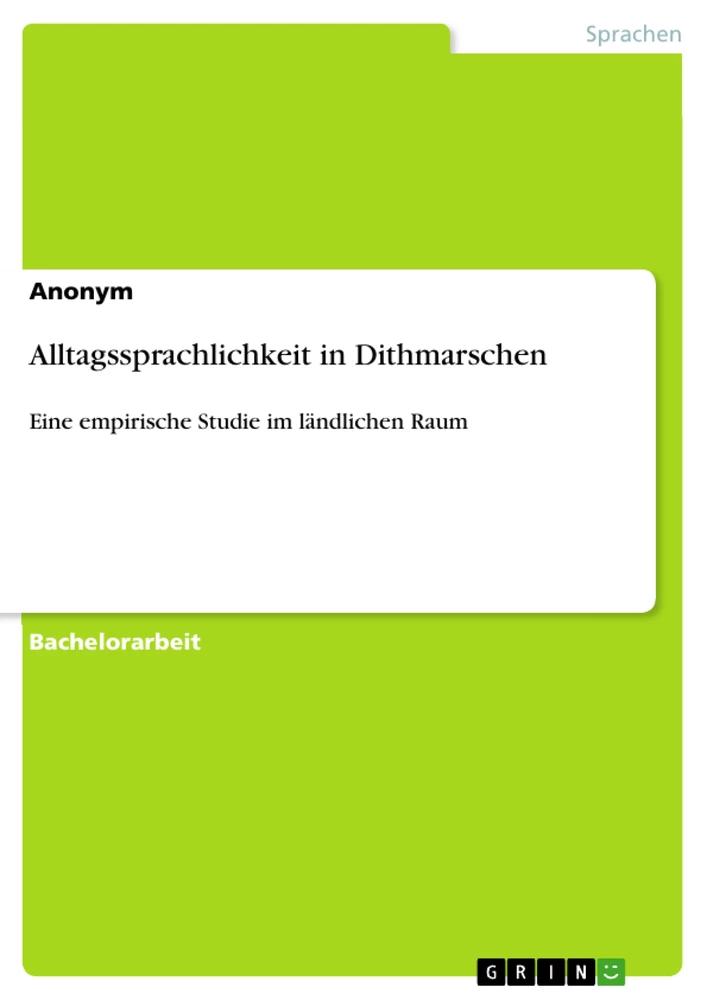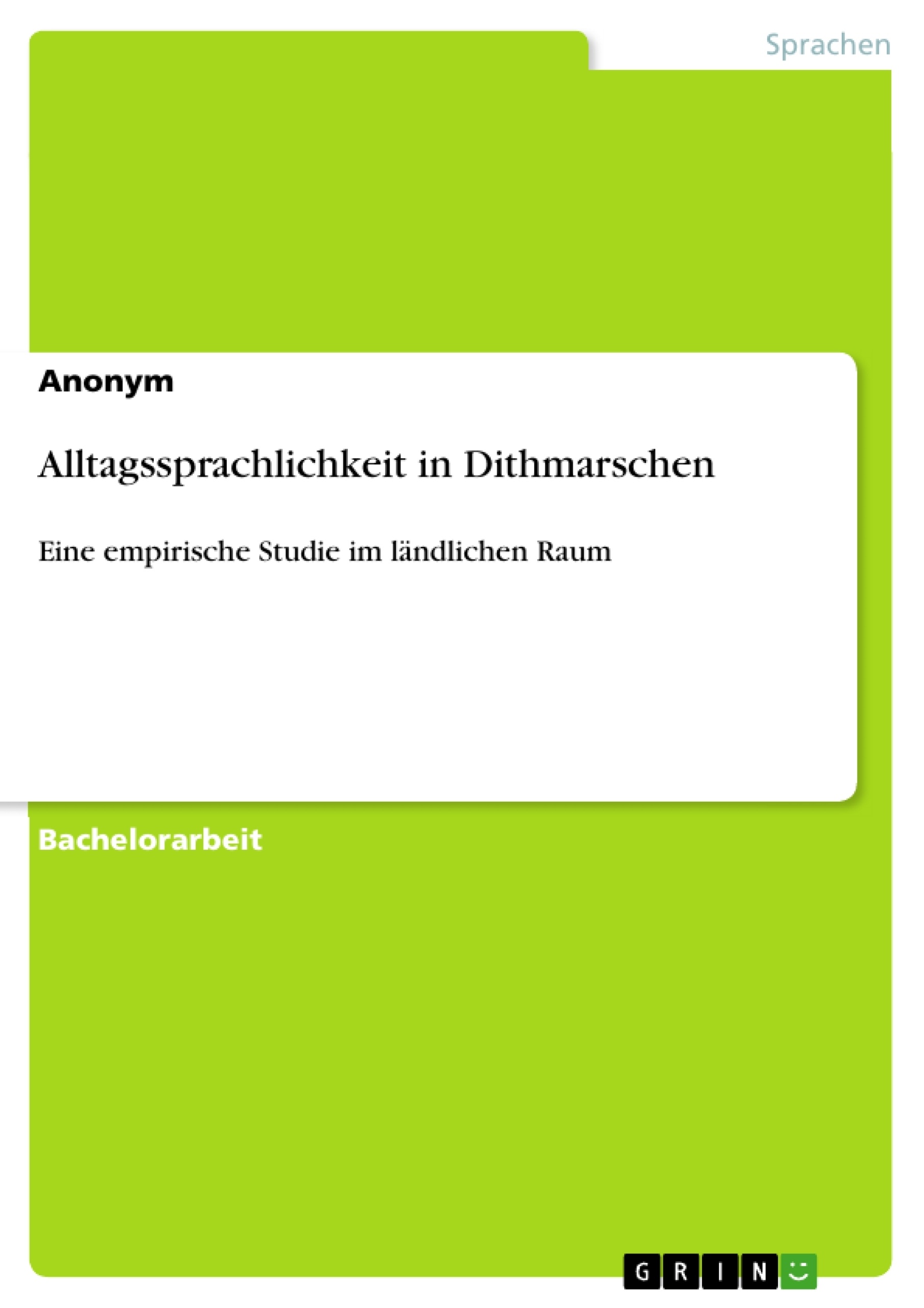In dieser Arbeit wird die Alltagssprachlichkeit in Dithmarschen empirisch untersucht. Hierfür muss zunächst ein Handlungsrahmen festgelegt werden. Dieser besteht aus der Untersuchung der Eingliederung des Niederdeutschen innerhalb der Alltagssprache Dithmarschens.
Durch die Bearbeitung der Thesis soll die Frage, welchen Stellenwert das Niederdeutsche innerhalb der Alltagssprachlichkeit Dithmarschens habe, beantwortet werden. Dazu wurde eine Studie mit einer Kleingruppe durchgeführt, welche sowohl Sprecher des Niederdeutschen als auch solche, die das Niederdeutsche nicht sprechen, beinhaltet.
Das Ziel der Befragung dieser Personen war, das Wissen der Befragten über die Alltagssprache in Dithmarschen zu dokumentieren und zu analysieren. Dabei sollen die Alltagserfahrungen der befragten Personen als Grundlage dienen. Diese erweisen sich als interessant, da die Studienteilnehmer aus demselben sozialen Umfeld stammen, jedoch eine unterschiedliche Sprachpraxis aufweisen. Die Erfragung des Alltagswissen der Studienteilnehmer ist von Relevanz, da dieses Wissen ohne eine Dokumentation innerhalb der nächsten Generationen verloren gehen würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Alltagssprachlichkeit
- Sprachwechsel zwischen dem Hochdeutschen und dem Niederdeutschen
- Wahrnehmung der Sprachen
- Niederdeutsch in der Schule
- Methodologie
- Umsetzung einer Kleingruppenstudie
- Persönlicher Bezug zu den Studienteilnehmern
- Datenerhebung durch Interviews
- Empirische Studie zur Alltagssprachlichkeit in Dithmarschen
- Beschreibung der Kleingruppenstudie
- Vorstellung der Sprachbiografien
- Alastair Walker: Sprachbiografien aus Nordfriesland
- Sprachbiografie Familie A
- Sprachbiografie Familie B
- Vergleich der Sprachbiografien aus Dithmarschen mit Walkers Ergebnissen
- Ergebnisse der Interviews
- Der Sprachgebrauch in der Schule
- Der Gebrauch des Niederdeutschen in verschiedenen Lebensphasen
- Sprachwechsel
- Die Wahrnehmung der Sprachen in Dithmarschen
- Entwicklung des Alltagssprachgebrauchs in Dithmarschen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht den Stellenwert des Niederdeutschen innerhalb der Alltagssprache in Dithmarschen. Die Studie verfolgt das Ziel, das Wissen der Befragten über die Alltagssprache zu dokumentieren und zu analysieren. Dabei stehen die Alltagserfahrungen der Studienteilnehmer im Vordergrund, insbesondere die Sprachpraxis von Personen aus demselben sozialen Umfeld, aber mit unterschiedlichem Sprachgebrauch.
- Alltagssprachlichkeit und ihre soziale Dimension
- Sprachwechsel zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch
- Wahrnehmung von Sprachen und Dialekten
- Niederdeutsch in der Schule und im Alltag
- Entwicklung des Sprachgebrauchs in Dithmarschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Alltagssprachlichkeit in Dithmarschen ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Stellenwert des Niederdeutschen in diesem Kontext. Das Kapitel „Theorie“ beleuchtet verschiedene Aspekte der Alltagssprachlichkeit, wie den Sprachwechsel zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch, die Wahrnehmung von Sprachen und die Einbindung des Niederdeutschen in den Unterricht. Die „Methodologie“ beschreibt die Durchführung der Kleingruppenstudie und die Datenerhebung durch Interviews. Im Kapitel „Empirische Studie zur Alltagssprachlichkeit in Dithmarschen“ werden die Ergebnisse der Interviews vorgestellt, gegliedert nach Themenbereichen wie Sprachgebrauch in der Schule, Gebrauch des Niederdeutschen in verschiedenen Lebensphasen, Sprachwechsel und Wahrnehmung der Sprachen in Dithmarschen. Die Analyse umfasst auch einen Vergleich der Sprachbiografien aus Dithmarschen mit Ergebnissen von Alastair Walker aus Nordfriesland.
Schlüsselwörter
Alltagssprache, Dithmarschen, Niederdeutsch, Sprachwechsel, Hochdeutsch, Wahrnehmung, Sprachbiografie, Kleingruppenstudie, Interviews.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Alltagssprachlichkeit in Dithmarschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990374