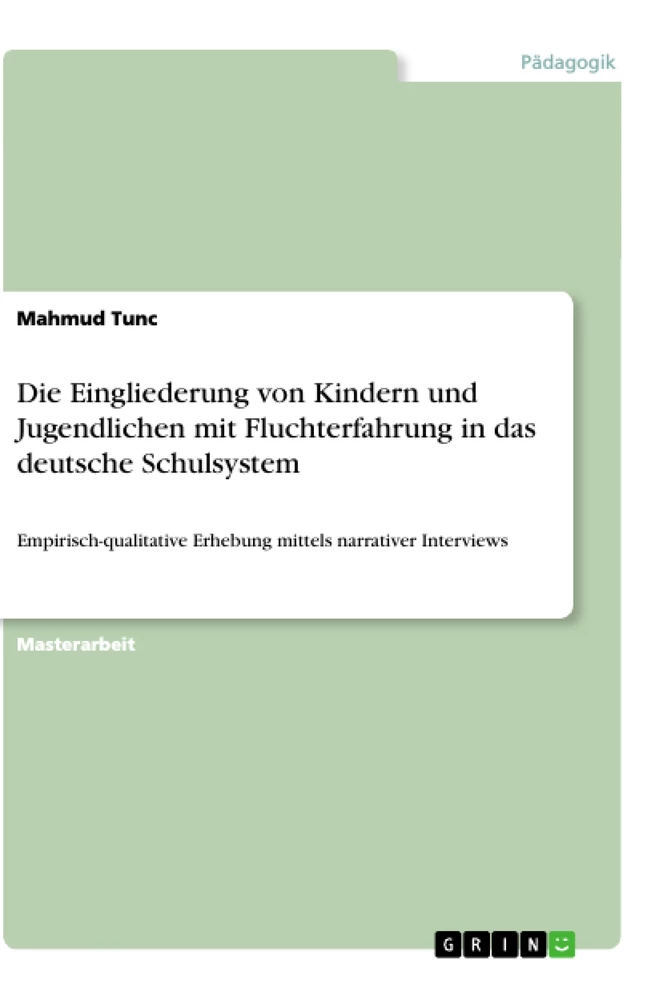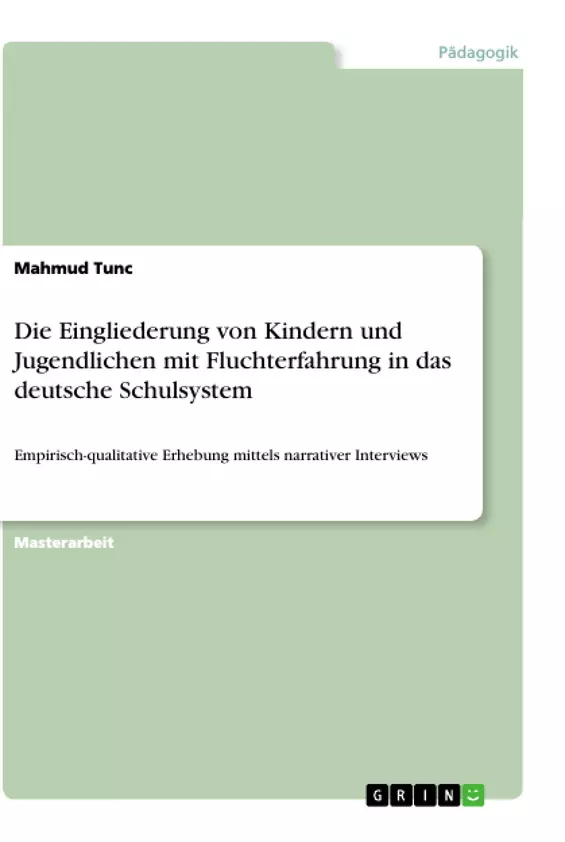Es stellt sich die Frage, mit welchen Belastungen Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung im deutschen Schulsystem während und nach ihrer Eingliederung konfrontiert werden und wie die Schule und das Schulsystem hierauf reagieren. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Schule und das Schulsystem den Erwartungen und Hoffnungen von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung gerecht werden können. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die oben angeführten Fragen qualitativ-empirisch zu untersuchen, um einen Einblick in den Eingliederungsprozess von Schüler*innen mit Fluchterfahrung in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen.
Für diese Arbeit wurden narrative Interviews mit Schüler*innen der Sekundarstufe I durchgeführt. Aufgrund dessen berücksichtigt der Aufbau des Folgenden die klassische Gliederung einer empirischen Untersuchung. Beginnend mit der Einleitung, in der das Thema bereits kurz vorgestellt wurde, soll nun im zweiten Kapitel eine Einführung in die theoretischen Grundlagen und in den gegenwärtigen Forschungsstand erfolgen. Dieser Schritt ermöglicht nicht nur einen umfangreichen Einblick in das Themengebiet, sondern könnte an dieser Stelle auch schon dazu beitragen, dass ein gewisser empirischer Wahrheitsgehalt bezüglich der Fragestellungen herausgefiltert wird.
Anschließend widmet sich das dritte Kapitel der Forschungsmethode. Hier wird beispielsweise begründet, warum der Forschungsansatz gewählt wurde und mit welchem Erhebungsinstrument die Daten gesammelt wurden. Darauf aufbauend kann dann im vierten Kapitel die Auswertung beginnen. Anknüpfend an die Ergebnisse dieser Arbeit werden auch bildungspolitische Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Zusätzlich wird noch ein didaktischer Teil enthalten sein, für den jedoch keine klassische Aufbereitung für den Unterricht geplant ist, da das Thema für den Einsatz im Unterricht ungeeignet ist. Abschließend werden mit einem Fazit die Ergebnisse dieser Arbeit resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Fragestellungen und Zielsetzung
- Aufbau
- Theoretische Grundlagen und gegenwärtiger Forschungsstand
- Definition und Einordnung der Begriffe
- Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung
- Die Sekundarstufe I im Schulsystem
- Gesetzliche Bestimmungen bei der Eingliederung
- Berechtigung in der BRD
- Menschenrecht auf Bildung
- Eingliederung
- Sprachlern- bzw. Vorbereitungsklassen
- Übergang vom Sprachlern- in den Regelunterricht
- Gegenwärtiger Forschungsstand
- Daten und Fakten
- Humankapital-Theorie
- Nachteile durch den Akteur Schule und institutionelle Diskriminierung
- Defizitorientierte Wahrnehmung
- Methode
- Qualitative Forschung als Forschungsansatz
- Narratives Interview als Erhebungsinstrument
- Begründung für die Wahl des narrativen Interviews
- Vorbereitung
- Rahmenbedingungen für die Durchführung
- Analyse der Interviews
- Transkription
- Grundlegende Prinzipien im Forschungsprozess
- Narrationsanalyse
- Datenkorpus und Rekrutierung der Untersuchungsteilnehmer
- Auswertung und Ergebnisse
- Interview A
- Interview B
- Interview C
- Kontrastive Vergleiche
- Handlungsempfehlungen
- Didaktischer Kontext
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in das deutsche Schulsystem. Dabei fokussiert sie sich auf Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Das Ziel der Arbeit ist es, die Erfahrungen und Herausforderungen dieser Gruppe im Bildungssystem zu erforschen und mögliche Handlungsempfehlungen für die schulische Praxis abzuleiten.
- Herausforderungen und Chancen der schulischen Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung
- Die Rolle der Schule und des Bildungssystems bei der Integration
- Die Bedeutung von Sprachförderung und interkulturellem Lernen
- Individuelle Erfahrungen und Perspektiven von Schülerinnen und Schülern mit Fluchterfahrung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die schulische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Fragestellungen und die Zielsetzung der Untersuchung. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen und der gegenwärtige Forschungsstand zur Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in das deutsche Schulsystem beleuchtet. Dabei werden u.a. die gesetzlichen Bestimmungen, die Bedeutung des Menschenrechts auf Bildung und verschiedene Integrationsmodelle betrachtet.
Im dritten Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit dargestellt. Es wird erläutert, warum die qualitative Forschung und das narrative Interview als Forschungsansatz und -instrument gewählt wurden. Die Vorbereitung und Durchführung der Interviews sowie die anschließende Analyse der gewonnenen Daten werden beschrieben.
Die Kapitel vier und fünf präsentieren die Auswertung und Ergebnisse der Interviews, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurden. Es werden die Erfahrungen und Perspektiven von drei Schülerinnen und Schülern mit Fluchterfahrung dargestellt, die in der Sekundarstufe I lernen. Die Ergebnisse der Interviews werden anhand verschiedener Kategorien analysiert und mit Blick auf die Fragestellungen der Arbeit interpretiert.
Das sechste Kapitel beinhaltet Handlungsempfehlungen für die schulische Praxis. Es werden konkrete Vorschläge zur Optimierung der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung gemacht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche: Eingliederung, Fluchterfahrung, Schule, Sekundarstufe I, Integration, Sprachförderung, interkulturelles Lernen, qualitative Forschung, narratives Interview, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen haben Schüler mit Fluchterfahrung im deutschen Schulsystem?
Schüler stehen vor sprachlichen Barrieren, psychischen Belastungen durch die Flucht und der Herausforderung, sich in ein neues Bildungssystem zu integrieren.
Was sind Sprachlern- bzw. Vorbereitungsklassen?
Dies sind spezielle Klassen, in denen neu zugewanderte Kinder zunächst intensiv Deutsch lernen, bevor sie in den Regelunterricht übergehen.
Welche Rolle spielt das Menschenrecht auf Bildung?
Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Bestimmungen und die Verpflichtung der BRD, allen Kindern – unabhängig vom Aufenthaltsstatus – Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Was ist institutionelle Diskriminierung im Schulkontext?
Dies bezieht sich auf Nachteile, die Schüler durch die Strukturen der Schule erfahren können, oft geprägt durch eine defizitorientierte Wahrnehmung seitens der Institution.
Wie wurde die Untersuchung in dieser Masterarbeit durchgeführt?
Es wurden qualitative narrative Interviews mit Schülern der Sekundarstufe I geführt, um deren persönliche Perspektiven und Erfahrungen einzufangen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit für die Praxis?
Die Arbeit schlägt bildungspolitische und didaktische Maßnahmen vor, um den Übergang vom Sprachlern- in den Regelunterricht zu optimieren und interkulturelles Lernen zu fördern.
- Quote paper
- Mahmud Tunc (Author), 2020, Die Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in das deutsche Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999693