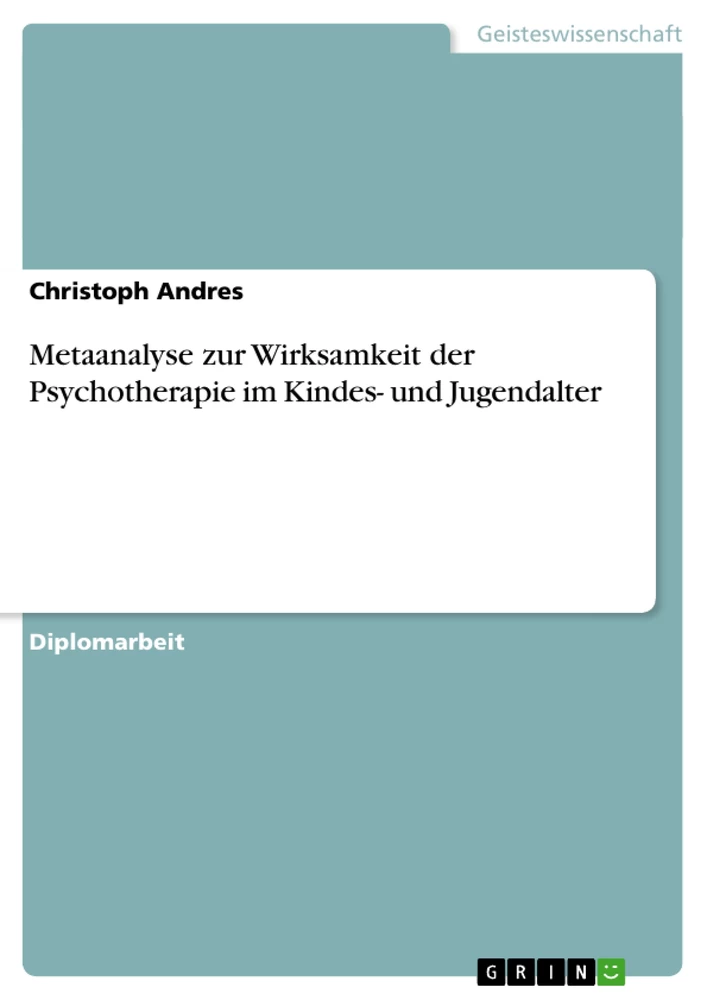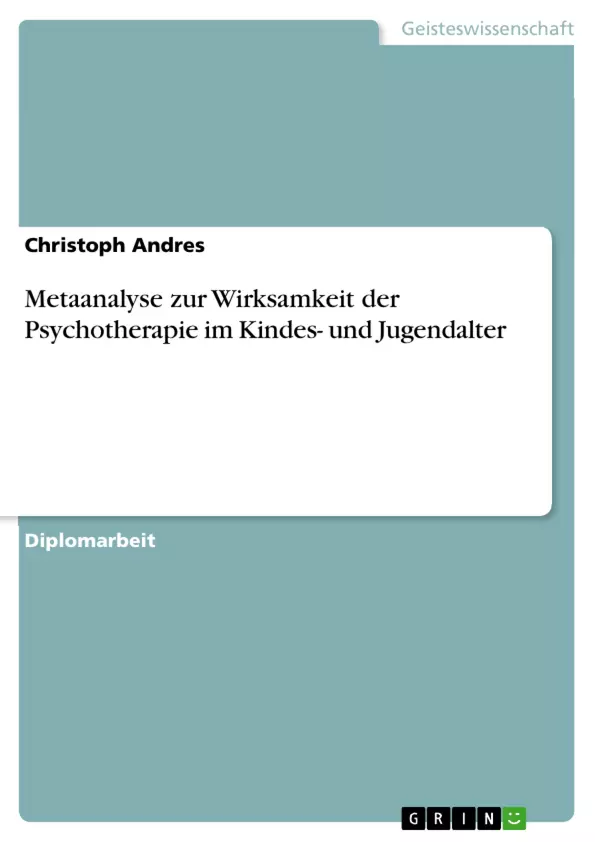Einleitung: Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu überprüfen, ob die Wirksamkeit von Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter vorausgegangener Untersuchungen mit neueren Psychotherapiestudien evident ist und durch welche Moderatoren sich Behandlungsunterschiede zwischen den Professionalitätsgraden der Therapeuten erklären lassen.
Methode: Zur Ermittlung der Psychotherapiewirksamkeit sowie Wirkung unterschiedlicher Professionalitätsgrade sind 138 Primärstudien einbezogen worden. Diese sind unter einer vielzahl von Moderatoren kodiert und analysiert worden.
Ergebnisse: Es resultierte eine mittlere Gesamteffektstärke von d = 0,73 über alle einbezogenen Studien hinweg. Die Analyse auf Homogenität der Studien zeigte klar eine Heterogenität der Studieneffekte an. Es folgte die Eruierung verschiedenster Moderatoren. Es fanden sich eine Reihe signifikanter Unterschiede, u.a. Einfluss der Therapieklasse, Familie, des Professionalitätsgrades der Therapeuten, Studienherkunft sowie Alter der Behandelten Kinder und Jugendlichen. Die statistischen Analysen mündeten in einer Regressionsanalyse, die zu 37,4% Varianz der Psychotherapie aufzuklären vermochte.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER HINTERGRUND
- Definition Psychotherapie
- Psychotherapieforschung
- Gütekriterien psychotherapeutischer Evaluationsforschung
- Behandlungsintegrität von Psychotherapien
- Supervision
- Behandlungsmanuale
- Therapeutenvariablen
- Evidenzbasierung und -graduierung von Psychotherapie
- Forschung und Praxis der Psychotherapie
- Wirksamkeitsbeurteilung
- Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter
- Besonderheiten
- Ergebnisse der Psychotherapieforschung
- Integrative Forschungsmethoden - Metaanalysen
- Definition der Metaanalyse
- Methodenkritische Anmerkungen
- Allgemeines Vorgehen
- Problemformulierung
- Literaturrecherche
- Bewertung der Ergebnisse
- Klassifikationsmerkmale
- Analyse und Interpretation der Ergebnisse
- Effektstärkenberechnung
- Fail-safe-N-Berechnung
- Prüfung der Homogenität von Effektstärken
- Varianzzerlegung im Modell heterogener Effekte
- Moderatorsuche
- Präsentation der Ergebnisse
- FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN
- Allgemeine Wirksamkeit der Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter
- Untersuchung des Einflusses verschiedener Moderatoren auf den Behandlungseffekt
- Therapieklasse
- Einbezuges der Familie
- Therapiemodalität
- Schweregrad der Störung
- Behandelter Problemtyp
- Geschlecht der Behandelten
- Alter der Behandelten
- Erfahrung des Therapeuten
- Therapieintegrität
- METHODEN
- Ablauf der Analyse
- Problemformulierung
- Sammlung der Primärstudien
- Bewertung der Primärstudien
- Studienbewertung
- Studienkodierung
- Analyse und Interpretation der Primärstudien
- Vorstellung der Stichprobe
- Studienmerkmale
- Merkmale der Teilnehmer
- Merkmale des Studiendesigns
- Merkmale der Behandlung
- Informationen zur Ergebnismessung
- Ablauf der Analyse
- ERGEBNISSE
- Allgemeine Wirksamkeit der Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter
- Moderatoren des Psychotherapieeffektes
- Therapieklasse
- Einbezug der Familie
- Therapiemodalität
- Schweregrad der Störung
- Behandelter Problemtyp
- Geschlecht der Behandelten
- Alter der Behandelten
- Erfahrung des Therapeuten
- Therapieintegrität
- Post-hoc-Qualitätsanalyse der vorliegenden Daten
- Regressionsanalyse reduzierter Daten
- DISKUSSION
- Allgemeine Wirksamkeit von Psychotherapie
- Moderatoren des Therapieeffektes
- Therapiemerkmale
- Klientenmerkmale
- Therapeutenmerkmale
- Methodenkritische Bemerkungen
- Ausblick
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Wirksamkeit von Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter. Ziel der Arbeit ist es, die vorhandenen Forschungsdaten zur Wirksamkeit von Psychotherapie in diesem Bereich zu aktualisieren und anhand einer Metaanalyse die Effekte verschiedener Moderatoren auf den Behandlungserfolg zu untersuchen.
- Bewertung der allgemeinen Wirksamkeit von Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter
- Analyse von Moderatoren des Behandlungseffekts, wie z.B. Therapieklasse, Einbezug der Familie und Therapiemodalität
- Untersuchung des Einflusses von Klientenmerkmalen, wie Alter, Geschlecht und Schweregrad der Störung
- Bewertung der Rolle von Therapeutenmerkmalen wie Erfahrung und Therapieintegrität
- Integration und kritische Diskussion der Ergebnisse im Kontext der aktuellen Psychotherapieforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Einleitung" erläutert die Relevanz der Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter und führt in die Fragestellungen und Zielsetzung der Arbeit ein.
- Im Kapitel "Theoretischer Hintergrund" werden grundlegende Definitionen und Konzepte der Psychotherapie und Psychotherapieforschung behandelt, einschließlich der Gütekriterien psychotherapeutischer Evaluationsforschung, der Behandlungsintegrität, der Evidenzbasierung und der Metaanalyse als integrative Forschungsmethode.
- Das Kapitel "Fragestellungen und Hypothesen" formuliert die spezifischen Forschungsfragen der Arbeit und leitet die Hypothesen ab, die im Rahmen der Metaanalyse überprüft werden sollen.
- Das Kapitel "Methoden" beschreibt detailliert die Vorgehensweise bei der Durchführung der Metaanalyse, inklusive der Sammlung und Bewertung von Primärstudien, der Analyse der Daten und der statistischen Methoden.
- Im Kapitel "Ergebnisse" werden die Ergebnisse der Metaanalyse präsentiert, einschließlich der allgemeinen Wirksamkeit von Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter und der Effekte verschiedener Moderatoren auf den Behandlungserfolg.
Schlüsselwörter
Psychotherapie, Kindes- und Jugendalter, Metaanalyse, Wirksamkeit, Moderatoren, Behandlungseffekt, Therapieklasse, Einbezug der Familie, Therapiemodalität, Schweregrad der Störung, Geschlecht, Alter, Erfahrung des Therapeuten, Therapieintegrität.
- Quote paper
- Christoph Andres (Author), 2009, Metaanalyse zur Wirksamkeit der Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156509