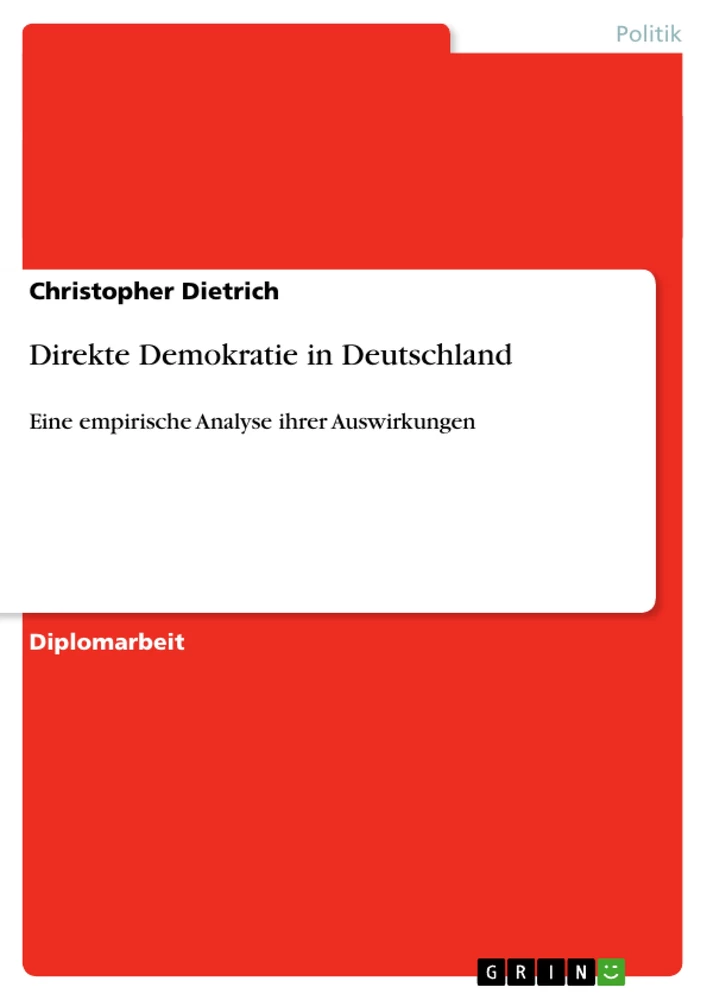Wie der Titel dieser Arbeit schon sagt, beschäftigt sie sich mit der Direkten Demokratie in Deutschland. Doch ist eine Analyse dieser sehr breit angelegten Thematik nicht nur aus einer einzelnen Sichtweise möglich. Es genügt nicht nur die Formen und Anwendungsmöglichkeiten zu nennen. Eine historische Betrachtung, die wir gleich zu Anfang vornehmen, führt in die heutige Zeit und soll einem Gesamtüberblick gleichen. Die Direkte Demokratie besteht in Staaten wie Deutschland, einem föderalistischem Gebilde, auf drei Ebenen. Der des Bundes, der Länder und der Kommunen.
Nacheinander werden alle drei auf ein Vorkommen an unmittelbarer Demokratie untersucht. Der fachkundige Leser weiß schon jetzt, dass die Direktdemokratie auf Bundesebene in der BRD nicht existent ist. Doch finden sich eine Reihe von Grundsatzdiskussionen über ein Für und Wider in der Literatur vor. Darum wird sowohl Befürwortern als auch Kritikern die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern. Neben den einzelnen Regelungen zur Anwendung stehen vor allem Diskussionen über deren Idee und Sinn im Mittelpunkt. Stets begleitet von grafischen Übersichten, wird der Leser durch den dichten Wald der Diskussionen, Regeln und Methoden geführt. Gegen Ende wird zudem auf die Auswirkungen Direkter Demokratie eingegangen. Die Staatstätigkeit wird sowohl in Bezug auf den Haushalt als auch die Durchsetzung privater Investitionen in den Städten und Gemeinden untersucht. Die zentrale Frage dieses letzten Kapitels wird lauten, ob die Anwendung Direkter Demokratie die Staatsausgaben in eine nicht akzeptable Höhe treibt und ob gleichzeitig Investoren davon abgehalten werden ihre Projekte umzusetzen. Viele Kritiker befürchten in vielerlei Hinsicht, die Bürger seien nicht kompetent genug, eine Republik nach ihrem Ermessen zu gestalten. Doch sollte eines nie vergessen werden: Es waren immer die Menschen, die Staaten errichteten, nicht die Regierungen, wenngleich deren Einfluss groß sein kann. Die Direkte Demokratie in Deutschland stellt zudem keinen Plan zur Generalüberholung des politischen Systems dar. Sie ist als ergänzendes Element zum repräsentativen System gedacht.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Teil: Die Geschichte der Direkten Demokratie nach dem 2.Weltkrieg
1.1 Die Geschichte der direkten Demokratie der BRD von 1945 bis 1989
1.2 Die Geschichte der direkten Demokratie der DDR von 1945 bis 1989
1.2.1 Die Verfassungvon 1949
1.2.2 Die Verfassungvon 1968
1.2.3 Die Verfassungsrevisionvon 1974
1.2.4 Die Neue VerfassungderDDR
1.2.5 Scheinplebiszite inderDDR
1.3 Verfassungsreform beiWiedervereinigung
2. Teil: Die Direkte Demokratie in Deutschland
2.1 DieDirekteDemokratieaufBundesebene
2.1.1 Die Interpretation von Art. 20 GG
2.1.2 Direkte Demokratie als Reformbeschleuniger?
2.1.3 Die Argumentation des Deutschen Bundestages
2.1.4 Direkte Demokratie in der Weimarer Republik
2.1.5 Die Vorteile der Direkten Demokratie
2.1.6 Die Nachteile der Direkten Demokratie
2.1.7 Der Informationsgrad der Bürger
2.1.8 DasAbstimmungsheft
2.1.9 Der Vorschlag von Mehr Demokratie e.V.
2.2 Die Direkte Demokratie in den deutschen Bundesländern
2.2.1 Elementare Begriffe der Direkten Demokratie aufLandesebene
2.2.2 Die Quorenproblematik
2.2.3 Direkte Demokratie aufLandesebene: Eine Übersicht
2.2.4 Amtseintragung vs. freie Unterschriftensammlung
2.2.5 Eine Bilanz zur DirektenDemokratie aufLandesebene
2.2.6 Kurze Zusammenfassung zur Bilanz aufLandesebene
2.2.7 Themenbereiche Direkter Demokratie aufLandesebene
2.2.8 Themenausschlüsse: Das Finanztabu
2.2.9 Die Akteure von Initiativen und die Kostenerstattung
2.2.10 Ergebnisse und Erfolge Direkter Demokratie aufLandesebene
2.3 Die DirekteDemokratie aufKommunalebene
2.3.1 Elementare Begriffe der Direkten Demokratie aufKommunalebene
2.3.2 Direkte Demokratie aufKommunalebene: Eine Übersicht
2.3.3 Themenbereiche Direkter Demokratie aufKommunalebene
2.3.4 Ergebnisse und Erfolge Direkter Demokratie aufKommunalebene
2.3.5 Die Abstimmungsbeteiligung auf kommunaler Ebene
3. Teil: Auswirkungen Direkter Demokratie auf die Staatstätigkeit
3.1 Die Finanzreferenden in der Schweiz
3.2 Neuerungen oder Status quo: Der Fall Bayern
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abb.l: Regelungen zu Volksbegehren und Volksentscheid in den deutschen Bundesländern
Abb.2: Zeitreihe über neu eingeleitete Volksbegehren in den Bundesländern vonl995-2008
Abb.3: Regionale Verteilung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Volkspetitionen
Abb.4: Regionale Häufigkeitsverteilung von Volksbegehren und Volksentscheiden nach zeitlicher Regelmäßigkeit
Abb.5: Gesamtzahl direktdemokratischer Verfahren samt Volkspetitionen vonl946-2008l
Abb.6: Themenbereiche von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volkspetitionen in 2008 sowie von 1946-2008
Abb.7: Gesamtverteilung der Themen aller Volksbegehren und Volkspetitionen (n =266) von 1946-2008
Abb.8: Kostenerstattungsregelungen in den deutschen Bundesländern
Abb.9: Ergebnisse aller 2008 abgeschlossenen Verfahren ohne Volkspetitionen und insgesamt
Abb.10: Die 15 Volksentscheide aufgrund vonVolksbegehren in den deutschen Bundesländern
Abb.ll: Regelungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in den deutschen Bundesländern inklusive Ratsreferenden
Abb.l2: Regionale Verteilung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsreferenden nach Bundesländern
Abb.l3: Die TopTen der Gemeinden bei der Anwendung der Direkten Demokratie
Abb.l4: Anzahl eingeleiteter Verfahren gestaffelt nach Gemeindegröße
Abb.l5: Relative Häufigkeit direktdemokratischer Verfahren auf Kommunalebene
Abb.l6: Themenbereiche kommunaler Direktdemokratie und Anzahl der Verfahren dazu
Abb.l7: Ergebnisse aller direktdemokratischen Verfahren bis3l.l2.2007
Abb.l8: Ergebnisse von Bürgerentscheiden aufgrund von Volksbegehren und Ratsreferenden bis Ende 2007
Abb.l9: Die durchschnittliche Abstimmungsbeteiligung bei Bürgerentscheiden gestaffelt nach Gemeindegrößel
Abb.20: Anzahl und Anteil an Verfahren, die das Themenfeld Privatinvestitionen betreffen
Abb.2l: Betrachtung aller 68 Verfahren aus 2006 und 2007 in Bezug auf Pro oder Kontra zur Investition
Abb.22: Betrachtung aller 68 Verfahren aus 2006 und 2007 samt Bürgerentscheid in Bezug auf Pro oder Kontra zur Investition
Einleitung
Wie der Titel dieser Arbeit schon sagt, beschäftigt sie sich mit der Direkten Demokratie in Deutschland. Doch ist eine Analyse dieser sehr breit angelegten Thematik nicht nur aus einer einzelnen Sichtweise möglich. Es genügt nicht nur die Formen und Anwendungsmöglichkeiten zu nennen. Eine historische Betrachtung, die wir gleich zu Anfang vornehmen, führt in die heutige Zeit und soll einem Gesamtüberblick gleichen. Die Direkte Demokratie besteht in Staaten wie Deutschland, einem föderalistischem Gebilde, auf drei Ebenen. Der des Bundes, der Länder und der Kommunen. Nacheinander werden alle drei auf ein Vorkommen an unmittelbarer Demokratie untersucht. Der fachkundige Leser weiß schon jetzt, dass die Direktdemokratie auf Bundesebene in der BRD nicht existent ist. Doch finden sich eine Reihe von Grundsatzdiskussionen über ein Für und Wider in der Literatur vor. Darum wird sowohl Befürwortern als auch Kritikern die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern. Neben den einzelnen Regelungen zur Anwendung stehen vor allem Diskussionen über deren Idee und Sinn im Mittelpunkt. Stets begleitet von grafischen Übersichten, wird der Leser durch den dichten Wald der Diskussionen, Regeln und Methoden geführt. Gegen Ende wird zudem auf die Auswirkungen Direkter Demokratie eingegangen. Die Staatstätigkeit wird sowohl in Bezug auf den Haushalt als auch die Durchsetzung privater Investitionen in den Städten und Gemeinden untersucht. Die zentrale Frage dieses letzten Kapitels wird lauten, ob die Anwendung Direkter Demokratie die Staatsausgaben in eine nicht akzeptable Höhe treibt und ob gleichzeitig Investoren davon abgehalten werden ihre Projekte umzusetzen. Viele Kritiker befürchten in vielerlei Hinsicht, die Bürger seien nicht kompetent genug, eine Republik nach ihrem Ermessen zu gestalten. Doch sollte eines nie vergessen werden: Es waren immer die Menschen, die Staaten errichteten, nicht die Regierungen, wenngleich deren Einfluss groß sein kann. Die Direkte Demokratie in Deutschland stellt zudem keinen Plan zur Generalüberholung des politischen Systems dar. Sie ist als ergänzendes Element zum repräsentativen System gedacht.
1. Teil: Die Geschichte der Direkten Demokratie nach dem 2.Weltkrieg
Zu Beginn wollen wir uns einen kurzen historischen Überblick über die Entstehung der Direkten Demokratie in Deutschland verschaffen. Dazu ist eine differenzierte Betrachtung beider deutscher Teilstaaten nach dem 2.Weltkrieg erforderlich. Aus diesem Anlass wird im folgenden Kapitel zunächst die Bundesrepublik und im Anschluss daran die Deutsche Demokratische Republik sowie deren Beziehung zur Direkten Demokratie historisch beleuchtet. Münden wird die Geschichte beider Staaten in der Wiedervereinigung bzw. der Verfassungsrevision.
1.1 Die Geschichte der Direkten Demokratie der BRD von 1945 bis 1989
Die Geschichte der Direkten oder sachunmittelbaren Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland fand vor dem Beschluss des Grundgesetzes vor allem auf Landesebene statt. In der sogenannten ersten Phase von 1947 bis 1950 waren ausnahmslos direktdemokratische Elemente in den Verfassungsentwürfen zu finden. Dies galt sowohl für einfache als auch für verfassungsändernde Gesetze. Die einzige Ausnahme auf Länderebene bildete die Verfassung des Landes Württemberg-Baden. Hier waren keinerlei direktdemokratische Elemente zu finden. In der zweiten Phase der Verfassungsgebung von 1949 bis 1952 wurde jedoch auf Anleitung des Parlamentarischen Rates eine in der Literatur gerne zitierte „plebiszitäre Quarantäne“1 verhängt. Diese sah im Grundgesetz nicht eine einzige sachunmittelbare Komponente vor. Lediglich in der Ausgestaltung von Personenwahlen konnte laut Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG auf unmittelbar demokratische Elemente zurückgegriffen werden.
In den 50er Jahren kam es dann bereits zu ersten großen Debatten und öffentlichen Diskussionen über die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene. Man bezeichnet diese Epoche daher auch als die „erste Welle“ direktdemokratischer Forderungen auf Bundesebene. Anlass hierfür waren die Wieder- bzw. die Atombewaffnung der Bundeswehr, die Gründung eines Südwest-Staates, der aus den Ländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern hervorgehen sollte, sowie die Frage über die Zugehörigkeit un]d den Status des Saarlandes, welches noch bis 1957 nicht zur Bundesrepublik gehören sollte. Von diesen soeben genannten Gründen soll hierjedoch nur kurz auf den ersteren näher eingegangen werden.
Im Zuge der Wiederbewaffnung formierte sich Widerstand sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch unter Wissenschaftlern, welche auf die besonderen Gefahren nuklearer Waffen verwiesen. Dies war wenig verwunderlich, da die Schrecken des letzten Krieges noch immer in den Köpfen der Bevölkerung saßen, wenngleich man die Bundeswehr nicht mit der Wehrmacht verwechseln sollte. Organisiert wurde dieser Widerstand im sogenannten „Nauheimer Kreis“2, der sich am 20. Januar 1951 für eine Volksabstimmung mit dem Namen „Aufruf gegen Wiederausrüstung und für allgemeinen Friedensschluss“ stark machte. Die Volksbefragung wurde jedoch von der Bundesregierung unter Bundeskanzler Adenauer verboten. Dieser forderte in der Sache Gleichheit mit allen anderen Nato-Partnern. Insbesondere die Atombewaffnung zielte darauf ab, alle nicht-amerikanischen Nato-Mitglieder nuklear zu bewaffnen. Der Bundestag stimmte der Wiederbewaffnung zu, was wiederum zu Protesten in der Bevölkerung führte. Ein von der SPD in den Bundestag eingebrachter „Gesetzesentwurf zur Volksbefragung wegen einer atomaren Ausrüstung der Bundeswehr“3 fand keine Mehrheit. Auch die Bundesländer, die ihrerseits die Einführung einer Volksgesetzgebung hätten vorantreiben können, verhielten sich zum damaligen Zeitpunkt still und zurückhaltend.
Daran sollte sich auch in 60er Jahren wenig ändern. Sowohl die öffentliche als auch die verfassungspolitische Diskussion über die sachunmittelbare Demokratie fiel auf ein niedriges Niveau ab. Verstummen sollten die Forderungen nach mehr Direkter Demokratie auf Sachebene jedoch nicht. Selbst die Studentenproteste der 68er Generation, welche zwar mehr Direkte Demokratie forderten, trugen nicht oder nur wenig zur wissenschaftlichen Diskussion bei.
Mitte der 70er Jahre jedoch kam es zu ersten Aufhellungen am direktdemokratischen Horizont. Baden Württemberg führte 1974 die Volksgesetzgebung ein. Doch Berlin tat genau das Gegenteil und strich die Volksgesetzgebung aus der Landesverfassung. Es war bis dato keine eindeutige Richtung zu erkennen. Ende der 70er formierten sich dann aber zunehmend Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen, welche ihre Forderungen mit Volksentscheiden auf Bundesebene am liebsten durchgesetzt hätten. Im Jahre 1979 folgte dann auch das Saarland bei der Einführung einer Volksgesetzgebung auf Landesebene.
Wirklich spannend wurde es dann wieder mit der sogenannten „zweiten Welle“ an Forderungen nach mehr unmittelbarer Demokratie in den 80er Jahren. Als krönender Höhepunkt gab der Nato-Doppelbeschluss von 1983 den entscheidenden Anlass. Von nun an standen lautstarke Forderungen nach Direkter Demokratie auf der politischen Tagesordnung. Auch ökologieorientierte Bewegungen und Anti-Kernkraftgruppen steigerten das Interesse und trugen zu einer zunehmenden Politisierung der Bevölkerung bei. Doch wie in den 60er Jahren zuvor flachte auch diese Diskussion unter der damaligen von der CDU geführten Regierung ergebnislos ab. Tragische Geschehnisse wie der Reaktorunfall von Tschernobyl sorgten aber dafür, dass die grundsätzliche Diskussion nie ganz erlosch. Doch nach wie vor fehlte es der Direkten Demokratie an einem wissenschaftlichen Unterbau. Dieser sollte sich erst in den Wendejahren bilden. Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre war eine zunehmende Distanzierung zwischen Politikern und Bevölkerung zu beobachten. Dies konnte aufgrund ihrer historischen Bedeutung nicht einmal die Wiedervereinigung Deutschlands aufhalten. Das Ergebnis waren ständig sinkende Wahlbeteiligungen.4 Auch dies gab erneut Anlass einen verfassungspolitischen Wandel von einer in der Literatur zitierten „Zuschauerdemokratie“ hin zu einer „Teilnehmerdemokratie“ (ebenfalls bei Neumann 2009) zu konstituieren. Mit dem politischen Ende der Deutschen Demokratischen Republik nährten sich Hoffnungen auf eine Umgestaltung des Grundgesetzes in Richtung Direkte Demokratie im Zuge der Wiedervereinigung. Die Wendejahre werden in der Diskussion um Direkte Demokratie auch als die „dritte Welle“ bezeichnet. Auf die Hoffnungen und die Resultate dieser lang anhaltenden Diskussion wird in Kapitel 2 dann näher eingegangen. Zuvor werfen wir einen Blick auf die verfassungspolitische Geschichte der DDR und den damit verbundenen direktdemokratischen Elementen.
1.2 Die Geschichte der Direkten Demokratie der DDR von 1945 bis 1989
Der Entwurf einer ersten Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik lag bereits am 14. November 1946 auf dem Tisch. Dieser sah noch nicht eine Abtrennung der DDR von der Bundesrepublik vor. Vielmehr wurde versucht, direkten Einfluss auf Westdeutschland bzw. die besetzten Gebiete auszuüben. Dieser Versuch scheiterte jedoch frühzeitig am Widerstand der westdeutschen Länder. Der Inhalt des vorliegenden Entwurfs war im Vergleich zu späteren DDR-Verfassungen mit vielerlei bürgerlichen Eigenheiten versehen, ähnlich wie in der Weimarer Republik. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl direktdemokratischer Elemente geregelt wie beispielsweise die Volksgesetzgebung, wie sie auch in allen ostdeutschen Landesverfassungen geregelt war. Diese umfasste sowohl einfache als auch verfassungsändernde Gesetzesvorhaben. Allerdings wurde die Rechtsstaatlichkeit bereits zu dieser Zeit durch ein Fehlen von Verfassungsgerichten auf Länderebene unterminiert.5 Die Realität für die Anwendung direktdemokratischer Elemente sah ebenfalls trübe aus. Es kam in der Folgezeit nicht einmal zu einer Anwendung der Direkten Demokratie, zumindest nicht auf Meinungsund Entschlussfreiheit basierend. Die sogenannten „Volksabstimmungen“ oder Volksaussprachen (später unter Ulbricht) waren nur Scheinplebiszite oder Akklamationen. Auf diese beiden Begrifflichkeiten wird in Kapitel 1.2.5 noch einmal kurz eingegangen. Doch nun zur eigentlichen historischen Entwicklung der Direkten Demokratie.
1.2.1 Die Verfassung von 1949
Die erste Verfassung der DDR, die sich als „antifaschistische Ordnung“ verstand, war zumindest auf dem Papier von direktdemokratischen Funktionen durchdrungen. Sie regelte neben der Volksgesetzgebung die plebiszitäre Parlamentsauflösung sowie ein fakultatives Referendum. Das Volksgesetzgebungsverfahren war zweistufig ausgestaltet und umfasste ein Volksbegehren samt Volksentscheid. Der Volksentscheid galt als angenommen, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten bzw. der Teilnehmer für die Entscheidung war. Diese Entscheidungen betrafen sowohl einfache als auch verfassungsändemde Gesetze. Themenausschlüsse fanden insofern statt, dass über den Haushaltsplan, die Besoldungsordnung, sowie über die Abgabenordnung kein Volksbegehren auf der ersten Stufe angestrebt werden durfte. Der Ausschlusskatalog entsprach somit dem der Länder. Um ein Volksgesetzgebungsverfahren zu initiieren, mussten zehn Prozent der Stimmberechtigten ein Volksbegehren einleiten. Darüber hinaus waren Parteien, Massenorganisationen oder Verbände, die glaubhaft zwanzig Prozent der Stimmbürger vertreten konnten, zu einer Einleitung des Verfahrens berechtigt. Das einzige Problem jedoch war die Tatsache, dass die hier beschriebenen Verfahren und Regeln später in einem Ausführungsgesetz hätten geregelt werden sollen, um dem Verfassungstext Leben ein zu hauchen. Dieses Ausführungsgesetz wurde nie erlassen.6
Das fakultative Referendum sah vor, dass fünf Prozent der Stimmberechtigten dies beantragen konnten, wenn die Verkündung des Gesetzes durch ein Drittel der Volkskammer ausgesetzt war. Danach konnte es zu einem Volksentscheid kommen. In der Realität kam es aber nie dazu. Auch die plebiszitäre Parlamentsauflösung, auch Parlamentsrecall genannt, kam nie zu Stande.
1.2.2 Die Verfassung von 1968
Die zweite Verfassung der DDR trat am 9. April 1968 in Kraft. Diese kennzeichnete sich selbst als eine sozialistische Ordnung im Gegensatz zur „antifaschistischen Ordnung“ der ersten Verfassung. Sie sah nicht länger eine Wiedervereinigung der deutschen Staaten vor. Gegenstand der Ausarbeitung dieses Papiers war eine nahezu völlige Streichung direktdemokratischer Elemente. Nur das fakultative Referendum blieb erhalten. Doch gilt es auch hier die mangelnde Meinungs- und Entschlussfreiheit zu bedenken. Neu eingeführt wurde die sogenannte „Volksdiskussion“7 zur Erörterung einfacher Gesetze. Die Ablehnung des Gesetzes war aber auch hierbei nicht möglich. Erörtert wurde auch nicht von der Vielzahl der Stimmberechtigten, sondern von Parteikreisen, Kommissionen und allem was der Regierung freundlich gesinnt war.
1.2.3 Die Verfassungsrevision von 1974
Nach der Entmachtung Walter Ulbrichts und dem Beginn der Ära Honecker änderte sich durch die Revision der zweiten Verfassung in direktdemokratischer Hinsicht nicht viel. Das fakultative Referendum blieb erhalten. Dies musste auch niemanden in der Regierung stören, da es bereits, wie in der Vergangenheit auch, von nun an nie in der Verfassungswirklichkeit vorkam.
1.2.4 Die Neue Verfassung der DDR
Kurz vor dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik versuchte man von Staatsseite das sinkende Schiff noch zu retten. Der „Zentrale Runde Tisch“8, der sich am 7. Dezember 1989 konstituierte, bestehend aus Regierungs- und Parteimitgliedern der SED, beauftragte die Arbeitsgruppe „Neue Verfassung der DDR“ damit, eine neue Rechtsgrundlage für den zusammenbrechenden Staat zu entwerfen. Die Annahme der vierten Verfassung war ursprünglich für 17. Juni 1990 geplant und sollte durch Volksentscheid zu Stande kommen. Zu dieser Entscheidung sollte es aber nie kommen, da die Landtagswahlen im Zuge der Wiedervereinigung auf den 18. März 1990 vorverlegt wurden. Der Grund für die Vorverlegung lag einfach im massiven Druck der Bürger Ostdeutschlands, welche die Einheit so schnell wie möglich verlangten. Außerdem überschlugen sich die politischen Ereignisse jener Zeit, so dass von politischer Planbarkeit kaum noch die Rede sein konnte. Dennoch ist der Entwurf der Arbeitsgruppe und des Runden Tisches einen Blick wert. Auch hierbei soll es genügen auf die direktdemokratischen Eigenschaften des Entwurfs einzugehen, da sonst der Rahmen dieser Arbeit deutlich gesprengt würde.
Der Verfassungsentwurf sah neben einer Volksgesetzgebung ein obligatorisches Referendum über verfassungsändernde Gesetze durch die Volkskammer vor, sowie eine Verfassungsannahme durch Volksentscheid. Die Volksgesetzgebung war zweistufig ausgestaltet, also mit Volksbegehren und nachfolgendem Volksentscheid. Im Vergleich zur ersten Verfassung der DDR beschränkte sich die Volksgesetzgebung auf einfache Gesetze. Ein Volksentscheid im Anschluss an das Volksbegehren war unzulässig, wenn die Volkskammer den Vorschlag des Volkes binnen drei Monaten angenommen hatte. Bei der Abstimmung galt das Mehrheitsprinzip. Zudem sollte nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden.
Das obligatorische Verfassungsreferendum fur verfassungsändernde Gesetze durch die Volkskammer verlangte zunächst eine Zweidrittelmehrheit der Kammer selbst. Im Anschluss sollte dann der Volksentscheid folgen, wobei auch hier das Mehrheitsprinzip die Grundlage bildete. Beteiligungs- oder Zustimmungsquoren waren nicht vorgesehen. Diese Form der Verfassung, die auch außerhalb der direktdemokratischen Sphäre mit früheren Modellen nicht vergleichbar war, auch was die Bürgerrechte betraf, stieß im konservativen Lager auf Ablehnung. Ein Grund hierfür war die nicht repräsentative Besetzung des Runden Tisches. Ein anderer war die Angst vor einer verzögerten Wiedervereinigung durch Inkrafttreten einer neuen Verfassung der DDR. Denn nach den Parolen der Protestler, die auf einmal nicht länger „Wir sind das Volk“ lauteten, sondern vielmehr „Wir sind ein Volk“, war spätestens klar geworden, dass die DDR als separater Staat nicht länger zu halten war. Somit fand der Entwurf in der Volkskammer nach den ersten freien Wahlen auch keine Mehrheit. Anjenem 26. April 1990 waren die Tage der Deutschen Demokratischen Republik verfassungsmäßig gezählt.
Bevor wir uns nun der weiteren Entwicklung der ostdeutschen Landesverfassungen, sowie der Revision des Grundgesetzes im Hinblick auf Direkte Demokratie zuwenden, sei noch ein letzter Blick auf die Volksentscheidungen in der DDR geworfen.
1.2.5 Scheinplebiszite in der DDR
Wenn man von einem Scheinplebiszit spricht, dann ist damit immer eine Volksabstimmung oder ein Volksentscheid gemeint, welcher nicht auf Meinungs- und Entschlussfreiheit beruht oder bei dem zumindest die Gefahr besteht, staatlicher Willkür im Falle einer Ablehnung oder Annahme des Vorschlags ausgesetzt zu sein. Diese Scheinplebiszite werden und wurden gerne von Diktaturen verwendet, um ein positives Signal hinsichtlich der Situation im eigenen Land in die Außenwelt zu senden.9 Und darüber hinaus um Systemgegner im eigenen Land zu identifizieren, die den Mut besaßen sich offensichtlich gegen das Regime zu stellen. Neben den Scheinplebisziten im Dritten Reich waren diese auch in der DDR zu finden, wenn auch unter anderer politischer Motivation. Für die ostdeutsche SED-Diktatur seien vier ausgewählte Scheinabstimmungen betrachtet. Die erste fand schon im Jahre 1946 statt. Das sächsische Enteignungsplebiszit „über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes“10 noch vor der ersten Landtagswahl. Der Beweis dafür, dass es sich um ein Scheinplebiszit handelt, ist leicht zu erbringen. Da weder ein Gesetzgebungsorgan gewählt, noch eine verfassungsrechtliche Bestimmung vorhanden war, existierte auch keine Legitimationsgrundlage bzw. gar kein Grund für einen Volksentscheid.
Das nächste Scheinplebiszit stammt vom 27. - 29. Juni 1954. Damals lautete die Frage: „Sind Sie für einen Friedensvertrag und Abzug der Besatzungstruppen oder für EVG, Generalvertrag und Belassung der Besatzungstruppen auf 50 Jahre?“11 Schon alleine die Frage ist an Polemik kaum zu übertreffen. Verfassungsrechtlich bestand auch hierbei keine Legitimation. Hinzu kommt, wie zu häufig in der DDR, die eingeschränkte Meinungs- und Entschlussfreiheit.
Eine weitere Form Direkter Demokratie entstand zu Regierungszeiten Walter Ulbrichts von 1961 bis 1968. Die sogenannten „Volksaussprachen“12 zur Erörterung einfacher Gesetze waren in keiner Weise Formen basisdemokratischer Herrschaft und Legitimation. Sie wurden organisiert von der Parteizentrale und dienten nur als Forum für systemtreue Bürger der DDR.
Um ein letztes Beispiel für ein Scheinplebiszit zu nennen, sei der Volksentscheid vom 6. April 1968 aufgegriffen. Das Stimmvolk hatte über die zweite Verfassung zu „urteilen“. Das bahnbrechende Ergebnis mit einer Zustimmung von 94,49 Prozent13 für die Einführung der zweiten DDR-Verfassung lässt Zweifel an der Echtheit des Ergebnisses aufkommen. Es ist für sich gesehen kein Beweis für ein Scheinplebiszit. Allerdings gilt es auch hier die eingeschränkten Presse-, Meinungs- und Entschlussfreiheiten zu bedenken bzw. auch die potentiellen Bestrafungen für Abweichler.
Zusammenfassend sei für die Scheinplebiszite eines gesagt: Sie als Argument gegen direktdemokratische Elemente - in heutiger Zeit, in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer von stabilen demokratischen Verhältnissen geprägten Staatsstruktur - zu verwenden, ist nicht haltbar. Volksabstimmungen wie sie beispielsweise in der Schweiz, in Australien oder in Kalifornien stattfinden, haben mit den Scheinplebisziten der DDR und des Dritten Reiches und anderer Diktaturen nicht das Geringste zu tun. Es ist sinnvoll sich an sie zu erinnern und Regelungen zu treffen, damit es nicht dazu kommt. Jedoch entspricht es nicht dem Zeitgeist, das Scheinplebiszit als Hauptargument gegen Direkte Demokratie zu verwenden, so wie dies teilweise noch vorkommt.14
1.3 Verfassungsreform bei Wiedervereinigung
Im Rahmen der Wiedervereinigung zwischen den beiden deutschen Staaten stellte sich aus verfassungspolitischer Sicht eine wesentliche Frage: Beitritt der Länder Ostdeutschlands nach Art. 23 GG oder Volksabstimmung über eine neue Verfassung nach Art. 146 GG? Der Streit über diese Frage sorgt auch heute noch in diversen Diskussionsrunden zum Thema Einheit für Zündstoff.15 Denn was mit einer verfassungsgebenden Versammlung und dem damit verbundenen Volksentscheid an Elementen Direkter Demokratie ins Grundgesetz bzw. dann in die Verfassung hätte eingehen können, ist im Vergleich zur heutigen Verfassungssituation kaum vorstellbar. Stattdessen entschied man sich für die erste Variante, also Beitritt der „neuen Länder“. So kam es am 23. August 1990 zu einem Volkskammerbeschluss, der den Beitritt der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und MecklenburgVorpommern vorsah.
Um darüber zu diskutieren wie eine gesamtdeutsche Verfassung nach der Wiedervereinigung aussehen könnte, auch im Hinblick auf direktdemokratische Elemente, setzte der Bundesrat die Kommission „ Verfassungsreform“ ein. Sie bestand aus Vertretern der Länder und sah anfangs viele Ideen für mehr Bürgerbeteiligung vor. Ebenso auf der Vorschlagsliste standen Volksbefragungen auf der Bundesebene. Die Volksgesetzgebung (ob zwei- oder dreistufig) stand genauso zur Disposition. Außerdem gab es eine Vielzahl an Bürgern und Bürgervereinigungen, die Vorschläge und Anregungen für eine neue Verfassung geben konnten und die dieses Recht auch beanspruchten. Alleine dieser Umstand, dass gerade das Volk sich intensiv mit der Frage nach einer Verfassungsreform auseinandersetzte, kann als Signal für den Wunsch nach einer stärkeren Bürgerbeteiligung gedeutet werden. Unterstützung erhielt die Bevölkerung auch von Fachkongressen, Wissenschaftlern und sogar vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.
Nach Sammlung aller Vorschläge beriet eine gemeinsame Kommission aus Bundestag und Bundesrat das erarbeitete Material. Die aus den Ländern bestehende Kommission „Verfassungsreform“ kam schon vorher zu dem Schluss, dass die Aufnahme direktdemokratischer Elemente in das Grundgesetz sinnvoll ist. Schließlich war die Mehrzahl der Länder für eine Aufnahme.
Das Ergebnis der gemeinsamen Kommission aus Bundestag und Bundesrat war ernüchternd. Man konnte sich nicht auf die Einbettung von Elementen sachunmittelbarer Demokratie einigen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung kam nicht zu Stande. Auch kam es nicht zur Empfehlung die Wiedervereinigung nach Art. 146 mit Volksentscheid zu vollziehen. Auch diese Diskussion, bei der es um die Frage nach mehr sachunmittelbarer oder Direkter Demokratie auf Sachebene ging, sollte nie verstummen. Gerade weil die vielen nachfolgenden Reformen im Landesverfassungsrecht sowie auf Kommunalebene immer wieder Anlass zur Wiederaufnahme der Debatte lieferten. Doch sei nochmals nach Gründen gefragt, wieso die gemeinsame Kommission sich nicht einigen konnte und warum man die Wiedervereinigung ohne Volksentscheid implementierte.16 Als erste These sei der Zeitdruck erwähnt, unter dem die Wiedervereinigung stattfand. Wer sich an die damaligen Bilder und Meldungen aus den Nachrichten aus Funk und Fernsehen erinnert, fühlt sich überrollt von Ereignissen, die sich die meisten jahrelang erträumten und die dann innerhalb weniger Monate zu sehen waren. Eine sich mit Gorbatschow schnell wandelnde Sowjetunion gepaart mit Kriegsängsten im Westen für den Fall einer kriegerischen Revolution und Aufständen wie zu den Zeiten des Prager Frühlings. Die Volksvertreter Westdeutschlands konnten einem teilweise leidtun, wenn man bedenkt wie viele Entscheidungen von großer Tragweite innerhalb kürzester Zeit getroffen werden mussten. Und immer die Abwägung: Einheit mit der Gefahr eines Krieges oder Status quo mit Gefahr im Hinblick auf eine „ewige“ Trennung beider deutscher Staaten.
Doch auch unabhängig davon muss man sich die Frage gefallen lassen, ob die Wiedervereinigung Deutschlands nach Art. 146 daran scheiterte, dass man aus Sicht der Volksvertreter sich nicht wirklich sicher war, wie sich das Stimmbürgertum entscheiden würde. Damit soll nicht die These vertreten werden, die behauptet, dass die Mehrzahl der Deutschen gegen die Einheit war. Doch stellen wir uns mal vor, es wäre wirklich so gewesen. Die westdeutsche Bevölkerung ist gegen die Wiedervereinigung, während die ostdeutschen Bürger auf diese drängen. Das Ergebnis hätte in diesem Fall kaum verheerender sein können. Eine schier unüberwindbare Kluft hätte Europa von nun an gespalten. Anstatt einer Mauer hätte ein tiefer innerdeutscher Graben die Teilung Europas erhalten. Schon nach wenigen Sätzen zu diesem Thema möchte man diese Vorstellung aus heutiger Sicht sofort vergessen. Nichtsdestotrotz könnte dies eine Horrorvorstellung gewesen sein, welche die Volksvertreter aus politischen Gründen auf gar keinen Fall riskieren wollten.
Doch bei allem Schutz der Repräsentanten des deutschen Volkes stellt sich weiterhin die Frage, warum auf die Aufnahme direktdemokratischer Elemente nach den zuvor fruchtbaren Diskussionen innerhalb der Kommission „Verfassungsreform“ verzichtet wurde. Gilt die These vom Politiker als Maximierer von Macht und Entscheidungsvermögen? Falls ja, dann hätte die Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen an die Bevölkerung selbstverständlich zu einem Gefühl des Machtverlustes bei den Repräsentanten geführt. Wie auch immer die Volksgesetzgebung ausgestaltet wäre, in jedem Fall hätte die Eitelkeit so mancher Volksvertreter gelitten. Ob dies Gründe dafür sind, dass die Volksgesetzgebung in der vereinten Bundesrepublik immer noch nicht eingeführt wurde - zumindest auf Bundesebene - wird in Kapitel 2.1.7 nochmals näher betrachtet. Dort werden wir uns auch mit der generellen Frage befassen, ob das Volk „befähigt“ ist, Gesetze zu erarbeiten und zu erlassen.
2.Teil: Die Direkte Demokratie in Deutschland
Während Kapitel 1 die Geschichte der Direkten Demokratie zum Ausdruck brachte, handelt das 2. Kapitel von den aktuellen Regelungen sowohl auf Bundes-, Landes-, als auch auf Kommunalebene. Dazu werden zu jeder dieser drei Säulen ausführliche Diskussionen und übersichtliche Darstellungen der einzelnen Spielregeln Direkter Demokratie im Mittelpunkt stehen. Und selbst wenn die Direkte Demokratie auf Bundesebene in Deutschland nicht stattfindet, so halten die Diskussionen darüber seit mittlerweile Jahrzehnten an. So soll Befürwortern und Gegnern dieses Demokratiekonzeptes eine Plattform geboten werden, die Diskussion auch weiterhin am Leben zu erhalten.
2.1 Die Direkte Demokratie aufBundesebene
Die Volksgesetzgebung im Bund ist in der Bundesrepublik Deutschland keine Selbstverständlichkeit wie beispielsweise in der Schweiz, in Italien oder auch in Australien. Sie findet letzten Endes nicht statt. Schuld daran sind letztlich das Grundgesetz und die ihr innewohnende manifestierte „plebiszitäre Quarantäne“, wie sie durch den Parlamentarischen Rat festgelegt wurde. Dennoch lohnt eine Erörterung und Diskussion sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch aus rein argumentativer Sicht. In diesem Kapitel wird daher zunächst Art. 20 Abs. 2 GG im Vordergrund der Untersuchung stehen. Darüber hinaus wird die Frage zu klären sein, inwiefern die Direkte Demokratie als Ausweg aus dem Reformstau dienen kann. Zur Belebung der Debatte wird zudem eine Plenarsitzung des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2006 eine zentrale Rolle in der Diskussion um Direkte Demokratie einnehmen. Im Anschluss daran soll geklärt werden, inwiefern und ob überhaupt die unmittelbare Demokratie zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen hat. Dies ist insofern wichtig zu untersuchen, da dies häufig als Argument gegen Direkte Demokratie auf Bundesebene heutzutage angeführt wird. Als letztes gilt es einen Blick auf die grundsätzlichen Argumente sowohl pro als auch contra Direkter Demokratie zu werfen und einem weiteren Gegenargument, dass Stimmbürger nicht befähigt seien, große Entscheidungen zu fällen, scharf entgegenzutreten. Am Ende des Kapitels wird zudem ein Vorschlag von „Mehr Demokratie e.V.“ untersucht, der die Manifestierung der Volksgesetzgebung auf Bundesebene zum Ziel hat.
2.1.1 Die Interpretation von Art. 20 GG
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.“17 Zum ersten fällt das „und“ zwischen den Begriffen „Wahlen“ und „Abstimmungen“ auf. Demnach wäre die Volksgesetzgebung eine verfassungsmäßige Selbstverständlichkeit. Doch zur Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu untersuchen, wer die Staatsgewalt wirklich ausübt und ob eine Verfassungsänderung notwendig ist um Direkte Demokratie zu ermöglichen.
Mit dem Wort „Volk“ ist im Grundgesetz zunächst die Aktivbürgerschaft18 gemeint. Darunter fallen nur diejenigen Bürger, welche alle staatsbürgerlichen Rechte innehaben. Dazu zählt vor allem das Wahl- und Abstimmungsrecht. Nach in der Wissenschaft herrschender Meinung übt das „Volk“ die Staatsgewalt selbst aus oder durch besondere Organe.19 Danach sind das „Volk“ und die „Organe“ als verschiedene Ausübende von Staatsgewalt zu verstehen, wie das „oder“ deutlich macht. Das „Volk“ als Inhaber der Staatsgewalt, da sie von ihm ausgeht und die „Organe“ als Ausübende, so zumindest im Fall der Repräsentativen Demokratie. Im umgekehrten Fall einer Direktdemokratie fallen die Begriffe „Inhaberschaft“ und „Ausübende“ von Staatsgewalt zusammen.
Eine moderne Gegenposition wird u.a. von Jürgens (1993) vertreten. Nach dieser Auffassung obliegt die Ausübung der Staatsgewalt, ob im Falle Direkter oder rein Repräsentativer Demokratie, immer dem Volk.20 Und obwohl die Absätze 1 und 2 des Art. 20 GG zwischen Träger von Staatsgewalt und Ausübendem unterscheiden, sind damit nicht automatisch zwei verschiedene Verfassungsorgane gemeint. Das einzige Verfassungsorgan ist das Volk und somit geht die Staatsgewalt auch immer vom Volke aus.20 Ob nun eine Verfassungsänderung tatsächlich nötig ist, um die Volksgesetzgebung auf Bundesebene zu etablieren, darüber scheiden sich die Geister. Nach dem gegen Ende des Kapitels 2.1 zu diskutierenden Vorschlags von „Mehr Demokratie e.V.“ ist dies notwendig.
2.1.2 Direkte Demokratie als Reformbeschleuniger?
In der modernen Wissenschaft existieren zahllose Fürsprecher der Direkten Demokratie. Um jedoch eine gewisse Neutralität zu wahren, ist es angemessen auch Gegner dieses Konzeptes zu Wort kommen zu lassen. Kranenpohl (2006) ist einer davon. In seinem Artikel vom 6. März 2006 wirft er die Frage auf, ob Direkte Demokratie als Ausweg aus dem Reformstau dienen kann. Mit Reformstau sind vor allem die Gesetze aus dem Bereich des Sozialstaats gemeint. Kranenpohl ist der Auffassung, dass die Gefahr besteht, dass die Bürger im Fall eines optionalen Referendums (die Regierung kann selbst entscheiden oder das Thema einem Volksentscheid unterziehen) zum „Stimmvieh“21 degradiert werden. Er sieht dadurch die Möglichkeit des Parlaments sich aus schwierigen Entscheidungssituationen geschickt herauszumanövrieren. Zudem sei das Volk nicht geeignet über diese Art von Entscheidungen zu urteilen bzw. abzustimmen, da es nicht als handlungsfähiger politischer Akteur zu sehen ist. Handlungsfähig seien nur Bürger, die organisationsfähig sind und über entsprechende Mittel verfügten um die Volksinitiative voranzutreiben. Diejenigen, denen diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, seien letztlich nur „Abstimmende“22.
Doch damit nicht genug. Es wird bei Anwendung von Referenden gar behauptet, das Volk (der organisierte Teil) nutze dieses Instrument zur Blockierung des Gesetzgebungsprozesses. Mit dem „organisierten Teil“ sind anscheinend Interessengruppen sowie Lobbyisten gemeint. Doch nutzen diese ihre Machtstellung im repräsentativen System genauso aus, wie sie es bei direkten Entscheidungen zumindest versuchen würden. Insgesamt zeichnet sich bei Kranenpohl ein negatives Bild einer teils unfähigen Bevölkerung ab.
Aus wissenschaftlicher Sicht des Autors sind die genannten Gefahren, wie Blockade des gesetzgeberischen Prozesses oder die Macht der Organisierten, nicht nachzuvollziehen. Über das Bild der Politiker sei gesagt, dass sie selbst (wenn teils auch besser gebildet als der Durchschnittsbürger) doch letztlich aus der großen Bevölkerungsmasse heraus gewählt werden. Somit erscheint eine Trennung von Politikern und Bürgern als wenig haltbar, wenn es um Fachwissen und Organisationsfähigkeit geht. Zudem hat nahezu jeder Bürger die Möglichkeit sich in Vereinen, Verbänden, Beiräten oder ähnlichen Interessengruppen zu organisieren und damit politisch aktiv zu werden. Volksinitiative oder Volksgesetzgebung meint ja nicht, dass ein einzelner dazu verpflichtet ist, Gesetzesinitiativen zu erarbeiten und sie dem Volk zur Abstimmung vorzulegen.
Um die Argumentation über ein Für und Wider auf eine breitere gesellschaftliche Basis zu verlagern, wird im nächsten Unterkapitel eine Bundestagsdebatte aus dem Jahr 2006 herangezogen. Damals standen drei verschiedene Gesetzesentwürfe über die Einführung der Direkten Demokratie auf Bundesebene zur Debatte. Der Inhalt der Entwürfe ist hier weniger von Bedeutung als die Argumente der Beteiligten.
2.1.3 Die Argumentation des Deutschen Bundestages
Ausgangspunkt der folgenden Debatte war ein dreistufiges Volksgesetzgebungsverfahren (Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid). Dazu werden die Standpunkte der CDU (Ingo Wellenreuther), der Linksfraktion (Lothar Bisky), der SPD (Maik Reichel), eines fraktionslosen Abgeordneten (Gert Winkelmeyer) und der FDP (Ernst Burgbacher) nacheinander diskutiert und anschließend zusammengefasst.23
Zu Beginn der Debatte trat der Abgeordnete Ingo Wellenreuther von der Christlich Demokratischen Union ans Rednerpult und machte sofort klar, dass das repräsentative System aufgrund seiner bis dato 58-jährigen Stabilität als einzige Staatsform in Frage kommt. Wellenreuther sah vor allem die Gefahr des Missbrauchs von Direkter Demokratie durch das Volk. Der CDU-Abgeordnete sah komplexe Fragestellungen der Politik auf reine „Ja-Nein-Entscheidungen“ reduziert, ohne dass dazu eine fachmännische Debatte, wie etwa in den Ausschüssen oder im Parlament, vorher stattfindet. Zudem behielt er sich vor zu behaupten, die Bevölkerung sei häufig nicht willens, neue Wege in der Politik zu gehen und tendenziell eher beim „Status quo“ zu verharren. Eine Behauptung, die sich durchaus auch auf die Abgeordneten beziehen lässt. Hinzu kommt, dass Herr Wellenreuther die Stimmbürger als zu wenig geistig bewandert erachtet, um: „die immer komplexer werdenden Fragestellungen unserer pluralistischen Gesellschaft“24 zu beantworten oder gar zu erörtern. Auf die geistigen Fähigkeiten der Stimmbürger (auch in der Schweiz und Kalifornien) geht Kapitel 2.1.7 näher ein. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob Politiker selbst dem geistigen und technologischen Fortschritt allzeit gewappnet sind und quasi automatisch an Weisheit hinzugewinnen.
Eines der schillerndsten Argumente gegen die Einführung der Volksgesetzgebung sei die Tatsache, dass diese sich über den Willen von Minderheiten hinwegsetzen würde und diese damit diskriminiert. Doch ist es gerade die Möglichkeit einer Volksinitiative sich in Gesellschaft und Politik Gehör zu verschaffen. Zudem spielen in den taktischen Kalküls der Parteien und Wahlprogramme doch selten die Bedürfnisse weniger, als vielmehr die vieler eine Rolle. Aber damit noch nicht genug. Als vorletztes Gegenargument führt die CDU die „Gefahr der weiteren Abwertung des Parlaments“25 ins Feld. Die erste Abwertung habe bereits dadurch stattgefunden, dass Talkshows und politische Runden die Debatte in die Öffentlichkeit verlagern und sie damit dem Parlament entziehen oder sie zumindest aufweichen. Bedeutet das im Umkehrschluss, die Pressefreiheit sei an einer Abwertung des Parlaments schuldig? Selbstverständlich ist die Frage unsinnig. Allerdings bleiben Zweifel hinsichtlich des Demokratieverständnisses zurück.
Doch nun zurück zur Debatte. Als letztes Argument wird angeführt, „dass sich das Volk und Einzelne von Stimmungen und subjektiver Betroffenheit leiten lassen, vor allem deswegen, weil organisierte und öffentlichkeitswirksame Lobbyarbeit noch mehr Einfluss erhalten könnte als heute schon. Populismus, Stimmungsmache, schlagwortartige Parolen können die Entscheidung über Sachfragen zum unsachlichen Abstimmungskampf degradieren.“ Dem ist entgegenzuhalten, dass Lobbyismus auch ein großes Problem des repräsentativen Systems ist.26 Zweitens entscheiden die meisten Menschen subjektiv, häufig nach ihren akuten Bedürfnissen. Doch wenn eine große Anzahl an Stimmbürgern ihre individuellen Präferenzen äußern, dann ergibt sich ein Gesamtbild bzw. etwas mit einer gesellschaftlichen Präferenzordnung Vergleichbares. Als letztes sei hierzu angemerkt, dass auch Politiker einem Eigeninteresse unterworfen sind. Dies zeigt sich insbesondere bei der „Prinzipal-Agenten-Problematik“ oder „Agenturtheorie“ bei der die Handlungen und Entscheidungen eines Beauftragten (Agent, hier: gewählter Repräsentant) nicht mit denen des Auftraggebers (Prinzipal, hier: Wähler) übereinstimmen.
Als zweiter argumentierte Lothar Bisky von der Linksfraktion für die Direkte Demokratie auf Bundesebene und verwies dabei auf die Einführung der Volksgesetzgebung im Land Brandenburg. Dass Brandenburg mit schier unüberwindbaren Hürden bei der Einleitung von Initiativen und späteren Volksbegehren kämpft, wurde nicht gesagt. Jedoch konnte die Argumentation von Herrn Bisky kaum klarer dem entgegenstehen, was Herr Wellenreuther von der CDU anmahnte. „Ich wünsche mir, dass sie (Bürger) in die Lage versetzt werden, deutlicher zu erklären, was sie bei bestimmten politischen Themen wollen.“ Wichtig ist an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass die Linksfraktion mit ihrem Vorschlag sehr nahe an dem war, der von Mehr Demokratie e.V. vertreten wird und dem wir uns gegen Ende des Kapitels 4 noch widmen werden.
Die grundlegende Argumentation des Abgeordneten der SPD, Maik Reichel, baute auf das Grundgesetz und natürlich auf Art. 20 Abs. 2 GG. Beim Zitieren des Satzes „...die Staatsgewalt vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt“ bezieht er sich im Wesentlichen auf den Begriff „Abstimmungen“, sowie man es schon von der Landesund Kommunalebene her kennt. Darüber hinaus stellt man bei der SPD fest: „Wir beklagen gerade in dieser Zeit zu Recht die allmähliche Politikverdrossenheit unserer Bürger. [..] Das Verantwortungsbewusstsein sollte sich nicht nur auf einen Urnengang alle vier Jahre beschränken.“ Zudem verweist der Abgeordnete Reichel auf die Länder Schweiz, Österreich und Italien, die bei unterschiedlichen Regelungen zur Volksgesetzgebung einen Missbrauch der Direkten Demokratie durch entsprechende Quoren zu verhindern wissen. Über die Auswirkungen von Quoren ab einer bestimmten Höhe wird Kapitel 2.2.2 näher eingehen. Auch wird dazu eine generelle Diskussion zu deren Sinn oder Unsinn stattfinden. Kritik am Wähler oder am Abstimmenden kann sich Herr Reichel aber auch nicht entziehen. Er sorgt sich bzgl. der Informiertheit der Bürger bei wichtigen Themen und zweifelt an der langfristigen Erkennung von Folgen durch die Stimmbürger, die die Entscheidungen des Volkes nach sich ziehen. Grundsätzlich spricht er sich aber für mehr Direkte Demokratie aus. Zumal Herr Reichel angibt im eigenen Wahlkreis (unbekannt) positive Erfahrungen damit gesammelt zu haben.
[...]
1 Vgl.: Ebd., S.60
2 Vgl.: Ebd., S.65
3 Vgl.: Ebd., S.76
4 Vgl.: Ebd., S.271f.
5 Ebd., S.277
6 Ebd., S.280
7 Vgl.: Neumann, Peter (2009), Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Länder, Nomos-Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 4. Kapitel: Unmittelbare Demokratie im Verfassungsrecht der Deutschen Demokratischen Republik, S.268
8 Vgl.: Ebd., S.273
9 Vgl.: Ebd., S.273
10 Vgl.: Ebd., S.275
11 Siehe hierzu auch Kapitel 2.1.4 Direkte Demokratie in der Weimarer Republik
12 Vgl.: Neumann, Peter (2009), Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Länder, Nomos-Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 2. Kapitel: Die Entwicklung der Debatte um die plebiszitären Elemente in der Bundesrepublik Deutschland, S.83ff.
13 Vgl.: Ebd., S.88f.
14 Art. 20 Abs. 2 GG
15 Vgl.: Neumann, Peter (2009), Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Länder, Nomos-Verlagsgesellschaft, 1.Auflage, S. 148
16 Vgl.: Dreier (2006), Grundgesetz Kommentar Art. 20, Rdnr. 104, S.82
17 Vgl.: Jürgens (1993), Direkte Demokratie in den Bundesländern, S.265
18 Kranenpohl, Uwe (06.03.2006) Bewältigung des Reformstaus durch Direkte Demokratie? Aus Politik undZeitgeschichte Nr. 10, www.bundestag.de/dasparlament
19 Ebd.
20 Bundestag debattiert über direkte Demokratie, 15.05.2006, www.ngo-online.de /ganze_nachricht.php? Nr=13583
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Vgl.: http://www.keine-lobbvisten-in-ministerien.de/index.php/Das Problem
24 Ebd.
25 Ebd.
26 Vgl.: http://www.keine-lobbvisten-in-ministerien.de/index.php/Das Problem
-
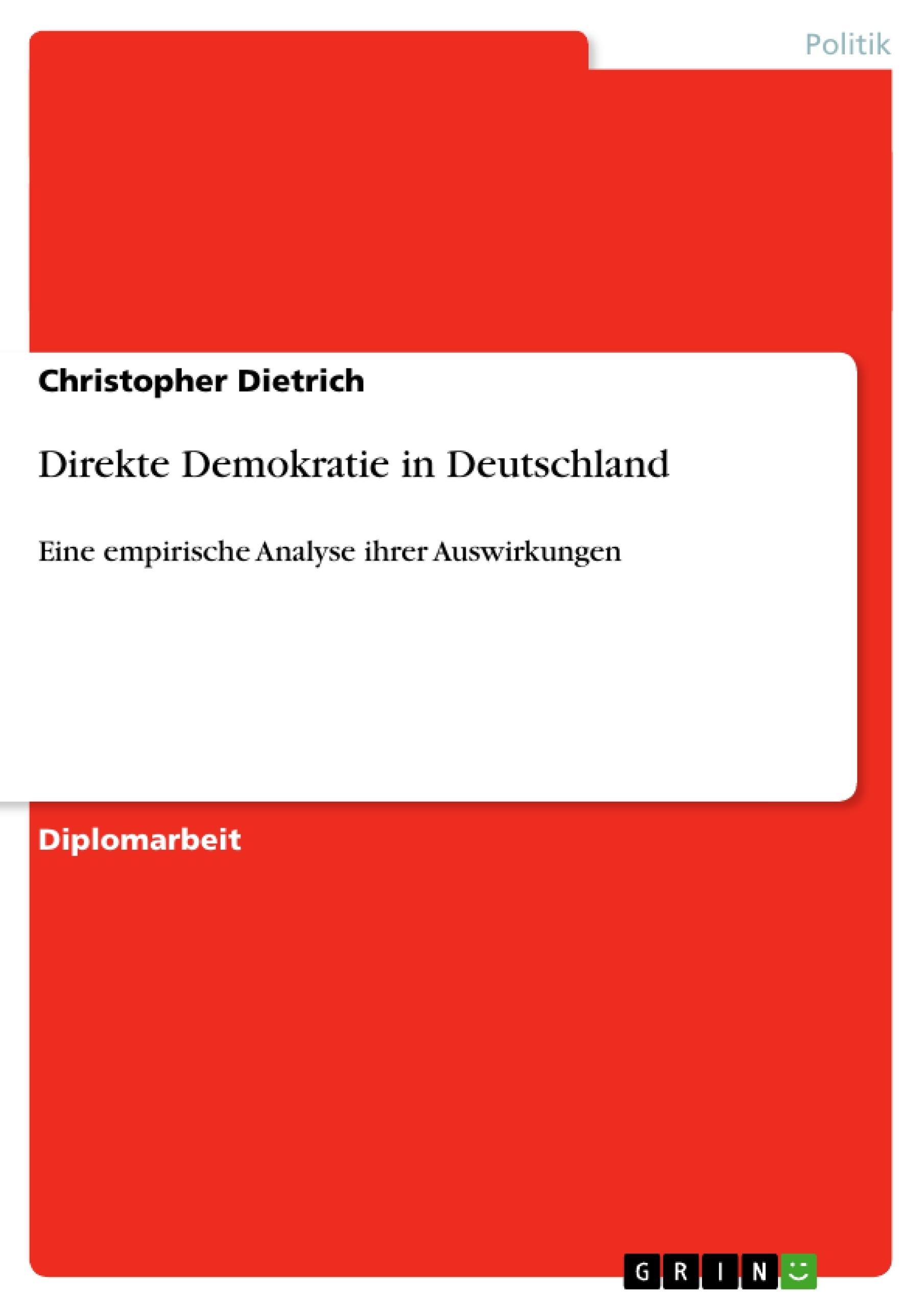
-
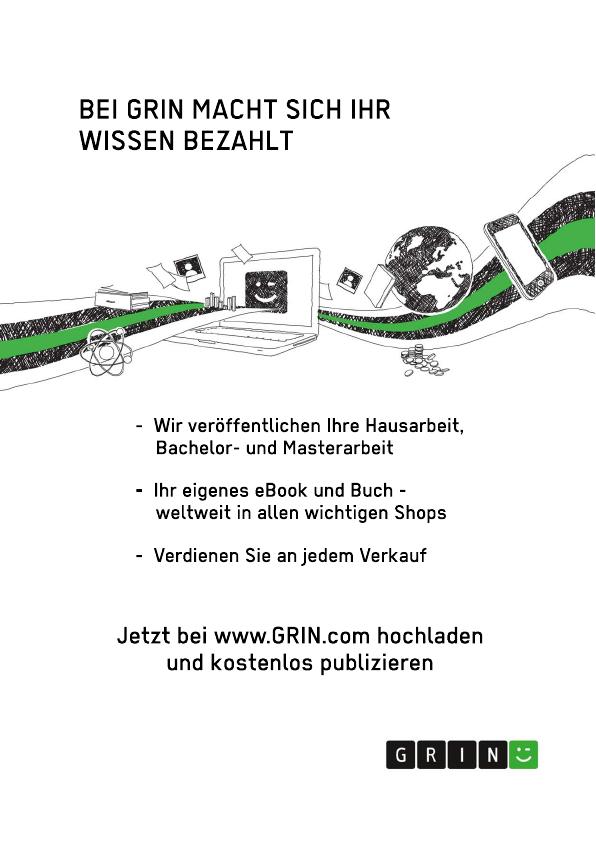
-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.