Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
ZUSAMMENFASSUNG
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
2.1. BURNOUT
2.1.1. BEGRIFFSENTWICKLUNG
2.1.2. Verlauf und Symptome
2.1.3. Definition und Diagnose
2.1.4. Differentialdiagnose
2.1.5. Häufigkeit und Relevanz
2.1.6. Ätiologie und Risikofaktoren
2.2. NEUROPATTERN™
2.2.1. Kovarianz- und Heterogenitätsproblem
2.2.2. Was ist Neuropattern™?
2.2.3. HHNA-Biomarker
2.2.4. Sympatho-adrenerge Biomarker
2.3. FRAGESTELLUNG
2.3.1. Hypothesen zur Messung von Erschöpfung
2.3.2. Hypothesen der Unterscheidbarkeit von erschöpften Subgruppen
2.3.3. Hypothesen über die Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung
2.3.4. Hypothesen über Symptome erschöpfter Personen
2.3.5. Hypothesen über biologische Marker von Erschöpfung
3. METHODE
3.1. STUDIENABLAUF UND -DESIGN, -SETTING
3.1.1. STUDIENSETTING UND -ZIEL
3.1.2. ABLAUF
3.1.3. STICHPROBENBESCHREIBUNG UND AUS- UND EINSCHLUSSKRITERIEN
3.1.4. ZUSÄTZLICHE STICHPROBE
3.2. UNTERSUCHUNGSMETHODEN
3.2.1. BESTIMMUNG VON CORTISOL IM SPEICHEL
3.2.2. DEXAMETHASONHEMMTEST
3.2.3. HERZRATENVARIABILITÄTSMESSUNG
3.2.4. NPQ-A
3.2.5. NPQ-S
3.2.6. NPQ-P
3.2.7. PHQ-D
3.2.8. WEITERE DATENERFASSUNGEN
3.3. STATISTISCHE METHODEN
4. ERGEBNISSE
4.1. DESKRIPTIVE BESCHREIBUNG
4.1.1. STICHPROBE
4.2. DATENANALYSE
4.2.1. Ergebnisse zu den Erschöpfungsmaßen
4.2.2. Ergebnisse zu erschöpften Subgruppen
4.2.3. Ergebnisse zur Unterscheidbarkeit von Depression und Erschöpfung
4.2.4. Ergebnisse über Merkmale und Symptome erschöpfter Personen
4.2.5. Ergebnisse zu biologischen Merkmalen erschöpfter Personen
5. DISKUSSION
6. LITERATURVERZEICHNIS
7. ANHANG
7.1. COPENHAGEN BURNOUT INVENTORY
7.2. KORRELATIONEN DER NPQ-S ERSCHÖPFUNGSITEMS UNTEREINANDER
7.3. KORRELATION ZWISCHEN ERSCHÖPFUNG UND NPQ-P-SYMPTOMEN
7.4. KORRELATION ZWISCHEN ERSCHÖPFUNG UND ERKRANKUNGEN
7.5. DENDOGRAMM DER CLUSTERANALYSE
7.6. VERTEILUNG DEPRESSIONSAUSMAß
7.7. REGRESSION ZWISCHEN ERSCHÖPFUNG UND DEPRESSION
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Zusammenfassendes Burnout-Modell
Abbildung 2: Das Stresssystem (Lupien, McEwen, Gunnar, & Heim, 2009)
Abbildung 3: Cortisolaufwachreaktion (Wüst, Wolf, Hellhammer, et al., 2000)
Abbildung 4: Totala area under the curve (AUCt) der CAR und AUC increase (AUCi) mm (Hellhammer, Fries, Schweisthal, et al., 2007)
Abbildung 5: Demografische Merkmale ambulanter und stationärer Patienten
Abbildung 6: Erschöpfung bei stationären und ambulanten Patienten
Abbildung 7: Erschöpfung bei Männern und Frauen
Abbildung 8: Verteilung der Variable Erschöpfung (SEr)
Abbildung 9: Verteilung der Variable Erschöpfung (SPEr)
Abbildung 10: Verteilung der Erschöpfungswerte (SPEr, eine Standardabweichung übermm
dem Mittelwert)
Abbildung 11: Erschöpfung, zwei Cluster
Abbildung 12: Erschöpfung, drei Cluster
Abbildung 14: Diagnostizierte Neuropattern™ bei hoch und niedrig erschöpften Patienten
Abbildung 14: Demografische Angaben stark und weniger erschöpfter Patienten
Abbildung 15: Beruflicher Positionen stark und weniger erschöpfter Patienten
Abbildung 16: Lebensereignisse hoch und niedrig erschöpften Patienten
Abbildung 17: Cortisolaufwachreaktion bei stark und weniger erschöpften Patienten
Abbildung 18: Cortisolaufwachreaktion bei stark und niedrig erschöpften Patienten
Abbildung 19: Modellartige Zusammenfassung der Ergebnisse
Abbildung 20: Dendogramm der Clusteranalyse
Abbildung 21: Streudiagramm für Depression
Abbildung 22: Streudiagramm der Regression zwischen Depressions und Erschöpfung
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Burnout-Symptomatik nach Burisch (2006)
Tabelle 2: Nature of psychosocial hazards at work (European Agency for Safety andmm Health at Work, 2010)
Tabelle 3: Zusammenfassung der mit Erschöpfung assoziierten Symptome
Tabelle 4: Zusammenhangsstärke zwischen Merkmalen erschöpfter Männern undmm Frauen sowie Vergleich zur Zusammenhangsstärke zu Depression
Tabelle 5: Exploratives lineares Regressionsmodell zwischen dem Erschöpfungsausmaßmm und verschiedenen Lebensereignissen als Prädiktoren
Tabelle 6: Korrelationen zwischen der Cortisolkonzentration und Erschöpfung
Tabelle 7: Korrelationen zwischen Erschöpfung und der Herzratenvariabilität
Tabelle 8: Korrelationen zwischen den Erschöpfungssymptomen des NPQ-S
Tabelle 9: Korrelation zwischen Symptomen und Erschöpfung sowie Depression
Tabelle 10: Korrelationen zwischen Erschöpfung und Erkrankungen
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ZUSAMMENFASSUNG
Burnout hat eine hohe Prävalenzrate und ist begleitet von vielfältigen Einbußen in der Lebens- qualität und Leistungsfähigkeit. Dasöffentliche Interesse an diesem Phänomen ist hoch, wenngleich es der Forschung bisher kaum gelang, Burnout differenziert zu erfassen und zu konzeptualisieren. Obwohl es an validen und differentialdiagnostischen Messinstrumenten mangelt, wird Erschöpfung von den meisten Autoren als Hauptkriterium für Burnout gesehen. Dabei wird der Zusammenhang von Burnout und Depression stark diskutiert. Die vorliegende Arbeit hat das Ziel psychologische, biologische und somatische Merkmale erschöpfter Patien- ten zu erfassen. Hierzu wurden 343 psychisch oder psychosomatisch erkrankte stationäre und ambulante Patienten mit der Neuropattern™-Diagnostik untersucht (Altersdurchschnitt 45,5 Jahre, 65.3% weiblich). Über die Neuropattern-Questionnaires (NPQ) sowie dem Patient- Health-Questionnaire (PHQ) werden somatische und psychische Symptome, darunter das Er- schöpfungsausmaß, erfasst. Zusätzlich vermerkt ein Arzt über einen Anamnesebogen klinisch relevante Symptome. Die Patienten messen über eine Elektrokardiogramm-Aufzeichnung die Herzratenvariabilität und sammeln an zwei Tagen jeweils sechs Speichelproben zur Cortisolbestimmung (0, 30, 45 und 60 Minuten nach dem Erwachen sowie um 15 und 20 Uhr). Vier weitere morgendliche Speichelproben werden nach der Einnahme von 0,25 mg Dexame- thason erhoben (ultra-low-dose Dexamethasonhemmtest). Aus den Ergebnissen dieser Arbeit wird die Bedeutung von chronischem Stress am Arbeitsplatz für ein erhöhtes Erschöpfungs- ausmaß ersichtlich. In gleicher Weise spielen mangelnde soziale oder emotionale Unterstüt- zung, traumatische Ereignisse, familiäre Konflikte, Arbeitslosigkeit und eine einfache oder nied- rige Arbeitsposition eine Rolle. Erschöpfte Personen leiden vor allem an mentaler und körperlicher Müdigkeit sowie Niedergeschlagenheit. Zusätzlich ist ihre Symptomatik jedoch durch Anspannung, Angst, Nervosität, Reizbarkeit und einem ausgeprägtem Gefühl des Krankseins bestimmt. Somatisch imponieren bei Erschöpften Schmerzen, Magen-Darm- Probleme, kardiovaskuläre Beschwerden und eine Reihe von Symptomen, die erst nach Stressphasen auftreten. Trotz einer hohen Überschneidung scheint es über sympathisch und noradrenerg geprägte Symptome möglich, erschöpfte von depressiven Personen zu unter- scheiden. Das Erschöpfungsausmaß scheint überdies mit einer reduzierten autonomen Regu- lationsfähigkeit einher zu gehen. Zwar gibt es kaum Belege für eine generell erniedrigte Corti- solkonzentration bei Erschöpften, allerdings zeigt sich bei hoch erschöpften Patienten ein deutlich negativer Zusammenhang zwischen dem Erschöpfungsausmaß und der Cortisolauf- wachreaktion, der area under the curve und der Cortisolkonzentration. Weitergehende Studien sollten die Möglichkeit einer symptomatischen Abgrenzung von Depression und Erschöpfung sowie eine Differenzierung zwischen hoch und gering erschöpften Personen anhand der Corti- solaufwachreaktion und -Konzentration prüfen. Überdies sind eine einheitliche Konzeptualisie- rung von Burnout und eine Validierung der Messinstrumente erforderlich.
1. EINLEITUNG
„Von 2001 bis 2005 stieg der Anteil der durch psychische Störung bedingten AU-Tage (Arbeitsun- fähigkeitstage) von 6,6 auf 10,5 % an. Bei unter 50-Jährigen stehen depressive Störungen als Frühbe- rentungsgrund mittlerweile an zweiter Stelle. Immer mehr Menschen erleben sich in der Arbeit als „an der Belastungsgrenze“, wobei die gleichzeitig sinkenden AU-Tage kaum anders als durch hohen sys- temischen Druck erklärbar sind. Halten wir diesem Druck nicht stand respektive erleben wir die erhal- tenen Gratifikationen relativ zum persönlichen Einsatz als zu gering (…), ist „Burnout“ ein Stress- Symptome und erlebte Beeinträchtigungen plausibel erklärendes und zudem das individuelle Selbst- wertgefühl stabilisierendes Krankheitsmodell. (…) Schon deshalb verdient Burnout in hohem Maße wissenschaftliche, therapeutische und politische Aufmerksamkeit.“ (Hillert & Marwitz, 2008, S. 239)
Bei der Suche nach Literatur zu dem Begriff Burnout lassen sich in Datenbanken wie Pubmed und PsycINFO etwa 6000 bis 6500 Artikel und bei Google Scholar circa 315 000 Verweise finden. Vergleicht man diese mit der Anzahl an Ergebnissen, die man für den Suchbegriff Depression erhält wird deutlich, dass dieses Phänomen wissenschaftlich noch ein vergleichbar dünnes Fundament hat (PubMed zeigt etwa 248 000 und PsycINFO etwa 168 000 Ergebnisse an bei der Suche nach dem Begriff Depression; alle Anfragen abgerufen am 02.10.2010). Erklären lässt sich das vermutlich aufgrund der definitorischen Unschärfe von Burnout. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Depressionsforschung bereits Anfang des 19. Jahrhunderts begann (Pinel, 1801). Somit entstand die Depressionsforschung etwa 170 Jahre früher, als die seit etwa 35 Jahren bestehende Burnoutforschung (Freudenberger, 1974; vergleiche (vgl.) Burisch, 2006). Betrachtet man jedoch das allgemeine Interesse in der Bevölkerung und den Medien, so wird ein anderes Verhältnis deutlich. Bei der Suche nach dem Begriff depression auf google.com erhält man etwa 63 000 000 Ergebnisse. Wird der Begriff burnout beziehungsweise exhaustion dort eingegeben erscheinen circa 10 600 000 beziehungsweise (bzw.) 34 000 000 Einträge (Anfragen abgerufen am 02.10.2010). Diese Resonanz kann in dem Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklun- gen begründet liegen. So ist Stress - insbesondere am Arbeitsplatz - häufig aus persönli- cher Erfahrung präsent. Gleiches gilt für damit oftmals einhergehende Gefühle von Lustlo- sigkeit, Mattheit oder Abgeschlagenheit. Relevant ist das Thema jedoch vielmehr noch aufgrund von langfristigen und auch kostenintensiven Folgen, die mit Burnout und Erschöp- fung einher gehen. Konsequenzen von Arbeitsunfähigkeit spiegeln sich nicht nur in medizini- schen Kosten wieder, sondern in einer ganzen Reihe an persönlichen Einschränkungen so- wie volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Schäden (siehe 2.1.5). Von daher ist eine Auseinandersetzung mit Burnout sowie den Prädiktoren und Konsequenzen dringend. Ebenso wichtig ist es jedoch, die Schwächen dieses Konzepts zu betrachten (siehe 2.1.1, 2.1.3 oder 2.1.4). Neben speziellen konzeptuellen Problemen steht Burnout daneben auch grundlegenden Problemen psychischer Störungen gegenüber (siehe 2.2.1).
An der Universität Trier wurde indes ein Verfahren entwickelt, welches durch eine indivi- dualspezifische Betrachtung multidimensionaler Komponenten einige dieser Probleme um- geht. Neuropattern™ erfasst stresssensitive Veränderung anhand von Schnittstellen zwi- schen biologischen, psychologischen und physiologischen Parametern. Anschließend werden für die jeweiligen Veränderungsmuster (Neuropattern) spezifische psycho- und pharmakotherapeutische Maßnahmen abgeleitet (siehe 2.2.2 bis 2.2.4). Da Burnout zu stressbezogenen Gesundheitssyndromen zählt, wird anhand einer klinischen Stichprobe überprüft, wie verschiedene Neuropattern™ mit Burnout, bzw. Erschöpfungszuständen zu- sammenhängen (siehe 2.3 sowie 4). Zusätzlich wird in dieser Arbeit eine möglichst umfas- sende Beschreibung von erschöpften Personen anhand psychologischer, biologischer und somatischer Merkmale gegeben. Die Stichprobe wurde im Rahmen einer Studie mit 106 am- bulanten und Patienten erhoben, die stationär in der Rehabilitationsklinik Seehof in Teltow behandelt wurden und an Neuropattern™ teilnahmen. Ziel dieser Studie ist es, durch ein randomisiert Design die Wirksamkeit von Neuropattern™ anhand von Belastungsmaßen zu evaluieren (siehe 3.1 und 4.1.1). Außerdem wurden Daten von 237 ambulanten Patienten ergänzt, die im Rahmen einer aktuell laufenden Studie bei Hausärzten in Rheinland-Pfalz dieselben Daten erhoben haben (siehe 3.1.4). Dabei soll einerseits die Häufigkeit der Neuro- pattern™ bei Hausarztpatienten festgestellt und andererseits die Praxistauglichkeit der Neu- ropattern™-Diagnostik geprüft werden.
Wie bereits angedeutet, wird im Folgenden zunächst der theoretische Hintergrund von Burnout besprochen. Das umfasst eine Darstellung der Entwicklung des Begriffs „Burnout“ und der Häufigkeit seines Auftretens. Anhand von Symptomen, Ätiologie und der Möglichkei- ten der Messung von Burnout wird das Konzept Burnout vertieft. Anschließend wird Neuro- pattern™, seine Bestandteile und Vorteile vorgestellt. Die sich daraus ergebende Fragestel- lung für diese Arbeit wird nach einer Darstellung der Studie im methodischen Teil aufgegriffen und empirisch überprüft. Nach der Darstellung der Ergebnisse werden diese diskutiert und Einschränkungen erörtert.
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Burnout steht zusammen mit einer Reihe von psychischen, psychosomatischen aber auch somatischen Erkrankungen in engem Zusammenhang zu Stress. In der Diagnostik und Behandlung dieser Störungen zeigen sich in der Praxis jedoch einige Probleme. Hier stellt die Neuropattern™-Diagnostik einen neuartigen Ansatz dar, der einige dieser Probleme um- geht.
Nachfolgend werden zunächst einige wesentliche Aspekte des Burnout-Konzepts vor- gestellt. Es wird auf die Begriffsentwicklung, Konzeptrealisierung, Symptome und epidemio- logische Aspekte eingegangen. Anschließend folgt in der zweiten Hälfte des Theorieteils ei- ne Vorstellung des Neuropattern™-Verfahrens. Schließlich soll geprüft werden, welcher Zusammenhang zwischen Neuropattern™, den hiermit erhobenen Maßen und Burnout, bzw. Erschöpfung besteht.
2.1. BURNOUT
Wie beschrieben, wird ausgehend von einer Begriffsbestimmung im ersten Teil der theoretischen Grundlagen auf verschiedene Aspekte von Burnout eingegangen. Dabei dient Burnout als zeitgemäßes Beispiel eines stressbedingten Syndroms mit gesundheits- und wirtschaftsschädlichen Folgen. Die Ursachen von Burnout werden weitläufig nicht zuletzt als gesellschaftlich bedingt gesehen (Hillert & Marwitz, 2008). Dieser Tatsache bedeutet jedoch ebenfalls eine langfristige Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Auftretenshäufigkeit und unterstreicht die Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem Thema.
„Natürlich wird unser Begriff ,Burn-out‘ meist völlig falsch verwendet“, kommentierte die US- Psychotherapeutin Christina Maslach, die nach Freudenberger als „Entdeckerin“ des Phänomens gilt, den Flächenbrand (…), „aber das Echo zeigt uns doch, dass wir offensichtlich das Wundzentrum einer Gesellschaft offengelegt haben. Plötzlich entdeckt die Menschheit, dass sie eine Seele hat.“ (Goebel & Hofer, 2011)
2.1.1. Begriffsentwicklung
Burned out, oder unüblicher: worn out, flame-out (Maslach & Schaufeli, 1993; vgl. Burisch, 2006) , also sich „ausgebrannt fühlen“ umschreibt ein „Stresssyndrom“ mit den Hauptsymptomen Erschöpfung und Antriebslosigkeit, welche zu Leistungsminderung führen (Brühlmann, 2007; Cordes & Dougherty, 1993; Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010; Hillert & Marwitz, 2008; von Känel, 2008). Solche Symptome emotionaler und kognitiver Erschöpfung wurden historisch schon früh beschrieben[1] und tre- ten häufig innerhalb eines stark belastenden Umfelds auf. Begleitet wird dieser Zustand von Motivations- und Leistungsdefiziten und einer Reihe von weiteren psychischen, somatischen und zwischenmenschlichen Beschwerden (vgl. Burisch, 2006; von Känel, 2008). Erhart und Meyer (1997) verweisen in diesem Zusammenhang auf den Begriff „Nervosität“. Mit diesem soll bereits im 18. / 19. Jahrhundert eine mit Burnout vergleichbare Erscheinungsform bezeichnet worden sein und auch hier gingen gestiegenen gesellschaftliche Anforderungen voran. Gleichzeitig wurde der Begriff „Burnout“ umgangssprachlich wohl etwa ab 1900 mit der Bedeutung „Überarbeitung und früher Tod“ verstanden (Enzmann & Kleiber, 1990; zitiert nach Albrecht, ohne Zeitangabe; vgl. Burisch, 2006). Im wissenschaftlichen Kontext wurde Burnout vermutlich jedoch erstmals 1974 von dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Herbert J. Freudenberger verwendet. In Fallstudien beschrieb er, wie zunächst engagierte Mitarbeiter aus sozial-helfenden Berufen zunehmend erschöpft und reizbar gegenüber ihren Klienten wurden und unter körperlichen Symptomen litten (Freudenberger, 1974). Er verstand Burnout als körperliche und geistige Erschöpfung, die entsteht, wenn das eigene Selbstbild (im Sinne von persönlicher Rolle oder Lebensplan) nicht erfüllt werden kann. Freudenberger beobachtete bei sich und anderen Betroffenen neben Erschöpfung auch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Schlafprobleme, Gereiztheit und Einbußen in der Flexibilität. Dennoch sah er die Symptomatik als individuell sehr unterschiedlich an und charakterisierte Burnout infolgedessen eher aufgrund der Genese (Hillert & Marwitz, 2008). Die Sozialpsychologin Christina Maslach begann nur wenige Zeit später damit, sich mit Emotionen und emotionalen Stress am Arbeitsplatz zu beschäftigen (Maslach, 1976; zitiert nach Burisch, 2006). Da sie in ähnlicher Weise Pflegeberufe und Dienstleisungsberufe untersuchte, war die Burnoutforschung in der Pionierzeit somit eher auf Berufe mit Klienten-, bzw. Patientenkontakten beschränkt. Außerdem wurde sie durch qualitative Methoden dominiert (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).
Weniger als zehn Jahre darauf gewann die Forschung an Systematik. Zentral hierfür war, dass nun einökonomisches Testverfahren zur Verfügung stand. Dieses wurde von der Arbeitsgruppe um Maslach entwickelt (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Mit dem Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1981) wurde Burnout folglich ab den 1990ern branchenübergreifend untersucht (Cordes & Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Entstanden ist das MBI zunächst aufgrund hypothetisch angenommener Aspekte des Burnout Syndroms. In darauffolgenden Schritten wurde aus ursprünglich 47 Items, vier Faktoren und zwei Ratingskalen die heute bekannte Form erstellt. Diese besteht aus 25 Items, die über eine sechsstufige Ratingskala per Selbsteinschätzung bezüglich der jeweiligen Auftretenshäufigkeit bewertet werden können. Obwohl „ein vierter Faktor (Anmerkung des Autors: involvement) konsistent in der Faktoranalyse auftauchte“, wurde eine Lösung mit drei Subskalen aufgrund ihrer Eigenwerte gewählt (Maslach & Jackson, 1981, S. 104). Dieses Drei-Komponenten-Modell von Maslach umfasst 1.) emotionale Er- schöpfung als ein Gefühl von gefühlsbezogener Überanstrengung und des Energiemangels, 2.) Depersonalisierung als ein häufig von Zynismus begleitetes Gefühl der Nichtverantwort- lichkeit gegenüber Klienten sowie 3.) reduzierte Leistungsfähigkeit, die sich in der mangeln- den Überzeugung in die eigene Kompetenz und den Erfolg wiederspiegelt (Cordes & Dougherty, 1993; Maslach & Jackson, 1981). In späteren Arbeiten sieht Maslach das MBI nicht nur als Messinstrument für die Ausprägung von Burnout, sondern als Maß auf einem Kontinuum zwischen Burnout und Engagement (Maslach & Leiter, 2008). Ebenfalls hat die Arbeitsgruppe einige Jahre nach dessen entstehung das MBI umformuliert, wodurch der Fragebogen seit 1996 als MBI - General Survey (Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996) in der dreidimensionalen Struktur auch für klientenunabhängige Berufe einsetzbar ist (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2002). Infolgedessen ist der Faktor Depersonalisierung nun als eine Haltung der inneren Distanz gegenüber der Tätigkeit zu verstehen (Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996).
Während Reliabilitätsmaße wie die Iteminterkorrelation, internale Konsistenz und Retestreliabilität über zwei bis vier Wochen (Maslach & Jackson, 1981), bzw. drei Monate (Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993) zufriedenstellend bis gut sind, sind andere Gütemaße diskutabel. Ebenfalls scheint die Vorhersagekraft bei Zeitabständen, die größer als sechs bis acht Monate sind, nachzulassen und bewegt sich um eine Korrelation um r = .5 (Shirom et al., 2005). Regelmäßig sind heterogene Ansichten und Befunde bezüglich der diskriminanten Validität, etwa in Abgrenzung zu Depression (siehe 2.1.4), zu finden (Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010; Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993). Dennoch wird in der Literatur und auch in Untersuchungen, die das MBI verwenden, die Konstruktvalidität dieses Fragebogens weniger stark diskutiert. Dabei wird das MBI in etwa 85 % (Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010) bzw. über 90 % (Burisch, 2006) der wissenschaftlichen Untersuchungen zu Burnout eingesetzt. Die darin operationalisierten Symptomdimensionen sind demnach die am häufigsten untersuchten (von Känel, 2008) und von daher auch zahlreich belegt. Allerdings gibt es unabhängig von dieser Operationalisiserung bisher keine einheitliche und anerkannte Definition (siehe 2.1.3), obligatorische Einzelsymptome (Hillert & Marwitz, 2008) oder objektive Marker für Burnout (von Känel, 2008). Insofern können sich Befunde zu Burnout nur auf das, dem jeweiligen Fragebogen zugrundeliegende Konstrukt von Burnout beziehen. Unabhängig davon verweisen Analysen des Deutschen Insituts für Medizinische Dokumentation auf eine Beliebigkeit der im MBI angenommenen dreidimensionalen Struktur (Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010). Ähnlich beliebig sieht Shirom (2005) die dreidimensionale Struktur des MBI. Dies stellt die Konstruktvalidität zusätzlich infrage (vgl. Shirom et al., 2005). Als weiteres, recht häufig verwendetes Burnoutmessinstrumente lässt sich das Oldenburg Burnout Inventar nennen (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Es erfasst Erschöpfung und Distanzierung von der Arbeit. Alternativ gibt es daneben das Copenhagen Burnout Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005), welches zwischen persönlichem, arbeitsbezogenem und klientenbezogenem Burnout unterscheidet oder der Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (Shirom, 2005), welcher die Subskalen emotionale Erschöpfung, phsysische Müdigkeit und kognitive Ermüdung enthält. Eine weitergehende Betrachtung verschiedener Messverfahren und vereinzelt ihrer Gütekriterien ist in Burisch (2006), bei Shirom und Ezrachi (2003) oder Bakker, Demerouti und Schaufeli (2002) zu finden.
Gelegentlich lässt sich auch der Begriff vitale Erschöpfung finden. Dieser wurde etwa Mitte der 1980er Jahre im klinischen Kontext insbesondere von A. Appels als Bezeichnung für den Zustand von Patienten vor einem Herzinfarkt eingeführt. Kennzeichen sind eine übermäßige Müdigkeit, Energieverlust, Reizbarkeit und Demoralisierung, welche „einen Zustand mentaler Erschöpfung wiederspiegeln“ (Appels & Mulder, 1989, S. 728). Allerdings konnten keine Befunde gesichtet werden, die eine konzeptuelle Redundanz widerlegen oder den Zusammenhang zu Burnout darstellen (vgl. Edelmann, 2010). Überdies mag die sehr geringe Anzahl an Studien über vitale Erschöpfung auf ein wenig ergiebiges Konzept hindeuten.
Es lässt sich festhalten, dass es neben einer gewissen Diversität einen dominanten Ansatz in der Burnoutforschung gibt. Obwohl kritisch diskutiert ist das MBI das meistverwendete Burnoutmessinstrument. Um Burnout möglichst unabhängig davon zu beschreiben und ein anschauliches Bild zu erhalten, wird der begrifflichen und historischkonzeptuellen Sicht eine symptomatische Beschreibung gegenübergestellt.
2.1.2. Verlauf und Symptome
Eine vielseitige und greifbare Darstellung von Burnout ist anhand von dessen Symptomen möglich. Häufig werden diese zugleich in eine zeitliche Abfolge gebracht. In der Literatur las- sen sich hierzu verschiedene Phasenmodelle der Burnout-Genese finden, welche mehrheit- lich zwischen zwei und zehn Stufen umfassen. Die erste Phase beginnt oftmals damit, dass Betroffene unter Berufsstress und Überforderung leiden. Dies wandelt sich anschließend in Frustration, Stillstand oder Hilflosigkeit und endet nach einem Zustand der Erschöpfung schließlich mit Burnout (Burisch, 2006; Hillert & Marwitz, 2008). In manchen Modellen wird eine zusätzliche Phase vorangestellt, worin Begeisterung und starkes Engagement für die Aufgaben als Voraussetzung gesehen wird. Es ist jedoch eher zweifelhaft, ob Burnout eine solche Hingabe für die jeweilige Tätigkeit vorausgegangen sein muss (Burisch, 2006; Hillert & Marwitz, 2008); im Sinne von „Wer ausgebrannt ist muss zuvor auch gebrannt haben.“. Vielmehr ist zu erwähnen, ob nicht eine von vorneherein bestehende Abneigung gegen die zu erledigende Arbeit ein mindestens ebenso starker, potentieller Prädiktor für Burnout ist.
Eine Synopsis von Burnoutsymptomen aus einer Vielzahl von Arbeiten, wie beispiels- weise der von Schaufeli und Enzmann (1998), ist in Burisch (2006, S. 25 f) zu finden. Diese ist in Tabelle 1 abgebildet und gibt einen Eindruck über mögliche Verlaufsformen und Symp- tome von Burnout auf unterschiedlichen Ebenen. Einschränkend merkt der Autor allerdings eine gewisse Willkürlichkeit der Einteilung und Unschärfe der Begrifflichkeiten an (Burisch, 2006, S. 27). Außerdem ergänzt er an dieser Stelle, die Reihenfolge sei nicht allzu zwingend gemeint. Burisch geht von einer Anfangsphase mit überhöhtem Energieeinsatz und ersten Erschöpfungsanzeichen aus, die über mehrere Stufen zu einem „Burnout-Stadium“ (Burisch, 2006, S. 34) führen kann. In den Phasen dazwischen lassen sich zunehmend schwerwie- gendere Symptome auf behavioraler, emotionaler, psychosomatischer und kognitiver Ebene finden. So ist beispielsweise zu erkennen, wie nach ersten Anzeichen von Kraftlosigkeit eine größere Distanz zu Klienten, bzw. genereller Empathieverlust, sich häufende Konflikten, Stimmungsschwankungen und Irritierbarkeit (Melamed et al., 1999)[2], depressive Verstim- mungen (Bauer et al., 2003), Ängstlichkeit und Hilflosigkeit (Rada & Johnson-Leong, 2004; Richardsen, Burke, & Leiter, 1992; Turnipseed, 1998) oder auch Aggressivität auftritt. An- schließend kommt es zu einem allgemeinen Abbau der Leistungsfähigkeit (Salamela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi, 2009; zitiert nach Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, 2010) sowie einer emotionalen und sozialen Verflachung. So zeigen Burnoutbet- roffene weniger Einsatz und Vorbereitung für ihre Tätigkeit (Lee & Shin, 2005) und auch das Familien- und Eheleben wird weniger zufrieden stellend bewertet (Greenglass & Burke, 1988; Übersicht in Maslach & Leiter, 2008). Ergänzend argumentieren Maslach, Schaufeli und Leiter (2001), dass die Leistungsminderung durch Unzufriedenheit über die Arbeit in ei- ner Abwärtsspirale verstärkt werden kann. Begleitet wird dieser Prozess von körperlichen Reaktionen wie Schmerzen (Brattberg, 2006; Soares & Jablonska, 2004). Ebenso zeigen sich Schlafprobleme wie Durchschlafstörungen und ein wenig erholsamer Schlaf (vgl. von Känel, 2008; Grossi et al., 2003 Melamed et al., 2005
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grundlegend ist ersichtlich, dass Burnout ein schrittweiser und kontinuierlicher Prozess mit einer Vielzahl an emotionalen, motivationalen, kognitiven, sozialen und somatischen Fol- gen ist. Dabei „wird der Prozess des Ausbrennens als jederzeit anhaltbar und umkehrbar be- schrieben. Auch kann er von einer Person mehrfach durchlaufen werden“ (Erhart & Meyer, 1997, S. 120). Eine detailliertere Darstellung der Konzeptualisierung von Burnout als Pro- zess lässt sich zum Beispiel in dem Review von Cordes und Dougherty (1993), sowie bei Burisch (2006; vgl. 2010) nachlesen. In der vorliegenden Arbeit wird zugunsten einer stärke- ren thematischen Eingrenzung darauf verzichtet. Außerdem weisen Hillert und Marwitz (2008) darauf hin, dass solche Phasen zwar im Einzelfall plausibel erscheinen, jedoch ein empirischer Nachweis fehle. Deshalb ist es wichtig, nachfolgend das Konzept von Burnout weiter einzugrenzen, Möglichkeiten der Diagnose zu erörtern und in dem darauffolgenden Abschnitt von anderen Konzepten abzugrenzen.
2.1.3. Definition und Diagnose
„Burnout ist der Professor, der - nach seiner Assistenzzeit an einem unruhigem Institut Ende der Sechziger rasch avanciert, in den ersten Jahren die Tür seines Büros, ja seiner Wohnung, stets für je- dermann offen hielt, der sich in Studienreform und Selbstverwaltung engagierte und stets dabei war, wenn ein „autoritärer Zopf“ abzuschneiden war - und der seine Begegnungen mit Studenten, „diesen narzisstischen Kretins", heute auf ein kühles Minimum beschränkt, Konferenzen allenfalls seufzend absitzt und ansonsten wieder zwischen seinen Bücherwänden lebt." (Burisch, 2006, S. 2)
In der Literatur finden sich zwar ähnliche, jedoch kaum einheitliche Beschreibung bzw. Definition von Burnout. Wie in 2.1.1 beschrieben, ist das MBI das in der Forschung am häu- figsten verwendete Messinstrument für Burnout. Folglich beinhaltet auch die Definition von Burnout in den meisten wissenschaftlichen Arbeiten das dem Fragebogen zugrunde liegende Drei-Komponentenmodell aus emotionaler Erschöpfung, reduzierter Leistungsfähigkeit und Depersonalisation (siehe beispielsweise McManus, Winder, & Gordon, 2002; vgl. Cordes & Dougherty, 1993; Erhart & Meyer, 1997). Auch im klinischen Kontext ist das MBI der am häufigsten verwendete Burnoutfragebogen (Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010). Da allerdings keine klaren Toleranzgrenzen für Burnout existieren, ist eine valide klinische Einordnung mit diesem Fragebogen nicht möglich (Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010; von Känel, 2008). Weitgehende Übereinstimmung gibt es unabhängig von dem Burnout-Konstrukt von Maslach in der Ansicht, dass Burnout insbesondere in Zusammenhang mit, bzw. in Folge von langan- haltendem Stress und Belastungen auftritt (Burisch, 2006; Erhart & Meyer, 1997; Maslach & Leiter, 2008; McManus, Winder, & Gordon, 2002). Dieser Symptomkomplex (Burisch, 2006), bzw. unspezifische Stresserkrankung (von Känel, 2008) oder Stressreaktion (Erhart & Meyer, 1997) hat als Hauptmerkmal chronische Erschöfpung, jedoch werden auch Reizbar- keit, reduzierter Leistungswille und Effektivität oftmals als zentrale Merkmale erwähnt (Burisch, 2006; Erhart & Meyer, 1997; Maslach & Jackson, 1981; Schaufeli & Enzmann, 1998). Eine weitere verbreitete Definition von Burnout nach Arie Shirom (1989; zitiert nach Shirom et al., 2005; vgl. Melamed et al., 1999) bezieht sich auf die anhaltende Erschöpfung der individuellen Ressourcen, die sich in emotionaler Erschöpfung, physischer Müdigkeit und kognitiver Mattheit niederschlägt. Vergleichbar sieht die Arbeitsgruppe um Ayala Maslach- Pines Burnout als körperliche, geistige und seelische Erschöpfung durch gefühlsmäßige Überlastung (Pines, Aronson, & Kafry, 2006; vgl. Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010).
Folgt man der aktuellen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10; Deutsches Insitut für Medizinische Doku- mentation und Information, 2010), so existiert das „Burn-out-Syndrom“ nicht als eigenständi- ge Erkrankung und ist somit auch nicht Bestandteil des Leistungskatalogs der deutschen Krankenkassen (Berg, 2007). Es kann jedoch als diagnostische Zusatzinformation unter Ein- flussfaktoren verschlüsselt werden. „Ausgebranntsein [Burn out]“ (Z73.0) zählt somit zu den „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010, S. 759). Gemeinsam mit „Mangel an Entspannung und Freizeit“ (Z72.2), „Stress“ (Z73.3), oder „sozialen Rollenkonflikten“ (Z73.5) stellt Burnout ein „Problem mit Be- zug auf Schwierigkeiten bei der Lebensführung“ dar, welches zu Erkrankungen führen kann (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010, S. 780). Das Syn- drom ist demnach krankheitswertig und spezifiziert in der Verwendung dieser Zusatzcodie- rung laut ICD-10 assoziierte Krankheitsbilder wie Depression (F32 bis F34), Anpassungsstö- rung (F43.2), Somatoforme Störungen (F45) oder auch Fibromyalgie (M79.7). Hierbei weist gerade die Anpassungsstörung durch ihren Bezug auf belastende Lebensereignisse, Leis- tungsminderung, ängstliche und depressive Reaktionen mit Burnout vergleichbare Merkmale auf (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010).
Sofern der vorliegende Symptomkomplex nicht einer bestimmten Diagnose zuordenbar ist oder entsprechende Einflussfaktoren in einer Zusatzcodierung angegeben werden können, gibt es schließlich noch die Möglichkeit Erschöpfungsmerkmale unter „Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind“ zu verschlüsseln (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010, S. 607). So kann der hierzu zählende ICD-Code R53 „Unwohlsein und Ermüdung“ verwendet werden. Er wird umschrieben mit allgemeinen körperlichen Abbau, Asthenie, Lethargie, Müdigkeit, chronische, nervöse oder Schwäche ohne nähere Angabe. Allerdings ist auch hier die Abdeckung durch den Leistungskatalog der Krankenkassen eher fraglich und zugleich werden durch diese Verschlüsselung die Merkmale von Burnout stark reduziert.
Löst man sich jedoch etwas von dem Begriff Burnout, so kann man im ICD-10 ein Burn- out ähnelndes psychisches Störungsbild finden, welches zu den „Neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen“ zählt. „Neurasthenie“ (F 48.0) wird dabei als eine Form geis- tiger Ermüdbarkeit und Konzentrationsschwäche oder als körperliche Erschöpfung mit Schmerzempfindungen und einer Unfähigkeit, sich zu entspannen definiert. Begleitet wird dieser Zustand von unangenehmen somatischen Symptomen und oftmals Schlafstörungen, Reizbarkeit, Depression und Angst (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010). Allerdings lassen sich in der Literatur zu Burnout kaum Bezüge auf diese Störung finden. Nur punktuell wird diskutiert, ob Burnout und Neurasthenie vergleichbar sind, wie berichtet in der Arbeit von Hillert und Marwitz (2008), oder eher voneinander abzugren- zen sind, wie in von Känel‘s Review (2008) zu finden ist[3]. Diagnostisch hingegen ist die Lage zwar ebenso wenig aufklärend, jedoch klar geregelt: Laut ICD-10 schließt die Diagnose Neu- rasthenie (F48.0) die Zusatzcodierung Burn-out-Syndrom (Z73) genauso wie Unwohlsein und Ermüdung (R53) aus.
Wie beschrieben steht Burnout in Zusammenhang mit einer Reihe von psychischen Er- krankungen. Dazu zählen Depression, Belastungs- oder Angststörungen (Burisch, 2006; Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993; von Känel, 2008). Aufgrund der geschilderten diagnos- tischen und definitorischen Unklarheiten bleibt unbeantwortet, ob es sich bei den betrachte- ten Merkmalen tatsächlich um Symptome oder Folgen eines Burnout-Syndroms handelt. Ebenso kann es sich um Symptome komorbider, bzw. assoziierter Erkrankungen handeln. Insofern erscheint der durch das ICD-10 vorgegebene Weg, Burnout in der klinischen Praxis als Zusatzcodierung zu verschlüsseln, naheliegend. Da Burnout aber auch als eigenständige Erkrankung diskutiert wird, folgen nachstehend ein Versuch der Abgrenzung zu assoziierten Störungen und eine differenzialdiagnostische Betrachtung von Burnout.
2.1.4. Differentialdiagnose
Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, ist Burnout ein Stresssyndrom, das insbesondere von chronischer Erschöpfung mit Auswirkungen auf emotionaler, kognitiver und physischer Ebene gekennzeichnet ist. Betrachtet man diese als Kardinalsymptom, so ist augenschein- lich, dass Burnout neben Konzentrationsproblemen und körperlichen Beschwerden mit Schläfrigkeit bis Hypersomnie einhergehen kann. Folglich sind im diagnostischen Prozess zunächst somatische Ursachen sowie andere Gründe für Schlafstörungen oder auch gemin- derten Antrieb zu überprüfen und auszuschließen (zum Beispiel Chronique-Fatigue- Syndrome, G93.3; vgl. von Känel, 2008; oder Schlaf-Apnoe, G47.3; Hypothyreose, E03 und Nebenniereninsuffizienz bzw. Morbus Addison, E27.1). Zu beachten ist daneben, dass eine primäre Nebenniereninsuffizienz auch mit spätem Krankheitsbeginn autoimmunologisch ver- ursacht sein kann[4] oder als tertiäre Form durch eine abrupt endende Glucocorticoid- behandlung entstehen kann. Insofern liegt zur diagnostischen Abklärung ein ACTH-Kurztest nahe (Siewert, Rothmund, & Schumpelick, 2007). Die Deutsche Agentur für Health Technology Assesment (2010) weist darauf hin, dass auf somatischer Ebene außerdem Anämien, Eisenmangel, Herzinsuffizienz, Leukämien, Malignome, entzündliche Systemerkrankungen, degenerative Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder Medikamentennebenwirkungen abzuklären sind. Wenig überraschend ist, dass diese Vor- schläge an die Differentialdiagnose von Depression erinnern. Entsprechend von Känel’s Re- view geht schweres Burnout in 53 % der Fälle mit depressiven Störungen einher, obwohl die Prävalenzrate für Depression alleine weit niedriger im einstelligen Bereich liegt. Folglich scheint es zentral, das Burnoutkonzept von Depression abzugrenzen. Bakker und Kollegen (2000) berichten von Befunden, wonach die Konzepte Depression und emotionale Erschöp- fung 26 % ihrer Varianz teilen (Schaufeli & Enzmann, 1998). Der gemeinsame Varianzanteil erscheint aufgrund der sich ähnelnden Ätiologie plausibel, ohne dass die beiden Konzepte jedoch isomorph sein müssen (Glass & McKnight, 1996; zitiert nach Shirom et al., 2005). Ein konzeptioneller Unterschied scheint auch dadurch bekräftigt, dass nicht jeder anhaltenden Erschöpfung eine depressive Störung folgt, bzw. umgekehrt (von Känel, 2008). Entspre- chend konnte in einer niederländischen Studie Burnout (gemessen mit dem MBI) faktoranalytisch von Depression (gemessen mit der Center for Epidemiologic Studies De- pression Scale, CES-D; Radloff, 1977) getrennt werden (Bakker et al., 2000). In dieser Stu- die gibt es außerdem Belege dafür, dass Burnout situativ begrenzter und kontextspezifischer ist im Vergleich zu Depression (vgl. auch Shirom et al., 2005). Maslach, Schaufeli und Leiter (2001) berichten hierzu von ähnlichen Befunden (vgl. Glass & McKnight, 1996). Ebenso konnten weitere Studien berufsbezogene Neurasthenie von anderen psychischen Er- krankungen unterscheiden (Schaufeli et al., 2001; zitiert nach Maslach & Leiter, 2008). Na- heliegend ist daneben ebenso eine Sicht, wonach Burnout eine Entwicklungsphase von De- pression sein kann (Ahola et al., 2009; zitiert nach Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010; vgl. Befunde von Glass, McKnight, & Valdimarsdotter, 1993; zitiert nach Shirom et al., 2005). Ähnlich argumentiert auch Brühlmann (2009, S.5), dass es fließende Übergänge von „präklinische(n) Burnout-Zuständen“ über „Erschöpfungsdepressi- on“ zu einer „typischen Depression“ gibt.
Bei Betrachtung dieser Befunde und der Konzeptualisierung von Burnout und Depressi- on erschließt sich eine Möglichkeit, wie diese voneinander abgrenzbar sind. Als Kriterien für die Diagnose Depression sind in Manualen wie dem ICD-10 die Kardinalsymptome Nieder- geschlagenheit, Interessenverlust, Freudlosigkeit und verminderter Antrieb über mindestens zwei Wochen als notwendig aufgeführt (Deutsches Insitut für Medizinische Dokumentation und Information, 2010). Von Känel (2008) schlägt daher vor, dass für eine Differenzialdiag- nose Patienten gefragt werden sollten, ob sie - unter der Annahme, sie seien weniger nie- dergeschlagen, bzw. erschöpft - Interesse an Tätigkeiten mit höherem Aktivitätslevel haben. Zwar sind Rückzugsverhalten und verminderter Antrieb sowohl bei Depression wie bei Burn- out zu finden, allerdings wird angenommen, dass sich Personen mit Burnout eher aufgrund von Erschöpfung und Müdigkeit als aufgrund von einer generellen Interesselosigkeit zurück- ziehen. Insofern würden Personen mit Burnout ein grundlegendes Interesse bekunden, wel- ches sie jedoch aufgrund ihrer Erschöpfung nicht ausleben. Personen mit Depression wür- den entsprechend dieser Annahme jedoch keine eigene Motivation zeigen (von Känel, 2008). Weiterführendes zur Differentialdiagnostik von Burnout findet sich in dem Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI; Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010) oder in dem Überblickskapitel von Maslach und Schaufeli (1993).
2.1.5. Häufigkeit und Relevanz
„Burnout unter den Arbeitskräften Nordamerika nimmt seuchenartige Ausmaße an. Das liegt nicht so sehr daran, dass mit uns etwas nicht mehr stimmt, sondern eher daran, dass es fundamentale Veränderungen am Arbeitsplatz und an der Art unserer Berufe gegeben hat. Der heutige Arbeitsplatz ist meist ein kaltes, fahles, forderndes Umfeld, sowohl in wirtschaftlicher als auch in psychologischer Hinsicht.“ (Maslach & Leiter, 2001, S. 1)
Burnout wurde bereits vor über zehn Jahren als „gesamtgesellschaftliches Phänomen der westlichen Welt“ gesehen (Erhart & Meyer, 1997, S. 115) und scheint auch schon we- sentlich früher von zentralem Interesse gewesen zu sein (siehe 2.1.1). Gleichzeitig taucht Burnout aber gerade auch beständig mit aktuellem Bezug auf und ist „derzeit nicht zuletzt auch ein boomender Markt“ (Hillert & Marwitz, 2008, S. 240). Insofern scheint es grundle- gend wichtig, das Ausmaß des Auftretens und der Folgen von Burnout etwas genauer zu be- trachten. Zunächst jedoch einige Einschränkungen, die Statistiken über Burnout betreffen.
Das Auftreten von Burnout beschränkt sich weder auf Berufstätige noch auf bestimmte Branchen. Dennoch bezieht sich die Mehrheit der Statistiken über Erschöpfungszustände auf den Arbeitnehmerbereich und darunter insbesondere soziale und pflegerische oder Dienst- leistungsberufe. Betrachtet man die durch psychische Erkrankungen bedingten Arbeitsunfä- higkeitstage kann der Eindruck verstärkt werden, dass diese Berufsgruppe besonders belas- tet ist. So entfielen im Jahr 2008 auf jeden Beschäftigten im Sozialwesen knapp 27 Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das sind etwa doppelt so viele, wie im Durchschnitt. Gleichzeitig weist jedoch die oftmals weniger beachtete Gruppe der Erwerbslosen eine um das 4,5-fache erhöhte Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen auf- grund von psychischen Erkrankungen gegenüber dem Mittel auf (BKK Bundesverband, 2009). In Burisch (2006) lassen sich hierzu Befunde zu Burnout in etwa 60 verschiedenen Berufs- und Personengruppen finden. Darunter Lehr- und Pflegepersonal (Skinner, 1979), Journalisten (Bodin, 2000), Anwälte (Petermann & Studer, 2003), Privatpersonen (Pines & Aronson, 1988) und auch Erwerbslose (Kasl, Gore, & Cobb, 1975).
Generell gibt es nur wenige Statistiken zu Burnout und häufig lassen sich nur Angaben über die Prävalenz psychischer Erkrankungen allgemein finden. Hat man hingegen Befunde über die Häufigkeit von Burnout vorliegen, so sind diese von der Heterogenität der verwen- deten Definitionskriterien oder Messinstrumente beeinflusst (von Känel, 2008). Gleichzeitig kommt hinzu, dass Aussagen über die Auftretenshäufigkeit dieses Phänomens einerseits von direkten Umgebungsvariablen geprägt sind. Hierzu zählen beispielsweise der Arbeits- platz oder das familiäre Umfeld. Andererseits wirken sich aber auch indirekte, vergleichswei- se schwer abschätzbare Variablen wie arbeitsmarkt- und rentenpolitische Gesetzgebungen auf die Prävalenzrate aus. Ebenso muss der diagnostische Habitus von Haus- oder Klinik- ärzten als solch ein Faktor betrachtet werden (Burisch, 2006). Gerade wegen diagnostischer Unklarheiten darf dieser Umstand bei Burnout nicht unterschätzt werden. Ein Beispiel für in- direkte Einflussfaktoren legen die Ergebnisse der vierten europäischen Umfrage zu Arbeits- bedingungen nahe. Hierin wurde festgestellt, dass EU-weit etwa 22 % der Angestellten aus den 25 Mitgliedsstaaten Stress am Arbeitsplatz erfahren. Gleichzeitig gibt es jedoch signifi- kante Unterschiede zwischen den Ländern. So berichten Arbeitnehmer aus den neuen EU- Staaten bis zu 3,5-mal häufiger über Stress als Arbeitnehmer aus den Ländern, die bereits vor 2004 Mitglied waren (European Agency for Safety and Health at Work, 2009).
Dementsprechend unterschiedlich fallen auch Angaben über die Auftretenshäufigkeit von Burnout aus. Vergleicht man internationale Befunde zur Prävalenz, so kommt Burnout in acht bis 82 % der Fälle vor (Prins et al., 2007; zitiert nach von Känel, 2008; European Agency for Safety and Health at Work, 2009). In der Regel bewegen sich die Angaben jedoch im unteren Viertel dieses Bereichs. So wird über Burnout[5] bei acht bis elf Prozent der niederländischen Angestellten zwischen den Jahren 1997 und 2004 (European Agency for Safety and Health at Work, 2009), über mittelschweres Burnout bei 33 % und schweres Burnout bei vier Prozent der europäischen Bevölkerung (Goehring, Bouvier-Gallacchi, Künzl, & Bovier, 2005), über Burnout bei etwa 20 % der dänischen Pfleger (Borritz et al., 2006) sowie fortgeschrittenes Burnout bei 20 % der nordamerikanischen Arbeitnehmehr berichtet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Häufiger scheint dieser Zustand jedoch bei asiatischen und osteuropäischen Arbeitnehmern (Burnout bei durchschnittlich 28 %, Varianz 12 - 69 %) und insbesondere japanischen und taiwanesischen Angestellte vorzukommen (Burnout bei durchschnittlich 48 % - 69 %; Maslach, Schaufeli, & Leiter 2001). Bezogen auf Deutschland sind laut einer repräsentativen Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits- medizin (2010) im Jahr 2006 sieben Prozent der Erwerbstätigen von Burnout betroffen. Da- neben berichten weitere rund 18 % über Niedergeschlagenheit, 27 % von Nervosität oder Reizbarkeit und 43 % über allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung. Im Vergleich dazu liegt die Prävalenzrate für Depression bei etwa vier Prozent. Bemerkenswert ist dane- ben der Prozentsatz der Betroffenen, die sich bei einem Arzt oder Therapeuten behandeln lassen. Während es bei einer Depression immerhin etwa 54 % sind, suchen wegen Burnout nur knapp 28 % der Betroffenen eine Therapie auf.
Mindestens ebenso unklar ist zu beantworten, ob sich die Prävalenzrate von Burnout verändert. Anhaltspunkte hierfür lassen sich jedoch aus Entwicklungen der Arbeitsunfähig- keitsrate gewinnen. Trotz eines generell rückläufigen Krankenstands und einer annähernden Halbierung der Krankheitszeiten über die letzten zwei Jahrzehnte[6], nehmen die durch psy- chische Krankheiten verursachten Arbeitsunfähigkeitstage deutlich zu. Der Anteil der durch psychische Erkrankung bedingten Fehlzeiten ist zwischen 2003 und 2008 um 51 % gestie- gen. Somit stehen diese an zweit- (BARMER Gesundheitsreport, 2009), bzw. dritthäufigster Stelle der für Fehlzeiten verantwortlichen Erkrankungen (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2007). Bemerkenswert ist überdies, dass psychische Erkrankung mit rund 23 Behandlungstagen je Fall eine um etwa 65 % längere Behandlungszeit haben, als alle ande- ren Erkrankungen durchschnittlich (Badura, Schröder, Klose, & Macco, 2010). Es erweckt den Eindruck, als ob Burnout hierbei eine wesentliche Rolle spielt: Während die Betriebs- krankenkassen im Jahr 2004 noch 4,6 burnoutbedingte Arbeitsunfähigkeitstage je 1000 be- schäftigter Mitglieder registriert haben, ist diese Zahl vier Jahre später auf fast 35 angestie- gen (BKK Bundesverband, 2009). Gleichwohl ist zu hinterfragen, inwiefern dieser Anstieg die Auftretenshäufigkeit von Burnout widerspiegelt oder lediglich die Verwendung des Zusatzcodes Z73 laut ICD-10. Dennoch geht etwa Burisch (2006) von einer Zunahme der Burnout-Prävalenzrate aus.
Unabhängig davon kann zumindest der Zusammenhang zwischen Fehlzeiten und Burnout, bzw. Erschöpfung durch eine Reihe von Befunden bestätigt werden (Ahola et al., 2008; Schaufeli, Bakker, & van Rhenen, 2009; Leone, Huibers, Knottnerus, & Kant, 2007; van Amelsvoort, Kant, Beurskens, Schröer, & Swaen, 2002; Toppinen-Tanner et al., 2005). Konkret berichtet die Arbeitsgruppe um Borritz (2006), dass unabhängig von Alter, Geschlecht, Lebensstil, familiärem und sozioökonomischem Status oder Erkrankungen der Anstieg um eine Standardabweichung auf der Skala Arbeitsburnout des Copenhagen Burn- out Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005) einem Anstieg der krank- heitsbedingten Fehltage um neun Prozent entspricht (eine Veranschaulichung ist im Anhang 7.1). Gleichzeitig schätzt die europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, dass europaweit etwa 60 % aller Fehlzeiten auf beruflichen Stress zurückzuführen sind (siehe Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010).
Die Relevanz des Phänomens Burnout kann man neben der Prävalenzrate insbesonde- re an den indirekten, direkten und intangiblen Kosten ablesen. Die intangiblen Kosten betref- fen die Lebensqualität und wurden bereits in 2.1.2 beschrieben. Zu den indirekten und direk- ten, also volkswirtschaftlichen und medizinischen Kosten tragen insbesondere die Kosten für die Behandlung von Burnout und die durch Burnout entstandenen Arbeitsfehltage bei. Hierü- ber konnten keine direkten Angaben gefunden werden. Allerdings lässt sich ein Eindruck über einen damit primär assoziierten Faktor erhalten. Laut aktuellen Schätzungen belaufen sich die Kosten für Stress am Arbeitsplatz und den damit in Verbindung stehenden psychischen Probleme auf drei bis vier Prozent des Bruttoinlandprodukts. Demnach wäre das für Deutschland im letzten Jahr etwa 72 bis 96 Milliarden Euro und in Summe EU-weit 265 Milliarden Euro jährlich (Levi, 2002). Etwas geringer beziffert Koningsveld (2003) auf Basis von niederländischen Daten die Gesamtkosten für schlechte Arbetisbedingungen mit etwa drei Prozent des Bruttoinlandprodukts. Umgerechnet entstehen so je Arbeitnehmer Kosten von rund 530 Euro durch Arbeitsunfähigkeit und weitere rund 130 Euro durch die therapeutische Behandlung. Hiervon sind 40 % durch psychische Erkrankungen bedingt (zitiert nach European Agency for Safety and Health at Work, 2009). Ähnlich benennt der BARMER Gesundheitsreport (2009) Kosten psychischer Erkrankungen in Deutschland allein für die Behandlung, Rehabilitation und Pflege in Höhe von knapp 26,7 Milliarden Euro. Be- zogen auf Stress wird geschätzt, dass Arbeitgebern hierdurch Kosten von 20 Milliarden Euro jährlich entstehen (siehe Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010). Hinzu kommen der auf psychische Erkrankungen zurückzuführende Produktionsaus- fall in Höhe von vier Milliarden Euro und der Ausfall an Bruttowertschöpfung in Höhe von sieben Milliarden Euro jährlich. Mittelbar hängen mit Burnout jedoch noch weitere medizini- sche und betriebs-, bzw. volkswirtschaftliche Kosten zusammen. So treten im Zusammenhang mit Burnout häufig Verhaltensweisen wie Alkoholmissbrauch (Fagin et al., 1996), vermehrtes Rauchen, ein Wechsel der Arbeitsstelle (Wright & Cropanzano, 1998; Taylor, Daniel, Leith, & Burke, 1990), oder generell weniger Einsatz und Vorbereitung für die aktuelle Tätigkeit auf (Lee & Shin, 2005). Gleichzeitig ist Burnout auch ein Prädiktor für Depression (Ahola et al., 2009; Hakanen, Schaufeli, & Ahola, 2008) und Diabetes Typ 2 (Melamend, Shirom, Toker, & Shapira, 2006). Zu den langfristigen Kosten kann man außerdem die vermehrten Behandlungsfehler durch burnoutbetroffene Ärzte zählen (West et al., 2006) oder eine reduzierte Leistung von burnoutbetroffenen Schülern (Salamela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi, 2009; beide Angaben zitiert nach Deutsche Agentur für Health Technology Assesment, DAHTA, 2010).
Bereits auf Basis der vorliegenden und unvollständigen Datenlage wird klar, dass Burnout, Erschöpfungszustände und auch Stress, insbesondere am Arbeitsplatz, weitreichende Folgen haben. Einerseits liegt es an der Forschung, die noch vorhandenen Wissenslücken zu diesen Themen zu schließen. Andererseits ist es jedoch von wesentlicher Bedeutung, zunächst Unklarheiten auszuräumen und grundlegende Voraussetzungen für solche Untersuchungen zu schaffen. Gleichzeitig begründet sich hierin auch das Ziel dieser Arbeit, einen Beitrag zum Verständnis von Burnout liefern zu können.
Den ersten Teil der theoretischen Grundlagen abschließend folgt nun eine Betrachtung der mit Burnout assoziierten pathogenetischen Faktoren. Auch an dieser Stelle wird zugunsten einer engeren thematischen Eingrenzung auf die Beschreibung theoretischer Modelle der Burnoutgenese verzichtet und stattdessen lediglich die angedeuteten Befunde zu Risikofaktoren angeführt. Interessierte finden eine Übersicht zu etwa 20 verschiedenen Theorien zur Entstehung von Burnout in Burisch (2006).
2.1.6. Ätiologie und Risikofaktoren
Nachdem bisher die Erscheinungsform und Folgen von Burnout beschrieben wurden werden nun die vorangehenden Einflussfaktoren betrachtet. Wenngleich durch die vorange- gangene Beschreibung von Burnout die wesentliche Rolle von chronischem Stress und Be- lastung offensichtlich geworden ist (Bültmann et al., 2002; McManus, Winder, & Gordon, 2002; vgl. Burisch, 2006; vgl. Hillert & Marwitz, 2008), so beinhaltet das ein recht oberflächli- ches Verständnis über die Entstehung von Burnout. Deshalb wird an dieser Stelle nicht da- rauf verzichtet, einen Überblick über Befunde und Annahmen zu beteiligten Faktoren zu ge- ben.
Burnout wie Gesundheitsprobleme generell weisen nur einen geringen linearen Zusam- menhang zu Belastungsfaktoren per se auf, wie beispielsweise der Anzahl an Arbeitsstun- den (vgl. Beermann, Brenscheidt, & Siefer, 2008, vgl. Sparks, Cooper, Fried, & Shirom, 1997). Vielmehr stehen Arbeitsbedingungen und dauerhaft auftretender Stress in Interaktion mit individuellen (Pruessner, Hellhammer, & Kirschbaum, 1999), aber auch sozialen Variab- len (Cordes & Dougherty, 1993). Diese werden nachfolgend überblicksartig in den Bereichen Persönlichkeitseigenschaften und Kontextfaktoren besprochen. Allerdings muss angemerkt werden, dass gängige statistische Analysen kaum den individuellen pathogenetischen Ent- wicklungsverläufen gerecht werden oder die dynamisch-komplexen Interaktionen beteiligter Faktoren erfassen können (Schaufeli & Enzmann, 1998; von Känel, 2008).
Bei Betrachtung persönlichkeitsseitiger Risikofaktoren für Burnout zeigt sich erneut eine Ähnlichkeit zwischen Depression und Erschöpfung. Alternativ kann auch argumentiert wer- den, dass sich bestimmten Faktoren ein breites Wirkungsspektrum zuschreiben lässt. So korrelieren externe Kontrollüberzeugung und ein geringes Selbstkonzept signifikant negativ mit der Skala emotionale Erschöpfung des MBI (Pruessner, Hellhammer, & Kirschbaum, 1999; vgl. Hillert & Marwitz, 2008). Gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen Neurotizsmus und der Skala „Berufsspezifischer Stress“ des Lehrer-Burnout-Fragebogens (Seidman & Zager, 1987; siehe Maslach & Leiter, 2008; vgl. Lagelaan, Bakker, van Doornen, & Schaufeli, 2006). Ähnlich zitiert von Känel (2008) Ergebnisse, die autoritären und zwang- haften Personen mit Angst vor Kontrollverlust und damit einhergehender geringer Neigung Hilfe anzunehmen, ein erhöhtes Burnoutrisiko unterstellen (Gillespie & Melby, 2003). Nahe- liegend ist gleichzeitig eine Interaktion zwischen äußeren Umständen und der persönlichen Einstellung, bzw. Erwartung. So wird diskutiert, ob enttäuschte Erwartungen (Schwab,Jackson, & Schuler, 1986; vgl. Lauderdale, 1982; vgl. Burisch, 2006), genau wie ein über- höhtes Engagement zu Burnout oder damit verbundenen Erkrankungen führen (Siegrist, 1996; vgl. von Känel, 2008). Befunde hierzu sind jedoch heterogen und weisen darauf hin, dass weitere Faktoren einen Einfluss haben. Werden Erwartungen enttäuscht, müssen diese nicht unbedingt aufrecht erhalten, sondern können korrigiert werden. Naheliegend ist ebenso eine unterschiedliche Wirkweise, je nachdem, ob die Tätigkeit ein zentrales oder vergleichsweise randständiges Interessengebiet darstellt (vgl. Cordes & Dougherty, 1993; Brühlmann, 2007). Befunde über den Zusammenhang zwischen Burnout und demografischen Variablen können in diese Richtung interpretiert werden. So klagen jüngere sowie unverheiratete Mitarbeiter mehr über Erschöpfung und haben höhere Ausprägungen bei Burnout (vgl. Hillert & Marwitz, 2008). Maslach, Schaufeli und Leiter (2001) sprechen sogar davon, dass Alter die demografische Variable ist, die am konsistentesten mit Burnout assoziiert ist und weisen berechtigterweise auf eine starke Konfundierung mit (arbeitsgebundener) Erfahrung hin. Dennoch wurde bisher kein moderierender Effekt dieser demografischen Variablen bestätigt (siehe Cordes & Dougherty, 1993).
Geschlechtsunterschiede scheint es unabhängig davon kaum zu geben (siehe Hillert & Marwitz, 2008; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).
Kontextfaktoren konnten in zahlreichen Studien als Einflussvariable zu Burnout festge- stellt werden. Zunächst lassen sich hierzu abpuffernde Faktoren zählen. Insbesondere die Ressource soziale Unterstützung (Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2010; Schwab, Jackson, & Schuler, 1986) von Kollegen, aber noch wichtiger von Vorgesetzten, hängt kon- sistent invers mit Burnout zusammen (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Einerseits trägt sie unabhängig von Stressoren zu einem höheren Wohlbefinden bei und kann so moderie- rend wirken. Andererseits kann soziale Unterstützung als Ressource die Überzeugung in die Bewältigbarkeit einer Situation erhöhen. Desweiteren kann der Ehepartner oder die Familie soziale Unterstützung vermitteln, indem diese eine innere Distanzierung von der Arbeit för- dern und so zu einer effektiveren Erholungszeit beitragen (Cordes & Dougherty, 1993). Ver- deutlicht wird dieser Einfluss dadurch, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit für Burnout bei unverheirateten gegenüber verheiratet Männern besteht. Ähnliches scheint für Alleinstehen- de im Vergleich zu Verheirateten und sogar Alleinstehende im Vergleich zu Geschiedenen zu gelten (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Soziale Unterstützung am Arbeitsplatz kann durch Informationen oder über positive Rückmeldungen vermittelt werden. Daneben wird das Nichtvorhandensein eines Schutzfaktors häufig gleichgesetzt mit der Wirkung von Risikofak- toren. So hängt ein Mangel an Rückmeldung und sozialer Unterstützung (vgl. Hillert & Marwitz, 2008; vgl. von Känel, 2008) ebenso wie wenig Teilhabe an Entscheidungsprozes- sen und wenig Autonomie mit Burnout zusammen (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Nahrgang, Morgeson, Hofman, 2010; Schwab, Jackson, & Schuler, 1986; vgl. Karasek & Theorell, 1990). Damit einhergehend und wiederholt als burnoutbezogener Einflussfaktor be- legt, ist ein Gefühl von situativer Kontrollierbarkeit (Chandola, Heraclides, & Kumari, 2010; Cooper, 2000). Desweiteren kann man hierin in derselben Weise hohe terminliche, quantita- tive oder qualitative Arbeitsbelastung (Cordes & Dougherty, 1993; vgl. Maslach & Leiter, 2001; Maslach & Leiter, 2008) ebenso wie risikoreiche, gefährliche und komplexe Aufgaben einreihen (Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2010). Quantitative Anforderungen wurden auch in einer umfangreichen prospektiven dänischen Studie als Faktor, der am höchsten mit der Skala Arbeitsburnout des Copenhagen Burnout Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005) zusammenhägt gefunden (r = .48; Borritz et al., 2006). Daneben muss der geschilderte Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung und Burnout jedoch auch in Relation zum Ausmaß an Erholung und Ruhephasen gesehen werden (vgl. Maslach & Leiter, 2008).
In ihrer Studie berichten Borritz und Kollegen (2006), das mit konflikthaften oder mehrdeutigen Rollen erhöhte Burnoutwerte einher gehen (vgl. Cordes & Doughtery, 1993; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Diese können als Resultat unterschiedlicher Erwartun- gen oder ungenügender, bzw. widersprüchlicher Informationen über die auszuführende Tä- tigkeit entstehen. Diese Faktoren hängen in unterschiedlichen Studien verschieden stark in inverser Richtung mit den einzelnen Burnout-Komponenten zusammen (Cordes & Dougherty, 1993; Maslach & Leiter, 2001). Ähnlich verweisen Befunde von Maslach und Lei- ter (2008) auf ein erhöhtes Burnoutrisiko, wenn wahrgenommene persönliche Fähigkeiten nicht zu den arbeitsgebundenen Anforderungen passen (vgl. French, Rodgers, & Cobb, 1974). Weitere Befunde zeigen, dass ein Ungleichgewicht zwischen erwarteter und erhalte- ner Anerkennung zu einem reduziertem Pflichtgefühl, Abwesenheit oder Diebstahl bei der Arbeit sowie Burnout führt (Taris, van Horn, Schaufeli, & Schreurs, 2004; vgl. Adams, 1965; vgl. Buunk & Schaufeli, 1999; vgl. Siegrist, 1996). Die erwartete Anerkennung orientiert sich dabei an der investierten Zeit, den erforderlichen Fähigkeiten und Anstrengung. Die erhalte- ne Belohnung kann aus sozialen, intrinsischen oder finanziellen Entschädigungen bestehen (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Generell zeigt sich insbesondere die Kombination aus hohen Anforderungen, geringem Handlungsspielraum und Kontrolle, unfairer oder zu gerin- ger Entlohnung für Geleistetes sowie wenig soziale Unterstützung als Prädiktor für Burnout (Hillert & Marwitz, 2008; von Känel, 2008). Dabei spielen die objektiven Gegebenheiten bei- spielsweise bei der Beurteilung von Fairness gegenüber der subjektiven Wahrnehmung eine geringere Rolle (Maslach & Leiter, 2008). Schließlich wird berichtet, dass Beschäftigte, deren Kontakt mit Klienten nicht nur direkt, häufig und langandauernd ist, sondern insbesondere intensiv und stark emotional ist, ein höheres Burnoutrisiko haben (Cordes & Dougherty, 1993). Diskutabel ist, inwieweit in solchen Kontexten eine solche erwähnte Interaktion aus mehreren Risikofaktoren wie vergleichsweise geringer Anerkennung und Entschädigung,ungenügender oder negativer Rückmeldung, komplexer Arbeitsbelastung mit einem hohen Maß an Verantwortung und geringer Kontrollierbarkeit vorhanden ist (vgl. Iseringhausen, 2009).
Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fasst einige dieser Faktoren in einer Tabelle zusammen. Demnach sind eintönige, unbedeutende Arbeiten unter hoher Unsicherheit und wenig flexiblen sowie langen Arbeitszeiten starke psychosoziale Belastungsfaktoren. Sind Mitarbeiter wenig in Entscheidungsprozesse einbezogen, haben eine unzureichende Ausstattung, erleben Rollenkonflikte und wenig sozialen Kontakt, ist es wahrscheinlich, dass die Produktivität und Gesundheit der Mitarbeiter, die Qualität der Produktion und das betriebliche Klima darunter leiden (European Agency for Safety and Health at Work, 2010; siehe Tabelle 2). Eine Darstellung zu betrieblichen Stressfaktoren lässt sich auch bei Bamberg, Ducki, und Metz (1998) finden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Nature of psychosocial hazards at work (European Agency for Safety and Health at Work, 2010)
Abschließend findet sich ein zusammenfassendes Modell (Abbildung 1), welches sich aus den vorgestellten Befunden über Faktoren der Burnoutgenese ergibt. Es beschreibt die Interaktion von persönlichen und kontextseitigen Risikofaktoren und Ressourcen, die in ei- nem sich verstärkenden Prozess enden und so zu Burnout führen können. Diese Faktoren umfassen wesentlich die eigene tätigkeitsbezogene Erfahrung, die Erwartungen und das primäre Interessengebiet, welche in einer ungünstigen Konstellation zu Frustration führen kann. Wird diese durch eine hohe Arbeitsbelastung und ungenügende Informationen ver- stärkt, ohne dass ein ausreichendes Selbstkonzept, Kompetenzen, Handlungsspielraum oder Unterstützung von außen diese abpuffern können, kann Erschöpfung entstehen. Hier- durch resultiert schließlich ein verringerter Einsatz für die Tätigkeit, welche aufgrund der schlechteren Leistung zu negativer Rückmeldung führt. Diese verstärken einerseits bereits vorangegangene Leistungseinbußen und Verstimmungen sowie indirekt Erschöpfung auf emotionaler, kognitiver und physischer Ebene. Begleitet werden sie etwa von einem reduzierten Selbstwert und psychosomatischen Beschwerden.
Im nachfolgenden zweiten Teil der theoretischen Grundlagen wird kurz das Neuropattern™-Verfahren vorgestellt, mit dem die Daten für die vorliegende Arbeit gewonnen wurden. Durch eine Fokussierung auf das, den erhobenen Parametern zugrunde liegende, biopsychologische Stressmodell wird abschließend auf die Fragestellungen dieser Arbeit hingeführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Von Känel (2008) berichtet beispielsweise, dass bereits Goethe über solche Beschwerden klagte. Burisch berichtet dies von Shakespeare und verweist sogar auf Stellen des Alten Testaments, in denen Beschreibungen von Erschöpfungszuständen zu erkennen seien (2. Mose 18, 17-18; zitiert nach Burisch, 2006).
[2] Die in der Tabelle aufgeführten Symptome werden mit weiteren mit weiteren Belegen ergänzt.
[3] Allerdings sind auch hier keine Vorschläge zu finden, wie das geschehen sollte, oder worin der Unterschied ge- nau liegt.
[4] Oftmals tritt Morbus Addison bei einem polyglandulären Autoimmunsyndrom (Typ 1 oder 2) auf, welches gelegentlich bis häufig auch mit Hypothyreose, bzw. Hypoparathyreodismus und Diabetes mellitus Typ 1 einher geht (Siewert, Rothmund, & Schumpelick, 2007).
[5] Soweit verfügbar, wir die in der jeweiligen Arbeit berichteten Ausprägungsschwere angegeben, andernfalls bezieht sich die Angabe auf ein generelles Vorliegen von Burnout.
[6] Indes ist seit 2006 jedoch erstmals wieder ein Anstieg des durchschnittlichen Krankenstandes zu erkennen (BKK Bundesverband, 2009).
- Arbeit zitieren
- Sandra Waeldin (Autor:in), 2011, Ausgebrannt? Eine Suche nach „Erschöpfungs-Pattern“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178784
Kostenlos Autor werden



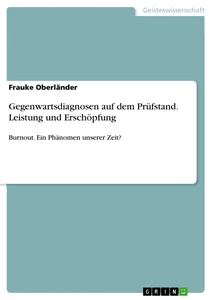















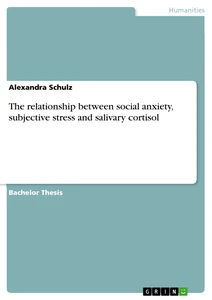
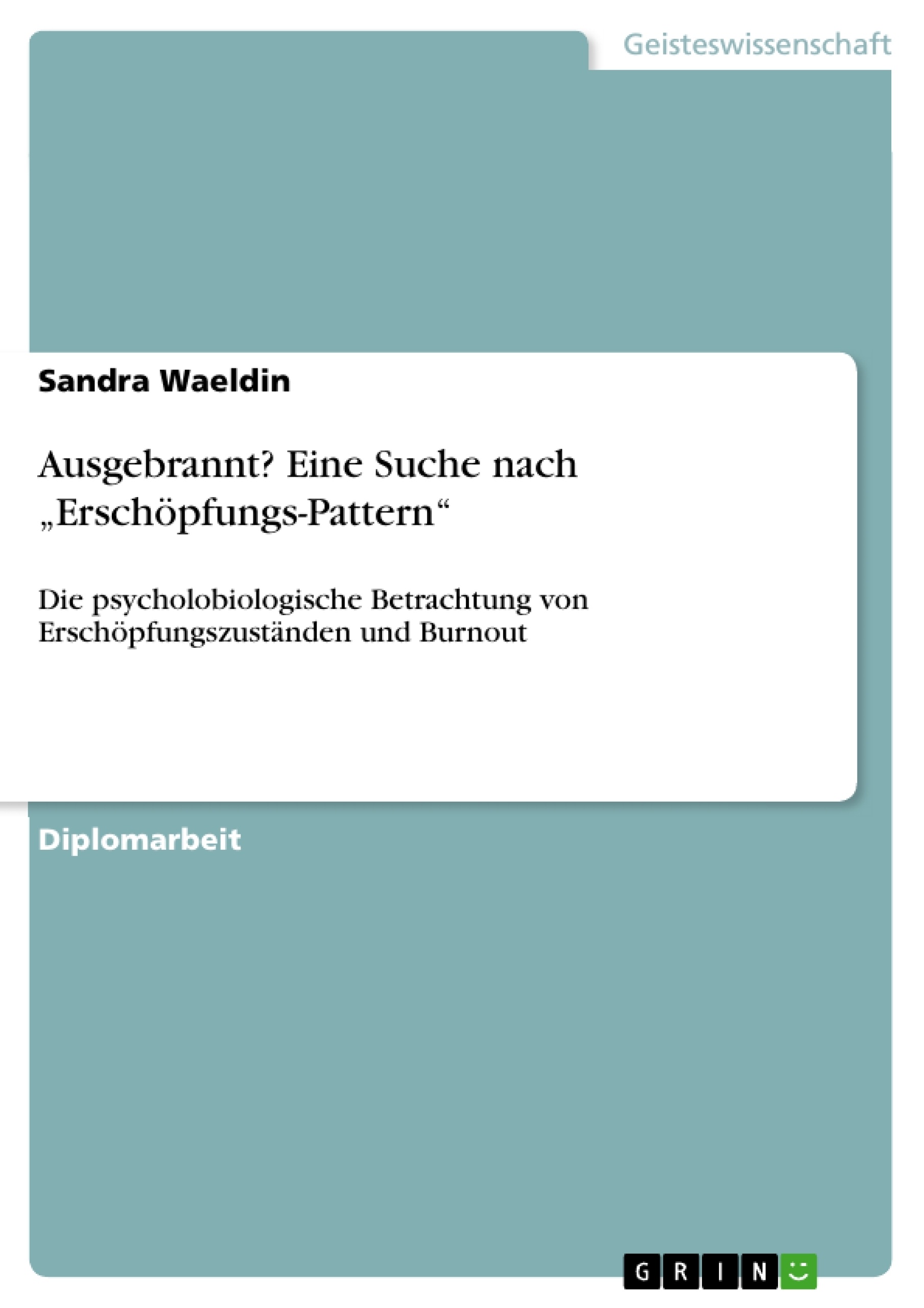

Kommentare