Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Carl Rogers Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischen- menschlichen Beziehungen
2.1 Die Entwicklung der Rogers-Theorie
2.2 Aktualisierungstendenz
2.3 Die Bedeutung der Therapeuten-Klienten-Beziehung
2.3.1 Kongruenz
2.3.2 Bedingungslose Wertschätzung
2.3.3 Empathie
2.4 Psychotherapieforschung
2.4.1 Gesprächspsychotherapieforschung
2.4.2 Allgemeine Psychotherapieforschung
3 Coaching
3.1 Grundlagen des Coaching
3.2 Coaching-Ansätze
3.3 Qualität von Coaching
3.3.1 Coach-Klienten-Beziehung
3.4 Aktueller Stand der Coachingforschung
3.5 Coaching und Psychotherapie
3.5.1 Differenz und Konvergenz
3.5.2 Personzentriertes Coaching
4 Arbeitszufriedenheit
4.1 Die Motivationstheorie von Maslow
4.2 Die Herzberg-Theorie
4.3 Das Modell von Bruggemann
5 Fragestellungen und Arbeitshypothesen
5.1 Fragestellungen der Arbeit
5.2 Arbeitshypothesen
6 Methodische Beschreibung der Untersuchung
6.1 Verwendete Tests
6.1.1 Inventar für Beziehungsverhalten (IBV)
6.1.2 Skala zur Messung von Arbeitszufriedenheit (SAZ)
6.2 Untersuchungsdesign
6.2.1 Vorbereitung der Online-Befragung
6.3 Untersuchungsfeld
6.4 Auswertungsmethoden
6.4.1 Skalenniveau der verwendeten Fragebögen
6.4.2 Analyse fehlender Werte
6.4.3 Verteilung des Zahlenmaterials
6.4.4 Test zur Prüfung der Veränderungshypothese bezüglich der Arbeitszufrie- denheit
6.4.5 Test zur Prüfung der Korrelation zwischen Arbeitszufriedenheits- veränderungen und Dimensionen des Beziehungsverhaltens
6.4.6 Festlegung des Signifikanzniveaus Į
7 Ergebnisse
7.1 Analyse der Bewertung des Beziehungsverhaltens beim Coaching
7.1.1 Beschreibung der verschiedenen Dimensionen des Beziehungsverhaltens
7.1.2 Geschlechtsunterschiede bei der Bewertung des Beziehungsverhaltens. .
7.1.3 Zusammenhang zwischen Prozessdauer und Beziehungsverhalten
7.2 Prüfung der Veränderungshypothese der Arbeitszufriedenheit vor und nach dem Coaching
7.3 Prüfung der Korrelation zwischen Arbeitszufriedenheitsveränderungen und Dimensionen des Beziehungsverhaltens
7.3.1 Bivariate Analyse des Einflusses des Beziehungsverhaltens auf die Arbeits- zufriedenheit
7.3.2 Bivariate Analyse des Einflusses des Beziehungsverhaltens auf die „Ent- faltung und Anwendung eigener Fähigkeiten“
7.3.3 Einfluss der statusdiagnostischen Beziehungsverhaltensvariablen auf die Arbeitszufriedenheitsveränderung
7.3.4 Einfluss der statusdiagnostischen Beziehungsverhaltensvariablen auf die Veränderung der „Entfaltung und Anwendung eigener Fähigkeiten“
7.3.5 Einfluss der prozessdiagnostischen Beziehungsverhaltensvariablen auf die Arbeitszufriedenheitsveränderung
7.3.6 Einfluss der prozessdiagnostischen Beziehungsverhaltensvariablen auf die Veränderung der „Entfaltung und Anwendung eigener Fähigkeiten“
7.3.7 Berücksichtigung weiterer Einflüsse auf Veränderungen der Arbeitszufrie- denheit
8 Diskussion der Ergebnisse
8.1 Kritische Betrachtung der Methoden
8.2 Einordnung der Ergebnisse
8.2.1 Das Beziehungsverhalten der Coaches aus der Sicht ihrer Klienten
8.2.2 Bewertung der Arbeitszufriedenheit vor und nach dem Coaching
8.2.3 Tendenzielle Auswirkungen von personzentriertem Beziehungsverhalten auf die Veränderung der Arbeitszufriedenheit
9 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Generic Model of Psychotherapy, nach Orlinsky & Howard 1987
Abbildung 2 Wirkfaktoren nach Asay & Lambert, 2001,
Abbildung 3 Systematisierung der unterschiedlichen Coaching-Varianten, nach Heß & Roth, 2001,
Abbildung 4 Systemischer Coaching-Ansatz, nach Giglio, Diamante & Urban, 1998,
Abbildung 5 Elemente des Coaching, aus Riedel, 2003,
Abbildung 6 Formen der Arbeitszufriedenheit, nach Bruggemann, Grosskurth & Ulich, 1975; vgl. Ulich, 2001,
Abbildung 7 Fragestellung dieser Studie
Abbildung 8 Normalverteilung SAZ-vor-dem-Coaching
Abbildung 9 Normalverteilung SAZ-nach-dem-Coaching
Abbildung 10 Normalverteilung Subskala-vor-dem-Coaching
Abbildung 11 Normalverteilung Subskala-nach-dem-Coaching
Abbildung 12 Normalverteilung Wertschätzung
Abbildung 13 Normalverteilung Empathie
Abbildung 14 Normalverteilung Selbstkongruenz
Abbildung 15 Normalverteilung Akzeptationsbreite
Abbildung 16 Normalverteilung Therapeut. Basisverhalten
Abbildung 17 Normalverteilung Stabilität der Beziehung
Abbildung 18 Mittelwerte Beziehungsverhaltensvariablen
Abbildung 19 Box-Plots Beziehungsverhaltensvariablen
Abbildung 20 Histogramm Wertschätzung
Abbildung 21 Histogramm Empathie
Abbildung 22 Histogramm Selbstkongruenz
Abbildung 23 Histogramm Akzeptationsbreite
Abbildung 24 Histogramm Therapeut. Basisverhalten
Abbildung 25 Histogramm Stabilität der Beziehung
Abbildung 26 Histogramm Beziehungsverhalten - Summe
Abbildung 27 Box-Plots Gesamtarbeitszufriedenheit
Abbildung 28 Box-Plots „Entfaltung und Anwendung eigener Fähigkeiten"
Abbildung 29 Prozentwerte SAZ und Subskala - jeweils vor und nach dem Coaching
Abbildung 30 t-Test auf positive Veränderung SAZ und Subskala - jeweils vor und nach dem Coaching
Abbildung 31 Streudiagramm Beziehungsverhalten-Summe und Veränderung SAZ
Abbildung 32 Streudiagramm Beziehungsverhalten und Veränderung der Subskala
Abbildung 33 Streudiagramm-Matrix aller Variablen Regressionsmodell 1a
Abbildung 34 Regressionskoeffizienten Modell 1a
Abbildung 35 Partielle Korrelation Veränderung SAZ - Wertschätzung
Abbildung 36 Partielle Korrelation Veränderung SAZ - Empathie
Abbildung 37 Partielle Korrelation Veränderung SAZ-Selbstkongruenz
Abbildung 38 Partielle Korrelation Veränderung SAZ-Akzeptationsbreite
Abbildung 39 Streudiagramm y-Werte und Residuen
Abbildung 40 Normalverteilung Residuen
Abbildung 41 Streudiagramm-Matrix aller Variablen Regressionsmodell 2a
Abbildung 42 Regressionskoeffizienten Modell 2a
Abbildung 43 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Wertschätzung
Abbildung 44 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Empathie
Abbildung 45 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Selbstkongruenz
Abbildung 46 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Akzeptationsbreite
Abbildung 47 Streudiagramm y-Werte und Residuen
Abbildung 48 Normalverteilung Residuen
Abbildung 49Streudiagramm-Matrix aller Variablen Regressionsmodell 3a
Abbildung 50 Regressionskoeffizienten Modell 3a
Abbildung 51 Partielle Korrelation Veränderung SAZ - Therapeut. Basisverhalten
Abbildung 52 Partielle Korrelation Veränderung SAZ - Stabilität der Beziehung
Abbildung 53 Streudiagramm y-Werte und Residuen 3a
Abbildung 54 Normalverteilung Residuen 3a
Abbildung 55 Streudiagramm-Matrix aller Variablen Regressionsmodell 4a
Abbildung 56 Regressionskoeffizienten Modell 4a
Abbildung 57 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Therapeut. Basisverhalten
Abbildung 58 Partielle Korrelation Veränderung Subskala - Stabilität der Beziehung
Abbildung 59 Streudiagramm y-Werte und Residuen 4a
Abbildung 60 Normalverteilung Residuen 4a
Abbildung 61 Korrelationen SAZ-, Subskalenveränderung mit weiteren Faktoren
Abbildung 62 Tests auf Normalverteilung
Abbildung 63 Univariate Statistiken SAZ und SAZ-Subskala
Abbildung 64 Univariate Statistiken IBV
Abbildung 65 t-Test Geschlechtsunterschiede Klienten IBV
Abbildung 66 t-Test Geschlechtsunterschiede Coaches IBV
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 „Persönliche und soziale Kompetenzen des Coaches" nach Heß und Roth, 2001,
Tabelle 2 „Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Coaching und Psychotherapie", nach Rauen, 2003a
Tabelle 3 Parameter Beziehungsverhaltensvariablen
Tabelle 4 Parameter SAZ und Subskala „Entfaltung und Anwendung eigener Fähigkeiten"
Tabelle 5 Vergleich aller 8 Regressionsmodelle
1 Einleitung
Die heutige Zeit ist gekennzeichnet durch Schnelllebigkeit und ständigen Wechsel der Umwelt- bedingungen, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich. Wenn man sich darin zurechtfinden und behaupten möchte, ist man gezwungen, sich ständig an neue Anforderungen anzupassen. Da- für ist ein fortwährendes Lernen von Nöten. Das gilt nicht weniger für Führungskräfte und Ma- nager, die hohe Verantwortung in ihren Unternehmen tragen und die ständig Entscheidungen zu treffen haben, die auch viele andere Personen um sie herum betreffen. Tusch unterstreicht die Bedeutsamkeit des sozialen Lernens, das mitunter wichtiger sein kann als reines Bücherwissen. Vor allem für Führungskräfte hält er ein „Lernen im Rahmen von sozialen Beziehungen“ für besonders bedeutend, da der Umgang mit Menschen einen Großteil ihres Zeitbudgets aus- macht. Für ihn weisen Manager erst dann Führungskompetenz auf, wenn sie ihr eigenes Ver- halten kennen und ihre Wirkung auf andere richtig einschätzen können. (1991, S. 17) Um solch eine Führungskompetenz zu entwickeln, fehlt ihnen jemand, der ihnen ein ehrliches Feedback gibt. Denn sowohl von ihren Vorgesetzten als auch von ihren Untergebenen können sie nicht da- mit rechnen, eine verlässliche, unvoreingenomme Meinung - ohne irgendwelche Absichten - zu hören.
Eine weitere Veränderung, der Führungskräfte heute ausgesetzt sind, macht sich in selbst-be- wussteren und kritischeren Mitarbeitern bemerkbar. Sie kann man nicht mehr mit veralteten Strukturen führen, in denen Disziplin und Unterordnung eine große Rolle spielen. Die Führungs- kraft hat heute neue Aufgaben zu erfüllen, so z.B. als Promotor von Ideen, als Berater, Coach oder Mentor von Mitarbeitern, als Rollenmodell für das Umfeld, Konfliktmanager und als Inspi- rator. (Tusch, 1991, S. 16) Kein wissenschaftliches Hochschulstudium vermittelt die Fähigkeiten, um künftige Manager in dieser Beziehung auf ihre Arbeit vorzubereiten, obwohl solche Begabungen offenbar in der realen Arbeitswelt immer wichtiger werden.
Hinzu kommt die Einsamkeit vieler Manager, vor allem in Top-Positionen. Ihnen fehlt es an Menschen um sie herum, denen sie vertrauen können, mit denen sie wichtige Belange bespre-chen können. (Hall, Otazo & Hollenbeck, 1999, S. 41) Um diesen Bedürfnissen von Führungskräften nachzukommen, hat sich in den letzten Jahren Coaching, eine Form der Einzelberatung für Führungskräfte, immer weiter verbreitet. Seit einiger Zeit bemüht man sich Coaching transparenter zu machen, indem man es besser erforscht und indem man versucht, Qualitätsstandards zu bestimmen und festzulegen. Dabei wurden auch immer wieder Stimmen laut, die sich an die Ergebnisse der Psychotherapieforschung erinnerten, nach der die Beziehung zwischen Therapeut und Klient der wohl bedeutendste Wirkfaktor für Therapieerfolg darstellt, und die ungeprüft diese Forschungsergebnisse von der Psychotherapie auf Coaching übertragen haben.
Eine Prüfung der Gültigkeit dieser Annahme steht bis heute aus, so dass mit dieser Arbeit ein kleiner Beitrag zum Füllen dieser Lücke versucht werden soll.
Da Carl Rogers der erste war, der die Bedeutung der Beziehung zwischen einem Berater und einem Klienten hervorhob und der seine Forschungsergebnisse in einer Theorie zusammen gefasst hat, soll diese Theorie, der personzentrierte Ansatz von Rogers, die grundlegende Theo- rie dieser Arbeit darstellen. Es soll auf dieser Theorie aufbauend gezeigt werden, ob person- 8 zentriertes Beziehungsverhalten, wie es später erläutert wird, den Coachingprozess so positiv beeinflusst, wie es die Ergebnisse der Psychotherapieforschung nahelegen. Da ein Ziel und Ergebnisqualitätsmerkmal von Coaching die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit darstellt, soll gezeigt werden, ob durch personzentriertes Beziehungsverhalten beim Coaching die Arbeitszufriedenheit verbessert werden kann.
Zuerst wird die personzentrierte Theorie von Rogers vorgestellt, wobei vor allem auf die herausragende Stellung einer Beraterbeziehung eingegangen und aufgezeigt wird, welche Merkmale zu einer personzentrierten Beziehung gehören.
Im Anschluß an die wichtigsten Forschungsergebnisse der personzentrierten und allgemeinen Psychotherapieforschung wird Coaching dargestellt.
Dabei wird vor allem auf die Anforderungen eingegangen, die für die Qualität von Coaching relevant sind. Die Coachingforschung birgt noch viele offene Fragen, von denen die für diese Arbeit wesentlichen aufgezeigt werden.
Im Anschluß werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Psychotherapie und Coaching aufgezeigt und beleuchtet, wie vor allem der personzentrierte Psychotherapieansatz auf Coaching übertragen werden kann.
Den kurzen Ausführungen über Arbeitszufriedenheit folgen die konkreten Fragestellungen und Hypothesen der Arbeit, in denen es um den Einfluss des wahrgenommenen personzentrierten Beziehungsverhaltens auf die Arbeitszufriedenheit der Klienten geht.
Sodann werden die verwendeten Methoden, Tests und das Untersuchungsdesign vorgestellt und die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und diskutiert. Bei der Studie handelt es sich um eine Online-Befragung unter Coachingklienten vor und nach ihrem Coachingprozess zu ihrer Wahrnehmung des Beziehungsverhaltens ihres Coaches und zu ihrer Arbeitszufriedenheit.
2 Carl Rogers Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen
Carl Rogers (1902-1987) hat in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts aus praktischen Erfahrungen im beraterischen Umfeld heraus eine neue Psychotherapieform entwickelt, die einen Gegenpol zur damals sonst weit verbreiteten Psychoanalyse und dem Behaviorismus darstellen sollte. Rogers war damit einer der ersten großen Vertreter der humanistischen Psychologie, die auch mit der Pädagogik verbunden war. (Groddeck, 2002, S. 91) Seine Lehre und Theorie der Psychotherapie entwickelte sich im Laufe der Jahre mit seinen eigenen Erfahrungen und seinen persönlichen Ansichten weiter. Diese Entwicklung und die bedeutenden Grundlagen seiner Theorie sollen hier dargestellt werden, weil Rogers' Theorie für diese Untersuchung die Grundlage bildet.
2.1 Die Entwicklung der Rogers-Theorie
Nachdem Rogers einige Jahre Erfahrungen mit der Beratung und Therapie von Erwachsenen und Kindern gemacht hatte, begann er seine Einsichten in die Wirkungsweise von Psycho-thera- pie und Beratung publik zu machen; zuerst 1940 in einem Vortrag mit dem Titel: „Neue Konzepte in der Psychotherapie“ vor einem akademischen Kollegenpublikum an der Universität Minnesota, 1942 dann mit seinem Buch „Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice“ (auf deutsch: „Die nicht-direktive Beratung“: Rogers, 1989) Auffallend war hier zuerst einmal, dass Rogers Beratung und Psychotherapie als denselben Prozess ansah. Er sah einen Unterschied zwischen Beratung und Psychotherapie nur graduell aber nicht grundsätzlich. (Groddeck, 2002, S. 82) Mit dem nicht-direktiven Ansatz wollte Rogers klar gegen die traditionellen direktiven Therapie- formen wie die Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse, wie sie Rogers verstand, sprechen. Er kritisierte scharf jedes direktive Vorgehen, so z.B. einige der häufigsten direktiven Ge- sprächsvorgänge: Ratschläge erteilen, Drängen, Moralisieren, Diagnostizieren, Interpretieren, Generalisieren, Dramatisieren und Suggerieren. Schmid (1989, S. 72) betont dabei aber, „daß das Entscheidende dabei nie die Formulierungen, sondern immer die mit den Worten zum Aus- druck gebrachte emotionale Ebene ist.“
Ein bedeutender Unterschied zwischen direktivem Vorgehen und nicht-direktivem Vorgehen liegt darin, dass direktives Vorgehen problemzentriert ist, d.h. der Berater geht sofort auf das Prob- lem ein, und zwar so, wie er es aus seiner eigenen Perspektive sieht. Dagegen wendet sich ein nicht-direktiver Berater nicht direkt dem Problem sondern dem Hilfesuchenden zu und geht dann aus dessen Sicht und mit ihm gemeinsam an das Problem heran. (Schmid, 1989, S. 45) Dabei geht es in erster Linie nicht darum, das Problem zu lösen, sondern dem Menschen zu hel- fen, so in seiner Persönlichkeit zu wachsen, dass derjenige seine Probleme selbständig bewäl- tigen kann.
„Die gemeinsamen Faktoren der neueren Konzepte hob er wie folgt hervor:
1. Der nicht-direktive Ansatz betone die Bedeutung der Gefühle und Emotionen in der Be- ratungssituation. Der Berater solle nicht nur auf die kognitive Aspekte des Problems ach- ten.
2. Der Fokus der Behandlung liege auf der Gegenwart des Klienten, statt auf einer langwierigen Suche nach den Ursachen des Problems in der Vergangenheit.
3. Die therapeutische Beziehung werde von dem Klienten als wichtiges Elemente [ sic ] zur Förderung des Wachstums erlebt und erfahren." (Groddeck, 2002, S. 81) Rogers betonte immer wieder, dass der Betroffene selbst immer am besten den richtigen Weg zur Lösung seiner Schwierigkeiten kennt und gehen kann und dass man vermeiden muss, eine Abhängigkeit vom Berater aufzurichten. (vgl. Schmid, 1989, S. 26; Rogers, 1989, S. 36) Rogers verbreitete dann auch u.a. eine kleine Praxisbroschüre, in der er konkrete praxisnahe Ratschläge für eine nicht-direktive Gesprächstechnik erläuterte. Allerdings wurde damit seine nicht-direktive Beratungsmethode oft als „simples Technik-Training“ missverstanden, was so von ihm nicht intendiert war. (Groddeck, 2002, S. 87-88) Später kritisierte Rogers auch die ober- flächliche Behandlung seiner Ansätze: „Doch da die klientenzentrierten Grundsätze unter- schiedslos auf alle möglichen Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen in unserer Gesell- schaft angewendet wurden - und das ist an sich eine gesunde Tendenz -, ist die Theorie ent- sprechend oft oberflächlich vermittelt und ebenso oberflächlich verstanden worden. Und das ist es, wogegen ich etwas einzuwenden habe." (Rogers, 2002, S. 132)
Rogers hat sehr früh begonnen, Therapieverläufe zu protokollieren und empirisch zu unter-su chen und war damit ein Vorreiter der Psychotherapieforschung, die er bis an sein Lebensende unterstützte. Durch seine weiteren Erfahrungen und empirische Ergebnisse entwickelte er sei- nen Ansatz weiter, den er in seinem dritten Buch 1951 „Client-Centered Therapy“ - oder auf deutsch „Die klient-bezogene Gesprächstherapie“ (Rogers, 1973) - nannte, was „nun nicht mehr nur negativ zum Ausdruck bringt, was der Ansatz nicht ist, sondern vielmehr positiv, worauf er bezogen ist: Es geht um die 'Zentrierung' (Orientierung, Bezogenheit) des Geschehens auf den Klienten hin - einem, wie Rogers meinte, möglichst neutralen, nicht etikettierenden Ausdruck für den hilfe-suchenden Gesprächspartner." (Schmid, 1989, S. 90-91) Rogers betonte, dass die kli- enten-zentrierte Orientierung „eine sich ständig weiterentwickelnde Form der zwischenmenschli- chen Beziehung [ist], die Wachstum und Veränderung fördert. Sie geht von folgender Grund- hypothese aus: Jedem Menschen ist ein Wachstumspotential zu eigen, das in der Beziehung zu einer Einzelperson (etwa einem Therapeuten) freigesetzt werden kann.“ (Rogers, 2002, S. 17) Rogers geht also davon aus, dass in jedem Menschen diese „Aktualisierungstendenz“ (siehe 2.2.) vorhanden ist, die jedem Menschen eine konstruktive Persönlichkeitsveränderung erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind:
1. „Zwei Personen befinden sich in Kontakt.
2. Die erste Person, die wir Klient nennen, befindet sich in einem Zustand der Inkongru- enz; sie ist verletzlich oder voller Angst.
3. Die zweite Person, die wir den Therapeuten nennen, ist kongruent in der Beziehung.
4. Der Therapeut empfindet bedingungslose positive Beachtung gegenüber dem Kli- enten.
5. Der Therapeut erf ä hrt empathisch den inneren Bezugsrahmen des Klienten.
Der Klient nimmt zumindest in geringerem Ausmaße die Bedingungen 4 und 5 wahr, nämlich die bedingungslose positive Beachtung des Therapeuten ihm gegenüber und das empathische Verstehen des Therapeuten.“ (Rogers, 1991a, S. 40) (siehe dazu auch 2.3)
Es sollte hier betont werden, dass diese Theorie nach Rogers nicht nur für eine psycho-thera- peutische oder beraterische Beziehung gilt, sondern auf jede zwischenmenschliche Beziehung angewendet werden kann, also auch z.B. auf Coaching. Zudem ist sie nicht auf einen Kliententyp oder eine bestimmte Psychotherapieschule begrenzt, sondern gilt nach Rogers in jedem Falle. (Rogers & Schmid, 1991, S. 179)
Wenn man ein Beratungsgespräch, wie eine Psychotherapie betrachtet, dann fällt bei Rogers' Ansatz auf, dass er jede Diagnose zu Beginn der Therapie ablehnt, da er mit einer Diagnose auch eine Bewertung des Klienten durch den Therapeuten verbindet. Diese vom Klienten wahrgenommene Bewertung führt zu geringerem Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sich selbst zu kennen, was sich negativ auf den Therapieerfolg auswirkt. (Rogers, 1973, S. 209) Dieser Therapieerfolg macht sich in folgenden Lernerfahrungen und Veränderungen der Kli- enten bemerkbar:
„Der Mensch kommt dazu, sich anders zu sehen.
Er akzeptiert in stärkerem Maße sich und seine Gefühle. Er wird selbstbewußter und selbstbestimmender. Er wird mehr der Mensch, der er sein möchte. Er wird in seinen Wahrnehmungen flexibler, weniger rigide. Er setzt sich realistischere Ziele. Sein Verhal- ten ist reifer. Er ändert unangepaßte Verhaltensweisen, auch solche fest etablierten Verhaltensweisen wie chronischen Alkoholismus. Er wird gegenüber anderen akzeptierungsbereiter. Er wird offener für die Bedeutung dessen, was sich außerhalb wie innerhalb seiner selbst abspielt. Er verändert sich auf konstruktive Art und Weise in seinen grundlegenden Persönlichkeits-eigenschaften.
Das genügt wohl, um zu zeigen, daß es sich hierbei um Lernerfahrungen handelt, die signifikant sind, die tatsächlich etwas ändern." (Rogers, 1979, S. 274)
In den 1960er-Jahren brachte Rogers durch eine Umbenennung seines Ansatzes von „klienten- zentriert“ auf „personzentriert“ eine Weiterentwicklung zum Ausdruck. Beeinflusst durch die Arbeit mit Encountergruppen, wo er seine therapeutischen Prinzipien auf dynamische Gruppen- prozesse übertrug, durch die Therapieerfahrungen mit unmotivierten Schizophrenen und durch den Einfluss durch Martin Buber und existenzanalytisch orientierte Therapeuten, hatte sein An- satz die wichtige dritte Entwicklungsstufe erreicht: Sowohl der Therapeut als auch der Klient werden als Person wahrgenommen. Für den Therapeuten wird der Aspekt der Echtheit noch be- deutender, und sein Gesprächspartner wird nicht mehr als Klient etikettiert sondern noch tiefer als Person betrachtet. Damit öffnet sich nun entgültig die Grenze der Anwendung im psycho- therapeutischen Bereich: Der personzentrierte Ansatz (PCA) findet tatsächlich Anwen-dung auf alle zwischenmenschlichen Bereiche, so dass Rogers dann auch u.a. Bücher über Encoun- tergruppen, über Partnerschaften und zur Pädagogik schreibt. (Schmid, 1989, S. 91; Rogers, 2002, S. 11; Groddeck, 2002, S.204) „Heute werden die Bezeichnungen 'person(en)zentriert' und 'klientenzentriert' verwendet. Sie werden entweder synonym gebraucht, wobei 'klienten- zentriert' dann nur dort gebräuchlich ist, wo der Partner üblicherweise als Klient bezeichnet wird, also in Therapie, Beratung und Sozialarbeit. (So war auch Rogers' letzte Position.)" (Schmid, 1989, S. 91-92)
In Deutschland wurden die Ideen von Rogers erst viel später übernommen. Erst 1972 - also längst in personzentrierten Zeiten - wurde erstmals Rogers' erstes einschlägiges Buch von 1942 übersetzt und dann etwa im Halbjahresabstand die weiteren Bücher. Schmid sieht in dem fehlenden 30-jährigen Entwicklungsprozess den Grund, dass in Deutschland die „Rogers-Thera- pie“ stark vereinfacht aufgefasst und weitergegeben wurde. (Schmid, 1989, S. 96) Rogers war auch nie glücklich, dass in Deutschland aus der „client-centered Therapy“ in der Übersetzung eine „Gesprächspsychotherapie“ (engl.: Talk -Therapy) geworden war. (Groddeck, 2002, S. 185; Schmid, 1989, S. 92) Dieser deutsche Ausdruck wird aber auch heute noch weit- gehend verwendet, wenn man eine Psychotherapie nach der Theorie von Rogers meint. Hinter diesem Ansatz steckt aber noch viel mehr als einfach miteinander zu sprechen - das wird auch in allen anderen therapeutischen Richtungen getan. Rogers betonte immer wieder, dass seine Art der Psychotherapie, wie auch immer man sie nennen mag, ob nicht-direktiv, klientenzentriert oder personzentriert, am ehesten eine Seinsweise - „a way of being“ (Schmid, 1989, S. 119) - oder eine Charakterhaltung ist und es nicht einfach eine Technik darstellt, die man jemandem aufsetzen kann, der diese Haltung gar nicht teilt. Dahinter steckt auch ein ganz bestimmtes optimistisches Menschenbild, das in jedem Menschen „Die Kraft des Guten“ (Rogers, 1978) an- tizipiert. Schmid (1989, S. 19) stellt auch fest, dass ein Hilfesuchender nicht perfekte Methoden sucht, sondern „hilfreiche Personen“, die keiner aufgesetzten Techniken, sondern einer entspre- chenden Einstellung bedürfen; und diese können die Helfenden nur durch Mühe und Zeit und durch die Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit erlangen.
So war auch Rogers stets darauf bedacht, seine eigene Persönlichkeit und ebenso seine Theo- rie weiterzuentwickeln. Dabei zeichnete sich seine Theorie dadurch aus, „1., daß sie nicht am Schreibtisch oder im Labor konzipiert wurde, sondern sich aus der fortgesetzten Beschäf-tigung mit einem wachsenden Kreis von Klienten heraus entwickelt hat und 2., daß sie sich flexibel und wandlungsfähig gezeigt hat und die immer umfassenderen Forschungsergebnisse und Erfah- rungen mit neuen Kategorien von Klienten berücksichtigt hat.“ (Rogers, 2002, S. 40) Er betonte mehrmals, dass es sich bei seiner Theorie um Hypothesen handle, die einen Anfang und nicht das letzte Wort darstellen. So hielt er es für möglich, dass es außer seinen aufge-führten noch andere wesentliche Bedingungen gäbe. (Rogers, 2002, S. 221) Da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass er in seinen späteren Jahren die Vermutung eines weiteren Merkmals für eine entwicklungsfördernde Beziehung äußert: Der Therapeut sollte seinem inneren, intuitiven Selbst ganz nahe sein. Im Gegensatz zu den expliziten Bedingungen seiner Theorie ist dieses Merkmal jedoch empirisch nicht belegt. (Rogers & Schmid, 1991, S. 242) Rogers hatte schließlich die Vision, „daß sich mit der Erweiterung unseres Wissens über den therapeutischen Prozeß die sogenannten psychotherapeutischen Schulen auflösen und ver- schmelzen werden zu einer einheitlichen Methode des Heilens." (Rogers, 2002, S. 134)
2.2 Aktualisierungstendenz
Die Aktualisierungstendenz, die bei der Beschreibung des klientenzentrierten Ansatzes erwähnt wurde, wird von Rogers als einziges Axiom seines theoretischen Systems betrachtet. (Rogers, 1991a, S. 22) Sie besagt, dass der Mensch wie alle anderen Organismen „eine inhärente Ten- denz zur Entfaltung aller Kräfte besitzt, die der Erhaltung oder dem Wachstum des Organismus dienen. Wenn diese Tendenz nicht behindert wird, bewirkt sie verlässlich beim Individuum Wachstum, Reife und eine Bereicherung des Lebens.“ (Rogers, 2002, S. 41) Hier kommt wieder besonders deutlich das positive Menschenbild zur Geltung, das ein Grundvertrauen in die Per- son zur Grundlage hat. Darin sehen Rogers und Schmid den größten Unterschied zu gesell- schaftlichen Institutionen der Erziehung, der Psychotherapie und anderen, die gegenüber der Person Misstrauen aufbauen. Der klienten- bzw. personzentrierte Ansatz dagegen vertraut dar- auf, dass der Mensch „vertrauenswürdig, konstruktiv, schöpferisch, sozial und auf Reife hin aus- gerichtet ist.“ (Schmid, 1989, S. 100; Rogers & Schmid, 1991, S. 241) Nach Rogers ist im Grunde das Endziel jedes Menschen herauszufinden, wer man in Wirklichkeit - unterhalb des oberflächlichen eigenen Verhaltens - ist. Der Mensch möchte sich selbst finden und er selbst werden. (Rogers, 1979, S. 115) Der Mensch hat die Tendenz zur Selbstverwirklichung. (Rogers, 1991a, S. 69)
Für Biermann-Ratjen, Eckert und Schwartz (2003, S. 15) ist die eigentliche Entdeckung von Ro- gers „nicht in der Abstraktion von operational definierbaren ‚Therapeutenvariablen’ zu sehen. Vielmehr ist es die Entdeckung, dass Menschen, wenn sie in einer Psychotherapie ihren eigenen Weg gehen dürfen, das Ziel verfolgen, das Selbst zu werden, das sie in Wahrheit sind. Unter der Bedingung von unbedingt positiver empathischer Beachtung entwickeln sie ihr Selbst- konzept, ihre Identität, werden mit sich selbst identisch ...“. Die Motivation zum Lernen und Ver- ändern entspringt der Tendenz des Menschen, sich zum Besten hin zu entwickeln. Wenn er das verwirklichen möchte, braucht er eine geeignete Umgebung. Diese kann mit Hilfe von den sechs Bedingungen, wie sie oben erwähnt wurden, verwirklicht werden. (Rogers, 1979, S. 278-279) (siehe auch 2.3) Dabei ist die Rolle des Beraters als die eines Gärtners oder einer Hebamme zu sehen, die dabei helfen, das Schöne einer Pflanze oder eines Menschen hervorzubringen, ohne dass sie selbst eine neue Pflanze oder Person formen. Sie helfen nur bei der „selbständigen Entstehung und Ausprägung neuer, bisher nicht zutage getretener Seiten der Person“. Die Per- son ist also nach wie vor selbst für ihre Entwicklung zuständig. Der Berater möchte nur - ohne ein Abhängigkeitsverhältnis aufzubauen - der Person ein wenig dabei unter die Arme greifen. (Schmid, 1989, S. 102-103)
Weinberger (2004) erklärt, dass die Aktualisierungstendenz Erfahrungen danach bewertet, ob sie für den gesamten Organismus förderlich sind. Im Laufe des Lebens entwickelt sich - unter großem Einfluss der umgebenden zwischenmenschlichen Beziehungen - ein Selbstkonzept; und die Selbstaktualisierungstendenz, als Teil der Aktualisierungstendenz, bewertet nun Erfah- rungen danach, ob sie für den gesamten Organismus und ob sie für das Selbstkonzept förder- lich sind. „Im Idealfall fallen Aktualisierungstendenz und Selbstaktualisierungstendenz zusam- men, d.h. der Mensch kann das, was gut für seinen Organismus ist, auch in sein Selbstkonzept integrieren. Das ist dann die 'fully functioning person', damit ist eine Person gemeint, die alle Erfahrungen - positive wie negative - vollständig wahr- und annehmen kann." (Weinberger, 2004, S. 26) Wenn aber diese beiden Tendenzen nicht vereinbar sind, also wenn die Person Erfahrungen macht, die nicht zum eigenen Selbstkonzept passen, spricht man von Inkongruenz, und die Person wird diese Spannungen zu lösen versuchen, indem sie ihre Erfahrungen verzerrt wahrnimmt oder verleugnet. So entstehen Ängste, Spannungen und Verteidigungshaltungen, die eine Person ändern kann, indem sie lernt, das Selbstkonzept flexibler zu betrachten, so dass sie in der Lage ist, mehr verschiedene Erfahrungen in ihr Selbstkonzept einzubauen. Dafür ist wiederum eine Beziehung in ihrer Umgebung notwendig, in der sie sich als Person akzeptiert fühlt. Dieser Veränderungsprozess einer sehr rigiden Persönlichkeit, die ihre Gefühle und Prob- leme nicht wahrnimmt bis zu einer Person, die alle Erfahrungen in ihr Selbstkonzept einbinden kann, wird von Rogers in einer siebenstufigen Prozessskala beschrieben. (vgl. Rogers, 2002, S. 33f.; Weinberger, 2004, S. 24-28)
2.3 Die Bedeutung der Therapeuten-Klienten-Beziehung
Wie schon erwähnt, ist für die Entfaltung der Persönlichkeit nach der Aktualisierungstendenz eine geeignete Umgebung in Form einer bestimmten Beziehung notwendig. Wenn eine Person sich in einer Beziehung wiederfindet, in der das Gegenüber kongruent, bedingungslos wert- schätzend und empathisch ist, wird sie diese Beziehung zur eigenen Entwicklung nutzen und bestehende Inkongruenzen auflösen können. (Rogers, 1979, S. 47; Rogers, 1991b, S. 57) Dazu ist aber nicht nur das Vorhandensein dieser Einstellungen des Gegenübers von Nöten, sondern diese Einstellungen müssen auch von der Person als solche erfahren werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, „werden sich Veränderungen und konstruktive Persönlichkeits- entwicklungen in allen Fällen ereignen - ich schreibe ‚in allen Fällen’ erst nach langer und sorg- fältiger Überlegung dazu.“ (Rogers, 1979, S. 48) Und dabei betont Rogers, dass diese positiven Veränderungen umso stärker sind, je mehr diese drei Basisvariablen vom Klienten wahrgenom men werden. (Rogers, 1979, S. 79)
In der Literatur wird sehr oft von den sogenannten drei „therapeutischen Basisvariablen“ gesprochen. Bevor diese im Folgenden ausführlicher dargestellt werden, muss darauf hingewiesen werden, dass eine Reduzierung des klientenzentrierten Ansatzes nach Rogers auf diese drei Basisvariablen nicht gerechtfertigt ist. Denn Rogers hatte nicht drei, sondern sechs Bedin- gungen für den Therapieerfolg verantwortlich gemacht: zum einen die drei Therapeuten- variablen, aber ebenso wichtig auch drei Klientenvariablen, die für einen Therapieerfolg voraus- gesetzt werden:
“1. Der Klient ist kontaktfähig: Der Therapeut bewirkt eine wahrnehmbare Veränderung des Erfahrungsfeldes des Klienten.
2. Der Klient ist inkongruent und spürt das auch in irgendeiner Art und Weise: als mit sich selbst uneins sein, sich nicht verstehen, sich nicht akzeptieren und/oder in der Form von Gespanntheit, die Angst genannt wird.
3. Der Klient nimmt zumindest in Ansätzen wahr, dass ihn der Therapeut in seinem Erleben ein- fühlend versteht und ohne Bedingungen akzeptiert." (Biermann-Ratjen et al., 2003, S. 15) Da in dieser Studie die Therapeutenvariablen operationalisiert werden, sollen sie hier etwas ge- nauer erklärt werden.
2.3.1 Kongruenz
Rogers hält die Kongruenz des Therapeuten für die wichtigste und grundlegendste Bedingung einer hilfreichen Beziehung, was er aber noch nicht empirisch nachweisen konnte. So gibt es darüber auch andere Ansichten, wie z.B. des Co-Autors John Wood, der das bedingungsfreie Akzeptieren als die wichtigste therapeutische Einstellung ansieht. (Rogers, 2002, S. 23, 162- 163) Andere Begriffe für Kongruenz sind „Echtheit“ oder auch „Authentizität“. Man versteht dar- unter, dass der Therapeut in der Beziehung zu seinem Klienten er selbst ist, sich nicht hinter einer professionellen Maske versteckt und sich seiner eigenen Gefühle und Einstellungen be- wusst ist, so dass er sie dem Klienten mitteilen kann, wenn das angemessen scheint. Er ist somit für den Klienten offen und durchschaubar und er verwendet keine zweideutige Sprache oder leere Phrasen. Was er zum Klienten sagt, widerspricht nicht seinen Gefühlen ihm gegen-über, so dass es ihm dadurch gelingt, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Diese Ein-stellung, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist und sich dem anderen so mitzuteilen, ist nicht leicht und man kann sie kaum vollkommen erreichen, aber es ist wichtig zu erkennen, dass „man sich selbst entfalten muß, wenn man die persönliche Entfaltung anderer innerhalb einer Beziehung zu sich fördern will, diese Erfahrung ist oft genug schmerzlich, aber auch bereichernd.“ (Rogers, 1979, S. 65-66; Rogers, 2002, S. 30-31, 151) Besonders schwierig wird es, wenn man dem Kli- enten gegenüber negative Gefühle entdeckt. Dabei rät Rogers, auch solche negativen Gefühle mitzuteilen, vor allem, wenn sie innerhalb der Beziehung immer wieder auftauchen. Dabei soll aber erkennbar sein, dass der Therapeut über seine eigenen Gefühle spricht und keine Sach- aussage oder Bewertung über den Klienten macht. Auf diese Art wird auch sichtbar, dass es sich um eine „echte personale Beziehung zwischen zwei unvollkommenen Menschen“ handelt, die im weiteren offenen Gespräch noch verbessert werden kann. (Rogers, 2002, S. 30-32, 155- 156, 214-216) Wenn der Therapeut sich um absolute Echtheit in der Beziehung bemüht, ist das die Voraussetzung, dass die anderen Therapeutenvariablen Wertschätzung und Empathie wirken können, denn z.B. die Wertschätzung kann nur dann therapeutisch wirken, wenn sie nicht vorgespielt wird, sondern den wahren Gefühlen des Therapeuten entspricht. (Biermann-Ratjen et al., 2003, S. 30) Somit sind die drei Einstellungen miteinander funktional verflochten. Man kann eigentlich keine der Eigenschaften alleine betrachten oder verwirklichen. Und sie „bleiben sinnlos, solange sie nicht mit einer hohen Achtung vor dem Menschen überhaupt und seiner in ihm schlummernden Möglichkeit verbunden werden. Allein wenn der Wert des Einzelmenschen für den Therapeuten an erster Stelle steht, nur dann ist er fähig, wirkliche Anteilnahme zu spüren, sowie das Bedürfnis, den Klienten zu verstehen und wohl auch den Grad von Selbstachtung, wessen es zur Echtheit bedarf." (Rogers, 2002, S. 222-223)
2.3.2 Bedingungslose Wertschätzung
Die zweite Einstellung, die ein erfolgreicher Therapeut entwickeln muss, besagt, dass man eine Person als solche schätzt, auch wenn man ihr Verhalten nicht unbedingt positiv bewertet. Dabei erkennt man in der Person ihre vielen Möglichkeiten zur fortschrittlichen Entwicklung und emp- findet ihr gegenüber eine echte und tiefe Zuwendung, die frei ist von jeglichen Bewertungen, Etikettierungen und ohne jede Besitzergreifung - genauso wie Eltern ihre Kinder bedingungslos schätzen und akzeptieren, auch wenn sie deren augenblickliches Verhalten nicht in jeder Weise gutheißen können. Dabei ist eine positive Bewertung genauso unangebracht wie eine negative Bewertung, weil man damit zum Ausdruck bringt, dass man das Recht hat, den anderen zu be- urteilen; doch sollte jeder Klient erkennen, dass nur er selbst die Verantwortung hat, sich selbst einzuschätzen und kein anderer. (Rogers, 1991b, S. 35; Rogers, 2002, S. 27, 218; Rogers, 1979, S. 69) Man betrachtet jeden Menschen als wertvoll und entwicklungsfähig, worin wieder das oben beschriebene Menschenbild zum Vorschein kommt. Rogers hat die Erfahrung ge- macht, dass es Menschen mit einer solchen Grundeinstellung zum Menschen leicht fällt „klient- bezogene Techniken“ zu erlernen. Um andere akzeptieren zu können ist es aber auch nötig, dass man sich selbst respektiert und akzeptiert. (Rogers, 1973, S. 35-36) Rogers (2002, S. 219) hatte noch die unsichere Hypothese aufgestellt, dass eine Beziehung um so erfolgreicher bzw. wirkungsvoller ist, je bedingungsfreier die positive Zuwendung ist. Aber Biermann-Ratjen et al. (2003, S. 25) betonen, dass die entgegengebrachte Wertschätzung auch mit dem erlebten Selbstbild übereinstimmen sollte. So wird ein Therapeut wenig Erfolg haben, wenn er einem Klienten positive Wertschätzung entgegenbringt, der sich selbst nicht mag. Statt- dessen muss er auch diese Gefühle verstehen und akzeptieren können. Hierin kommt der Zu- sammenhang zwischen Wertschätzung und Empathie zum Tragen, was auch in der Aussage von Biermann-Ratjen et al. (2003, S. 33) zum Ausdruck kommt: „Das Versprechen des Gesprächspsychotherapeuten an seinen Klienten lässt sich durch den Satz charakterisieren: Ich will von dir und für dich nichts, als dir mitzuteilen, dass ich dich verstehe als eine Person, die Erfahrung macht, und dass ich dich darin unbedingt wertschätze. Ich helfe dir bei Deinen Bemü- hungen um dich selbst. Darüber hinaus verspreche ich dir nichts.“
2.3.3 Empathie
Empathie ist nach Rogers „die innere Welt des Klienten mit ihren ganz persönlichen Bedeutungen so zu verspüren, als wäre sie die eigene (doch ohne die Qualität des „als ob“ zu ver- lieren)“ (Rogers, 2002, S. 216). Hummitzsch (2002, S. 130) weist darauf hin, dass man dabei dem Klienten genügend nah sein, aber gleichzeitig auch genügend distanziert sein muss, damit man seine eigene Identität nicht verliert, was mit der vorausgesetzten Kongruenz zu tun hat. Wenn man die Welt des Klienten verstehen will, geht es nicht nur darum, den Sinn seiner Worte zu verstehen, sondern es geht auch darum, dass man versteht, was der Klient zwischen den Zeilen durch seinen Tonfall und seine Gesten ausdrückt, und zwar auch in Zonen, die dem Kli- enten vielleicht selbst gar nicht bewusst sind. Dafür braucht man größtes Feingefühl, damit der Klient nicht das Gefühl bekommt, dass man sich anmaßt, mehr als er selbst über ihn zu wissen, was dann auch als Bewertung und Urteil empfunden würde. (Rogers, 2002, S. 158-159) Auch wenn sich dieses Verstehen nach Biermann-Ratjen et al. (2003, S. 20) durch „Verba-lisierung der emotionalen Erlebnisinhalte des Klienten“ zeigt und Empathie nicht mit einer Haltung des „Verständnisvoll-Seins“ verwechselt werden darf, kritisiert Rogers vehement, dass in der Ausbil- dung klientenzentrierter Berater das Einfühlungsvermögen als „hölzerne Technik des Pseudo- verstehens“ missverstanden wurde, bei der ein Berater nur wiedergibt, was sein Klient kurz vor- her gesagt hat. (Rogers, 2002, S. 218) Rogers betont, dass sich das Erlebnis eines Klienten, sich von jemandem verstanden zu fühlen, entwicklungsfördernd auswirkt, sogar, wenn der Therapeut nur die bloße Absicht hat, den Klienten zu verstehen. (Rogers, 2002, S. 24) Rogers war zwar in den 1950er Jahren noch davon ausgegangen, dass seine sechs Be- dingungen für eine Persönlichkeitsentwicklung notwendig und hinreichend seien, aber er betonte immer wieder, dass sich seine Theorie auf Hypothesen gründete und später wies er ausdrück- lich auf mögliche andere Bedingungen hin. Diese Hypothese ist bis heute sehr um-stritten. So gibt es bis heute Puristen, die darauf bestehen, dass seine Theorie die notwendigen und hinrei- chenden Bedingungen sind, aber wohl noch mehr Wissenschaftler und Psycho-therapeuten, die davon ausgehen, dass eine Beziehung, wie sie von Rogers beschrieben wurde, nur ein thera- peutisches Basisverhalten und eine Voraussetzung für eine weitere therapeutische Arbeit durch Techniken und Methoden darstellt. (Groddeck, 2002, S. 111; Dilthey, 1979, S. 234-235; Tscheu- lin 1992) Lang (2003, S. XI) folgert in der Einleitung zu seinem Sammelband aus verschiedenen Forschungsergebnissen, „daß die therapeutische Beziehung einmal ein Faktor per se ist, und zum anderen, daß sie die Basis dafür bildet, daß therapeutische ‚Techniken’ ...dann wirken, wenn sie in eine gute Arbeitsbeziehung eingebettet sind.“ Rogers selbst hat sich auch dafür aus- gesprochen, dass ein personzentrierter Berater „über ein zusammenhängendes und ständig sich weiterentwickelndes, tief in seiner Persönlichkeitsstruktur verwurzeltes Sortiment von Ein- stellungen verfügt, ein System von Einstellungen, das von Techniken und Methoden, die mit diesem System übereinstimmen, ergänzt wird.“ (Rogers, 1973, S. 34)
2.4 Psychotherapieforschung
2.4.1 Gesprächspsychotherapieforschung
Wie bereits erwähnt wurde, legte Rogers von Anbeginn großen Wert darauf, seine Theorie durch empirische Forschung weiterzuentwickeln. Bereits 1940 ließ er für diesen Zweck Ton- bandaufzeichnungen machen und wird daher z.B. von Hockel (1999, S. 13-14) und Eckert (1996, S. 127) als einer der Begründer der empirischen Psychotherapieforschung angesehen.
Rogers berichtet als Argument für seine Hypothesen in seinen zahlreichen Büchern von eigenen Untersuchungen, die z.B. klärten, ob signifikante Veränderungen stattgefunden haben und wenn dem so war, ob sie der Therapie und nicht einem anderen Faktor zuzuschreiben waren. ( Ro- gers, 1979, S. 226-229) Er schreibt auch von Studien anderer Forscher, so z.B. der Studie von Barrett-Lennard von 1959, in der die Qualität der therapeutischen Beziehung und der Behand- lungsfortschritt untersucht wurden. (Rogers, 1979, S. 259-262) Und außerdem referiert er eine Reihe von Studien, in denen die Beziehung zwischen den Einstellungen des Therapeuten und der Wirksamkeit der Therapie untersucht wurde, nämlich die Forschungsarbeiten von Halkides von 1958, Van der Veen von 1970 sowie Truax und Mitchell von 1971. Nach den Ergebnissen all dieser Arbeiten sind diese Therapeuteneinstellungen, die vom Klienten wahrgenommen werden, „die entscheidenden Voraussetzungen für einen therapeutischen Fortschritt und konstruktive Persönlichkeitsveränderungen.“ (Rogers, 2002, S. 150-151) Rogers berichtet u.a. von einer Un- tersuchung, die hier besonders erwähnt werden soll, da sie große Ähnlichkeit zu dieser Coa- ching-Studie zeigt. In dieser Studie wurden verschiedene Messverfahren verwendet, darunter ein Beziehungs-Fragebogen mit einer sechsstufigen Skala, der vom Klienten (und in einer ange- passten Version auch vom Therapeuten) zu verschiedenen Zeitpunkten ausgefüllt wurde und sehr ähnliche Items wie der hier benutzte IBV-Fragebogen enthielt. So z.B. die Items: „Im großen und ganzen spürt oder bemerkt er, wie ich mich fühle.“ oder „Er verhält sich in unserer Beziehung genauso, wie es seiner Person entspricht.“. Um das Ausmaß der konstruktiven Ver- änderung einzuschätzen, wurden verschiedene Skalen und Tests verwendet, wie z.B. das „Minnesota Multiphasic Personality Inventory“. Es stellte sich heraus, dass der Berater einen größeren Einfluss auf die Beziehung hat als der Klient und dass diejenigen Klienten die größten positiven Veränderungen zu verzeichnen hatten, die eine Beziehung mit einem hohen Maß an Echtheit, einfühlendem Verstehen und bedingungsfreier, positiver Zuwendung verzeichneten. (Rogers, 2002, S. 223-230)
In Laufe der Jahre wurden eine Vielzahl solcher Untersuchungen durchgeführt, die zum Teil 1994 von Grawe, Donati und Bernauer in einer therapievergleichenden Meta-Analyse zusam- mengefasst wurden. Sie attestierten der Gesprächspsychotherapie eine überzeugende Wirk- samkeit, wobei diese jedoch als weniger wirksam als die Verhaltentherapie eingestuft wurde. Bei der Untersuchung der drei Therapeutenvariablen stellte man fest, dass Empathie und Wert- schätzung einen deutlichen Einfluss auf den Therapieerfolg haben, nicht aber die Therapeuten- variable Echtheit. Damit war nur ein Teil der Rogers-Theorie bestätigt. Des weiteren stellten sie fest, dass die Therapiebeziehung nicht nur eine bedeutende Rolle in der Gesprächspsycho- therapie sondern ebenso in allen Therapieformen einnimmt, da sie sich für einen Therapieerfolg im allgemeinen als wichtig herausgestellt hat. Trotz aller Kritik und Einschränkungen, die Grawe et al. gegenüber der Gesprächspsychotherapie gefunden haben, sehen sie die Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie als sehr gut bestätigt und deren Wissenschaftlichkeit als sicher an. (Grawe et al., 1994, S. 134-140, 741) Diese Einschätzung genügt einigen Vertretern der Rogers- Theorie allerdings nicht. Sie kritisieren gemeinsam mit Vertretern anderer Schulen an der Arbeit von Grawe et al. methodische Fehler. Insbesondere betonen sie, dass in der Praxis die Be- handlungsdauer deutlich länger ist (etwa 70 Sitzungen) als in den berücksichtigten Unter- suchungen (ca. 20), dass man bei einer Therapie, die normalerweise viel länger dauert, eine deutlich größere Wirksamkeit erwarten kann als bei entsprechenden Kurzzeittherapien und dass bei der Gesprächspsychotherapie als einer „nicht-symptomzentrierten“ Psychotherapie eine deutliche Langzeitwirkung empirisch nachgewiesen wurde, was in den verwendeten Post-Unter- suchungen nicht berücksichtigt wurde. (Biermann-Ratjen et al., 2003, S. 63-66; Eckert, 1995, S. 185-191; Fäh & Fischer 1998) Biermann-Ratjen et al. kritisieren an der Psychotherapiefor- schung auch den allgemein verwendeten „Variablenansatz“ bei abhängigen und unabhängigen Therapeuten- oder Klientenvariablen. Sie betonen die starke Verzahnung der Prozesse in- nerhalb einer Beziehung, in der man nicht von linear-kausal wirksamen Variablen ausgehen kann. Sie sollten deswegen nicht einzeln betrachtet werden, sondern nur als ganzes Gefüge. In diesem Zusammenhang weisen sie auch auf die verschiedenen Abstraktionsebenen des kli- entenzentrierten Ansatzes hin, die bei empirischen Untersuchungen auseinander zu halten sind. Sie gehen von der ersten Ebene als der „therapeutischen Beziehung“ zur 2. Ebene der „zu- sammenfassenden Merkmale der klientenzentrierten therapeutischen Beziehung“ (Empathie usw.) über die Ebene der „zusammenfassenden Klassifikation von einzelnen Verhaltensweisen“ (z.B. Ansprechen von Gefühlen des Klienten durch den Therapeuten) bis zur 4. Ebene der kon- kreten Verhaltensweisen von Therapeut und Klient in einem bestimmten Gespräch. (2003, S. 54-62)
Eine Verzahnung der drei Therapeutenvariablen konnten auch Figge und Schwab (1997) empi- risch bestätigen. Sie untersuchten klientenzentrierte Psychotherapie in Gruppen, wobei sie so- wohl objektive Therapieerfolgsmaße, subjektive Erfolgseinschätzung und Fragen zur therapeu- tischen Beziehung aus der Sicht der Klienten erhoben. Sie stellten fest, dass die wahrgenom- mene Kongruenz den größten - und auch frühzeitigsten - Einfluss auf die objektiven Therapie- erfolge und auch auf die subjektiven Erfolgseinschätzungen hatte. Erst nach längerer Thera- piedauer konnte man auch Auswirkungen vor allem der Empathie, aber auch der Wertschätzung, feststellen. Man folgerte daraus, dass die Echtheit die zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit der anderen beiden Therapeutenvariablen darstellt. (Figge & SCHWAB, 1997, S. 30-34) Somit konnten sie auch die frühen Annahmen von Rogers bestätigen, wie sie oben vorgestellt wurden.
2.4.2 Allgemeine Psychotherapieforschung
Neben den Ergebnissen aus der Erforschung des klientenzentrierten Ansatzes bestätigen auch die Ergebnisse der allgemeinen Psychotherapieforschung eine therapeutische Beziehung mit den „Rogers-Variablen“ als für den Therapieerfolg wirksam. So hat Strupp (1996, S. 85) durch Studien zeigen können, dass nicht die therapeutischen Techniken, sondern die Qualität der Pati- ent-Therapeuten-Beziehung für den Therapieerfolg ausschlaggebend sind, wobei er betont, dass es in jeder Patient-Therapeut-Dyade etwas Einzigartiges gibt, das noch wichtiger ist als die sonst untersuchten Therapeutenvariablen. Jedenfalls bezeichnet er Empathie als „das vielleicht grundlegendste Prinzip aller Formen von Psychotherapie für Kliniker ganz unterschiedlicher Ausrichtung“. (1996, S. 86)
Orlinsky (1994) betont die allgemeine Wirksamkeit von Psychotherapie, ohne dass eine Rich- tung einer anderen überlegen sei. Er beruft sich auf Befunde von 1100 vergleichenden Effek- tivitätsforschungs- und Prozessergebnisuntersuchungen, nach denen keine deutlichen Unterschiede zwischen verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren belegt werden konnten und nach denen es „unspezifische“ oder „generische“ Prozessfaktoren gibt, die für das Therapieergebnis bedeutend sind. Daher setzt er sich für eine wissenschaftliche Integration psychotherapeutischer Behandlungsmodelle ein, wofür er gemeinsam mit Howard (vgl. Orlinsky, 1989, Orlinsky & Howard, 1987) das „Generic Model of Psychotherapy“ als ein wissenschaftlich be- gründetes Psychotherapiemodell entwickelt hat.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Generic Model of Psychotherapy, nach Orlinsky & Howard, 1987
Darin werden „Input-Variablen“, wie z.B. Therapeuten- und Patientenmerkmale, „Output-Varia- blen oder Auswirkungen der Behandlung“ und „Prozess-Variablen“ unterschieden. Der therapeutische Prozess, auf den sich Orlinsky in seiner Abhandlung konzentriert, beinhaltet nach bisherigen Forschungsergebnissen sechs Aspekte, nämlich
1. Der formale Aspekt: Der therapeutische Vertrag
2. Der technische Aspekt: Therapeutische Maßnahmen 20
3. Der Interpersonale Aspekt: Die therapeutische Beziehung
4. Der intrapersonale Aspekt: Innere Selbstbezogenheit
5. Der klinische Aspekt: Unmittelbare Auswirkungen der Therapiesitzung
6. Der zeitliche Aspekt: Der sequentiell verlaufende Prozess
Bei der Betrachtung der grafischen Veranschaulichung des Modells fällt auf, dass sich die therapeutische Beziehung im Zentrum befindet und mit einigen anderen Variablen im Zusammenhang steht, wie z.B. dem Therapievertrag, den therapeutischen Maßnahmen und Patienten- und Therapeutenmerkmalen wie z.B. der inneren Selbstbezogenheit. Weiter weist Orlinsky darauf hin, wie wichtig es ist, dass das therapeutische Behandlungsmodell, das Krankheitserleben des Patienten sowie Personenmerkmale auf beiden Seiten zusammen passen müssen, um die besten therapeutischen Resultate zu erzielen. Und schließlich betont er die Verschiedenartigkeit und Komplexität der Menschen, denen man nur durch eine Integration verschiedener Behandlungsmodelle gerecht werden kann. (Orlinsky, 1994, S. 2-8)
So weisen auch Bachelor und Horvath (2001, S. 154) darauf hin, dass Verhaltensweisen und Einstellungen des Therapeuten dann effektiv sind, wenn sie den Klienten angepasst werden, wobei sie sich auf Forschungsergebnisse z.B. von Dolan, Arnkoff und Glass (1993) sowie von Norcross (1993) beziehen. Sie betonen zudem auch den Beitrag, den jeder Klient zu einer effektiven Therapeuten-Klienten-Beziehung leisten muss, indem er sich u.a. am therapeu-tischen Prozess beteiligt und mit dem Therapeuten produktiv an den Therapiezielen arbeitet, was von Horvath und Luborsky (1993) nachgewiesen wurde.
Asay und Lambert (2001) haben zahlreiche empirische Ergebnisse zusammengetragen (z.B.
Lambert, 1992; Bergin & Lambert, 1978; Bergin & Suinn, 1975; Lambert & Bergin, 1994; Strupp, 1980; Orlinsky & Howard, 1986; Frank, Gliedman, Imber, Stone & Nash, 1959), die belegen, dass es für alle Psychotherapieschulen gemeinsam vier Wirkfaktoren gibt, die sich nach ihrer erklärten Varianz folgendermaßen aufteilen lassen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Wirkfaktoren nach Asay & Lambert, 2001, S. 49
Demnach können 40% der Besserung der Klienten auf Klientenvariablen und extratherapeu- tische Einflüsse des Klienten zurückgeführt werden. 30% des Therapieerfolges gehen auf die therapeutische Beziehung zurück und jeweils 15% des Therapieerfolges können mit Erwar- tungseffekten des Klienten und mit Methoden des Therapeuten erklärt werden. Mit diesen Pro- zentangaben fassen sie die Forschung auf diesen Gebieten gemäß ihrer Auffassung zu- sammen.
Tschuschke und Czogalik (1990, S. 407-408, 411) machen auch darauf aufmerksam, dass in praktisch allen Beiträgen ihres Buches mit den unterschiedlichsten Studien die Ergebnisse anderer Forscher (z.B. die von Strupp sowie von Orlinsky) bestätigt werden, nach denen eine gute Therapeuten-Patienten-Beziehung in ihrer Bedeutung für eine erfolgreiche Therapie nicht zu unterschätzen ist und vorausgesetzt wird.
3 Coaching
3.1 Grundlagen des Coaching
Coaching stammt ursprünglich aus dem Sport, wo man feststellte, dass die Sportler nicht nur Techniken trainieren müssen, sondern auch psychologisch fundierte Beratung für ihren Erfolg nutzen können. Nach Whitmore (1997, S. 13) war Timothy Gallwey (1999) der erste Sportcoach, der erkannte, dass der Gegner im eigenen Kopf schwieriger zu bezwingen sei als der gegnerische Sportler. Nach ihm setzt Coaching „das Potential eines Menschen frei, seine eigene Leistung zu maximieren. Es hilft ihm eher zu lernen, als daß es ihn etwas lehrt.“ (Whitmore, 1997, S. 14) Damit lag Gallwey ganz auf der Linie der humanistischen Psychologie, als deren Mitbegründer Rogers anzusehen ist. Sehr bald wurde die Coaching-Methode von Gallwey und anderen Coaches im Sport auf den wirtschaftlichen Bereich übertragen.
Zuerst wurde mit Coaching im betrieblichen Bereich in den USA „ein entwicklungsorientiertes Führen der Mitarbeiter durch den unmittelbaren Vorgesetzten verstanden“ (Heß & Roth, 2001, S. 14). Als in den 1980er Jahren der Begriff nach Deutschland importiert wurde, änderte sich seine Bedeutung zunächst zu einer Beratungsform für Manager auf den höheren Ebenen durch externe Coaches. Dieses Verständnis von Coaching wurde in die USA zurückimportiert, und mitlerweile wird im englischsprachigen Raum für diese Form des Coachings der Begriff Executive Coaching verwendet. Judge und Cowell (1997, zit. nach Kampa-Kokesch & Anderson, 2001, S. 207) stellen den Beginn des weitverbreiteten Executive Coachings um 1990 fest, wobei es auch davor schon vereinzelt Executive Coaching in den USA gab.
Heute gibt es eine Vielzahl von Bedeutungen und Definitionen für den Begriff des Coachings. Fengler (1997a) hat 15 verschiedene Definitionen für Coaching außerhalb des Sports in der Fachliteratur ausfindig machen können. Wenn man sich nur auf das Coaching im wirtschaft-li- chen Bereich, also auf das Business-Coaching, konzentriert, kann man die Systematisierung von Heß und Roth (2001, S. 16) nutzen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Systematisierung der unterschiedlichen Coaching-Varianten, nach He ß & Roth, 2001, S. 16
Demnach kann man Coaching in Einzel- und Gruppencoaching aufteilen. Zum Gruppen-
coaching gehören auch das Systemcoaching und das Projektcoaching. Das Einzelcoaching kann wiederum in Coaching durch die Führungskraft, durch einen internen Coach und durch einen externen Coach aufgeteilt werden.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Einzelcoaching durch einen externen Coach, wobei es keinen Grund zur Annahme gibt, dass die Prinzipien, die hierfür als wirksam erkannt werden, nicht auch für die anderen Formen des Coachings gelten. Doch wurde die empirische Studie ausdrücklich nur mit externen Coaches in Einzelberatung vollendet.
Auf die Vor- und Nachteile von internen und externen Coaches soll hier nicht näher einge- gangen werden. Hierfür sei auf die Literatur verwiesen. (vgl. z.B. Heß & Roth, S. 16-17) Riedel (2003, S. 12) hat die verschiedenen Dimensionen der Coaching-Definition, die seiner Studie zugrunde lagen, kurz zusammengefasst. Für diese Studie können die gleichen Dimensionen herangezogen werden:
1. Zielgruppe: Führungskräfte in Unternehmen
2. Thema: Führungskräfte als Personen im Arbeitskontext
3. Klienten-Bild: Handlungsfähige Individuen
4. Setting: eine Führungskraft und ein Coach
5. Coach-Rolle: unternehmensextern
6. Interaktionstyp: (Prozess-)Beratung
Auch die Definition von Rauen enthält einige wichtige Aspekte, die nicht vergessern werden sollten, wobei er dennoch betont, dass es „das Coaching“ eigentlich nicht gibt, sondern verschiedene Modelle und Vorgehensweisen unterschieden werden müssen. (Rauen, 2003a, S. 16):
„Coaching ist
- ein personenzentrierter Beratungs- und Betreuungsproze ß, der berufliche und private In- halte umfassen kann und zeitlich begrenzt ist, (keine „Rat-Schläge", sondern individuelle Prozeß-Beratung im Sinne einer auch präventiven Hilfe zur Selbsthilfe und zur Selbstver- antwortung)
- der auf der Basis einer tragfähigen und durch gegenseitige Akzeptanz gekennzeichnete Beratungsbeziehung in mehreren freiwilligen und vertraulichen Sitzungen abgehalten wird, ( d.h. der Klient wünscht das Coaching freiwillig von sich aus und der Coach sichert ihm Diskretion zu)
- für eine bestimmte Person ... mit Managementaufgaben,
- durch einen [oder mehrere] Berater mit psychologischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sowie praktischer Erfahrung bezüglich der thematisierten Problemfelder, (um die Situation des Klienten fundiert einschätzen und ihm qualifiziert helfen zu können)
- der auf der Basis eines ausgearbeiteten Coaching-Konzeptes agiert (um dem Klienten gegenüber sein Vorgehen und die verwendeten Interventionen erklären zu können und somit transparent und bewußtseinsfördernd zu arbeiten)
(vgl. Beckermann & Unnerstall, 1990, S. 26).
Ziel ist immer die (Wieder-)Herstellung und/oder Verbesserung der Selbstregulationsf ä higkeiten des Klienten, d.h. der Coach soll den Klienten derart beraten bzw. fördern, daß dieser den Coach nicht mehr benötigt." (Rauen, 2003a, S. 64)
Hier fällt das Menschenbild auf, nach dem im Coaching in den meisten Fällen gearbeitet wird, das schon von Whitmore betont wurde. Der Mensch ist selbst fähig, seine Probleme zu lösen. Man muss ihm nur Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ein „Coach ist kein Problemlöser, Lehrer, Be- rater, Ausbilder und nicht einmal ein Experte. Er ist ein Resonanzboden, Förderer, Ratgeber, er läßt das Bewußtsein wachsen.“ (Whitmore, 1997, S. 47) Das bedeutet, dass der Klient selbst seine Probleme lösen muss, dass ihm das auch kein Coach abnehmen kann. „Der Coach ver- sucht dabei, Prozesse so zu steuern, dass sie die Ressourcen des Gecoachten bestmöglich entwickeln, damit neue Wahlmöglichkeiten erkannt und genutzt werden können.“ (Rauen, 2002, S. 68) Dieses ist genau das humanistische Menschenbild, nach dem auch Rogers seinen per- sonzentrierten Ansatz entwickelt hat, und er hat sich in genau der gleichen Rolle gesehen. Allerdings ist das Coaching üblicherweise mehr problem- und lösungsorientiert (Böning, 2000, S. 25) als das in der Gesprächspsychotherapie der Fall ist, wo die Person selbst mehr im Mittel- punkt steht als das Problem. Daher wird von einem Coach neben psychologischen Kenntnissen und Fertigkeiten auch meistens Erfahrung und Wissen im betriebswirtschaftlichen Bereich und in Management- und Führungsfragen verlangt. Während die meisten Autoren (z.B. Rauen, 2002; Schreyögg, 2003) solch eine Doppelqualifizierung von einem Coach erwarten, setzt Whit- more (1997, S. 48) ganz auf die psychologischen Fähigkeiten. Für ihn ist ein „Expertenwissen“ in Sachfragen eher hinderlich, weil die meisten Coaches dadurch zu sehr versuchen, ihr eigenes Wissen dem Gecoachten nahe zu legen, was diesem die eigene Verantwortung nimmt. Im sys- temischen Coachingansatz von Giglio, Diamante und Urban (1998) kann man beide Ansprü- che erfüllt sehen. Ihr Coachingprozess durchläuft verschiedene Schritte:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 Systemischer Coaching-Ansatz, nach Giglio, Diamante & Urban, 1998, S. 97
Obwohl der Coach objektive Informationen anbieten soll - also Expertenwissen zur Verfügung stellt - wird darauf Wert gelegt, dass die Beziehung zwischen Coach und Klient zum Lernen anregt und nicht Lösungen präsentiert werden. Die Lösungen sollen vom Klienten selbst ent-wi- ckelt werden, mit Hilfe der Informationen durch den Coach.
Auch von Jüster (2003, S. 239) wird die Eigenverantwortung des Klienten betont, der auf der
gleichen Augenhöhe mit dem Coach steht, durch den er gefördert wird. Als Ziel eines Coachings gibt er an, dass die Arbeitsqualität und Arbeitszufriedenheit verbessert werden soll. (Jüster, 2003, S. 235) Looss und Rauen (2002, S. 116) erklären die Ziele noch etwas detaillierter: Der Klient soll durch den Coach ein Feedback bekommen, das gerade auf höheren Managementetagen oft fehlt. Ihm sollen mehr Wahlmöglichkeiten für sein Verhalten und Erleben gezeigt werden und gleichzeitig Wahrnehmungsverzerrungen und blinde Flecke verringert werden. Die Arbeitsfähigkeit und Leistung des Klienten soll verbessert werden.
Evered und Selman (1989, S. 23) betonen ebenfalls, dass Coaching dem Klienten hilft, Dinge zu sehen, die er auf keine andere Weise sehen könnte, wodurch die Arbeitsergebnisse positiv be- einflusst werden.
Rauen hat im Coaching-Newsletter vom Juni 2004 die Grundwerte im Coaching erläutert. Wenn sich ein Klient für ein Coaching entscheidet, sollen die folgenden Vorasusetzungen erfüllt sein, damit Coaching positive Ergebnisse erbringen kann:
Ein Coaching sollte in jedem Fall freiwillig gesucht und nicht „verordnet“ werden. Denn durch die Erkenntnis der Notwendigkeit für eine Beratung wird ein Klient erst bereit sein, sich beim Coaching auch so zu engagieren, dass eine Veränderung bewirkt werden kann.
Der Klient braucht ein funktionierendes Selbstmanagement, was bedeutet, dass er nicht psy- chisch krank sein darf, wofür er dann eine Psychotherapie bräuchte. In so einem Fall muss ein Coaching abgelehnt oder abgebrochen und eine Psychotherapie eingeleitet werden. Der Coach und die Beratungsform „Coaching“ an sich müssen vom Klienten akzeptiert werden. Zwischen beiden muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden können und der Coach muss als gleichwertiger Partner mit Beratungskompetenz wahrgenommen werden. Der Coach muss für eine spannungsfreie Situation sorgen, die zur Offenheit ermutigt. Dafür muss er immer diskret sein und darf den Klienten nicht bewerten. Er soll nicht manipulativ sein, sondern sein Konzept transparent für den Klienten darlegen. Offenheit bedeutet auch, dass man auch unangenehme Fakten benennen kann, ohne den Klienten zu entmutigen. Ein Coaching kann nur wirksam sein, wenn der Klient eine Bereitschaft zur Veränderung mit- bringt, auch in mitunter unangenehmen Bereichen.
Die Coachinginhalte müssen absolut vertraulich behandelt werden und dürfen auch nicht an den Arbeitgeber des Klienten weitergegeben werden.
Der Coach ist in seiner Rolle ein bedeutender Feedbackgeber, muss aber neutral bleiben, ohne politische oder ideologische Einflussnahme.
Der Coach muss ständig daran arbeiten, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und verstärkt wird. Und schließlich ist Coaching ein zweckgebundener Prozess, der von Anfang bis Ende ziel- und leistungsorientiert von Coach und Klient verwirklicht werden muss. (Rauen, 2004a)
3.2 Coaching-Ansätze
Es gibt eine unüberschaubare Zahl verschiedener Coaching-Ansätze, denn fast jeder CoachingPraktiker entwickelt seinen eigenen Coaching-Ansatz.
Rauen (2003a) hat versucht, die bedeutendsten Coaching-Ansätze vergleichend darzustellen und zu ordnen. Exemplarisch seien hier einige davon herausgegriffen und erwähnt, auf welche Hintergründe und Methoden sie aufbauen.
Brinkmann (2000) beschreibt ein internes Vorgesetzten-Coaching für Mitarbeiter und Teams, bei dem die Systemtheorie und die Systemische Therapie den Hintergrund bilden. Er wendet u.a. das transaktionsanalytische Kommunikationsmodell an.
Hamann und Huber (1991) erläutern ebenfalls ein internes Vorgesetzten-Coaching, in dem sie auf die Transaktionsanalyse aufbauen und transaktionsanalytische und NLP-Methoden ver- wenden.
Huck (1989) gründet sein externes Einzel- und Team-Coaching hauptsächlich auf kognitivistisch-psychologische Methoden. Und so verwendet er vor allem kognitiv-psychologische Verfahren, wie z.B. die Rational Emotive Verhaltenstherapie nach Ellis. Weiß bezieht sich in seinem Selbst-Coaching-Konzept auf die Neuro-Linguistische Programmierung (NLP) und verwendet dementsprechend NLP-Methoden.
Whitmore (1997) erläutert sein vielfältig einsetzbares Konzept, das für internes und externes Coaching, für Einzel- und Gruppencoaching anwendbar ist. Er wendet gesprächspsychotherapeutische Gespräche und das sogenannte GROW-Modell (Goals - Reality - Options - Will) an, das durch ihn recht weite Verbreitung gefunden hat.
Wie unschwer zu erkennen ist, bauen einige der verbreiteten Coaching-Ansätze auf Menschen bildern oder Methoden von Psychotherapieschulen auf. Man entlehnt erprobte Methoden der verschiedensten Richtungen der Psychotherapie, die teilweise auch von einem philosophischen Hintergrund geprägt sein können, auch für das Coaching.
3.3 Qualität von Coaching
Die Grundwerte im Coaching, die oben von Rauen erläutert wurden, könnte man als Mindestqualitätsanforderungen für Coaching betrachten.
Qualität hat auch viel mit Qualifikation zu tun. Denn um ein qualitativ hochwertiger Coach zu sein, muss man bestimmte Qualifikationen mitbringen. Heß und Roth (2001, S. 51-59) gehen auf die verschiedenen Qualifikationsaspekte ein, die man von einem Coach erwarten sollte: Zu- vor wurde schon auf die fachliche Doppelqualifikation hingewiesen, die von einem Coach sowohl psychologische als auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verlangt. Hinzu kommt noch die sogenannte Feldkompetenz, die von den unterschiedlichen Coaching-Autoren verschieden stark gefordert wird, worunter Kenntnisse über das Arbeitsfeld des Klienten verstanden werden.
Zur methodischen Qualifikation gehört neben einer methodischen Berater-Kompetenz auch dia- gnostisches Wissen, sowohl über Auswahl- und Testverfahren als auch über Symtome von z.B. Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen, um den Klienten bei Bedarf an einen Psychotherapeu- ten weiter zu empfehlen. Rauen betont im Coaching-Newsletter vom September 2004: „Haltung kann nicht durch ein Mehr an methodischer Kompetenz ersetzt werden. Vielmehr ist ein sinn- volles Zusammenwirken nötig: So zeigt die Erfahrung, dass die Beziehungsqualität zwischen Coach und Klient von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg der Beratung ist. Beziehungsge- staltungskompetenz ist aber auch von einer - teilweise kaum noch bewusst wahrgenommenen - Methodenkompetenz abhängig. Es ist also nicht nur die Haltung und nicht nur die Methodik, sondern dass [ sic ] sinnvolle Zusammenwirken dieser und weiterer Faktoren, die Coaching zu einer erfolgreichen Disziplin der Beratungspraxis machen können.“ (Rauen, 2004b) Es ist also wichtig zu sehen, dass keine der hier genannten Faktoren alleine für sich den Coaching-Erfolg sichern können.
Für ebenso wichtig werden auch persönliche und soziale Kompetenzen erachtet. Heß und Roth (2001, S. 54) fassen diese Kompetenzen zusammen (siehe Tabelle 1, S. 28), wobei sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Dabei fallen vor allem die ersten drei sozialen Kompetenzen Empathie, Wertschätzung und Authentizität auf, die schon als die sogenannten „Roger-Variablen“ vorgestellt wurden. Auch das „aktive Zuhören“ stammt ursprünglich von Rogers' Theorie ab.
Schließlich wird von Heß und Roth (2001) auf die Bedeutung von Supervision hingewiesen, da ein Coach niemals auslernen kann, sondern immer selbst an sich arbeiten und seine Kompetenzen ausbauen sollte.
Persönliche Kompetenzen Soziale Kompetenzen
- ein in der westlichen Kultur begründetes Welt- und Menschenbild und gleichzeitige Offenheit für transkulturelle Bezüge
-Humanistisches Menschenbild (bzw. Orientierung an klarem u. Transparentem Wertesystem
-Ideologische Offenheit
-Überzeugung von Entfaltungs- und Entwicklungsfähigkeit des Menschen (Glaube an den im Werden begriffenen Menschen)
-Aufgearbeitete Lebenserfahrung
-Eigenverantwortung
-Belastbarkeit
-Selbsterfahrung
-Selbstreflexionsfähigkeit
-Analytisch/strategische, systemische, kom- plexe, kreative Denkfähigkeit
-Persönliche Ausstrahlung
-Empathie
-Wertschätzung
-Authentizität
-Selbstdistanzierungsfähigkeit
-Aktives Zuhören
-Zuwendungsbereitschaft
-Mitschwingungsfähigkeit und Distanzierungsfähigkeit
-Beziehungsgestaltungsfähigkeit
-Schaffen einer Vertrauensvollen Gespräch- satmosphäre
- Konfliktlösefähigkeit
Tabelle 1 „ Persönliche und soziale Kompetenzen des Coaches" nach He ß und Roth, 2001, S. 5
Um die Qualität von Coaching zu sichern, braucht man verbindliche Qualitätsstandards und auch Ausbildungsstandards. Nach Böning (2000, S. 25-26) gibt es langsam einige Versuche verschiedener Institute und Standesorganisationen, verbindliche Qualitätsstandards und professionelle Zugangskriterien festzulegen, um das Coaching zu professionalisieren, damit sich nicht mehr jeder als Coach bezeichnen kann, ohne die notwendigen Voraussetzungen mitzu- bringen. Zum Beispiel hat die „Interessengemeinschaft Coaching“ das Ziel, „qualitative Richt- linien zu schaffen, die es (potenziellen) Klienten erlauben, mit einem Coaching keine beliebige, sondern eine definierbare und vor allem hochwertige Beratungsdienstleistung in Anspruch zu nehmen. Durch die Förderung unabhängiger wissenschaftlicher Forschung und die Orientierung an fundierten Qualitätsmerkmalen strebt die „Interessengemeinschaft Coaching“ vor allem Auf- klärung und Transparenz in der Coaching-Branche an.“ (Interessengemeinschaft-Coaching, 2004) Auch die „International Coach Federation“ bemüht sich u.a. durch ihr Zertifizierungsprogramm darum, „die Standards und Ethik des Coaching auf hohem Niveau zu prägen und weiter zu entwickeln.“ (ICF-Deutschland, 2003) Um die sinnvollen Qualitätsmerkmale beim Coaching auch empirisch abzusichern, haben Heß und Roth auf die Dreiteilung der Qualitätsdimensionen bzw. Qualitätsebenen von Donabedian (1982) gebaut. Dabei wird die Qualität im Bereich der Dienstleistungen mehrdimensional be- trachtet.
- „Strukturqualität bezieht sich auf alle Ausstattungsdimensionen, wie personelle (Qualifikai- tonen des Coaches etc.), materielle und räumliche Ausstattungen, die als Voraussetzungen für die Umsetzung der Prozeßqualität betrachtet werden.
- Mit Prozeßqualität sind alle Aktivitäten gemeint, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles beitragen sollen. Sie ist eine dynamische Größe und beschreibt die Art und Weise, wie eine Dienstleistung erbracht wird.
- Die Ergebnisqualität beschreibt den Erfolg einer Maßnahme i.S. Eines Vorher-Nachher-Ver- gleichs als auch hinsichtlich der subjektiven Zufriedenheit des Klienten.“ (Heß & Roth, 2001, S. 63)
Es wird betont, dass die drei Qualitätsdimensionen in keinem kausalen Verhältnis zueinander stehen und dass die Struktur- und Prozessqualität zwar notwendige, aber nicht hinreichende Be- dingungen für die Ergebnisqualität darstellen. Vielmehr reicht es für ein gutes Coaching nicht aus, dass es zu einem guten Ergebnis führt, sondern die Struktur- und Prozessqualität sollen genauso in die Qualitätsbeurteilung mit einbezogen werden. (Heß & Roth, 2001, S. 63-64) Nach der Expertenbefragung konnten Heß und Roth den verschiedenen Qualitätsdimensionen konkrete Faktoren zurechnen, die für die Qualität von Coaching besonders wirksam sind. (2001, S. 141-143) Hier soll nur eine Auswahl dieser Faktoren benannt werden. Zur Strukturqualität gehören erst einmal die Eigenschaften und Kompetenzen des Coaches, darunter u.a. auch die Qualifikationen, wie sie oben beschrieben wurden. Ebenso dazu gehören Voraussetzungen des Klienten, wie z.B. Veränderungsbereitschaft, ohne die ein Coaching nicht funktionieren kann. Dann gehören dazu Aspekte des Unternehmens, wie z.B. Transfermöglichkeiten, die genauso zur Qualität beitragen. Und schließlich gehört dazu die Beziehung zwischen Coach und Klient. Die einzelnen qualitätsförderlichen Beziehungsaspekte sind
- Passung (persönliche, berufliche)
-Vertrauen
-Akzeptanz
-Sympathie
-Solitär-Beziehung
-Offenheit
-Gleichwertigkeit
-Ehrlichkeit
Die Prozessqualität beinhaltet solche Aspekte wie z.B. Transparenz der Vorgehensweise und der professionellen Orientierung, Einsatz von Methoden und der formale und psychologische Vertrag.
Zur Ergebnisqualität zählen die Zielerreichung und die Zufriedenheit des Klienten sowie die emotionale Entlastung, die Erweiterung des Handlungsrepertoires und Einstellungsver- änderungen.
Lauterbach (2003) hat sieben Qualitätsmerkmale für Coaching-Prozesse umrissen, wobei er die Ergebnisse der Psychotherapieforschung auf Coaching überträgt, was ihm legitim erscheint, weil die „kommunikativen Strukturen und die Prozesse im Coaching und in der Psychotherapie Ähnlichkeiten aufweisen, selbst wenn sich die inhaltliche Fokussierung unterscheidet. Zudem sind die im Coaching eingesetzten Methoden im wesentlichen aus beraterischen und psychotherapeutischen Schulen importiert worden ...“ (Lauterbach, 2003, S. 104-105). Allen voran steht bei ihm die tragfähige Beziehung bzw. Kooperationsbeziehung. Das erklärt er folgendermaßen: „Die Beziehung wird von Coach und Kunde als gut, wertschätzend und tragfähig erlebt und be- schrieben. Der Vertrauensschutz ist verabredet. Der Kunde fühlt sich vom Coach bezüglich sei- nes Anliegens verstanden und erlebt eine Arbeitsbeziehung 'auf gleicher Augenhöhe'“. (Lauterbach, 2003, S. 108-109) Als weitere Qualitätsmerkmale nennt er „Transparenz der Me- thodik, Klarheit des Prozesses“, „Ziel-, Ergebnis- und Lösungsorientierung, Ressourcen- orientierung“, „Einbeziehung der biographischen Dimensionen (Vergangenheit / Zukunft)“, „Brei- te und Tiefe der Themen“, „Unterstützung bei Problemlösung und Entwicklungsschritten“ und schließlich „Metareflexion“.
Obwohl Lauterbach diese Qualitätsmerkmale nennt, betont er dennoch, dass es bei der Qualität für den einzelnen Kunden darauf ankommt, ob ein Coach in der Lage ist, „seine Kompetenzen und Erfahrungen in dem jeweiligen Coaching-Prozess zum Schwingen zu bringen.“ (2003, S. 96) Denn nicht jeder Coach ist für jeden Kunden und für jedes Problem der Passende. Um für jeden Kunden die Qualität zu sichern, soll der Klient im Rahmen von Zwischen- und Abschluss- evaluationen sowie nach einem zeitlichen Abstand direkt befragt werden. (Lauterbach, 2003, S. 111)
Auch die empirische Forschung und der qualifizierte Austausch über Coaching sollen helfen, die Qualität von Coaching zu fördern. (Lauterbach, 2003, S. 119-120)
3.3.1 Coach-Klienten-Beziehung
Aus den verschiedenen Qualitätsanforderungen für das Coaching wurde für diese Arbeit der Aspekt der Beziehung beim Coaching herausgegriffen. Dabei soll ausdrücklich darauf hinge- wiesen werden, dass eine optimale Beziehung (vgl. folgende Erläuterungen) alleine noch kein gutes Coaching ausmacht. Doch durch die Forschungsergebnisse der Psychotherapie- forschung, wie sie oben beschrieben wurden, wirft sich die Frage auf, ob die Beziehung beim Coaching einen ebenso wichtigen Wirkfaktor darstellt wie es für die Psychotherapie nachge- wiesen wurde.
Verschiedene Autoren (vgl. Evered & Selman 1989; Giglio et al., 1998; Jansen, Mäthner & Bachmann, 2003) weisen immer wieder auf die herausragende Bedeutung der Coach-Klienten- Beziehung hin, wobei sie sich oft auf die Ergebnisse der Psychotherapieforschung stützen, aber auch eigene Coachingforschungsergebnisse angeben. Holm-Hadulla (2002, S. 244) z.B. sieht keinen Grund, dass in einer Beratungsbeziehung wie dem Coaching die Qualität der Beziehung von Patient und Klient nicht genauso entscheidend für den Erfolg sein soll wie das durch die Psychotherapieforschung wissenschaftlich belegt wurde.
Whitmore (1997, S. 12) konstatiert: „Coaching betrifft in erster Linie die Art der Beziehung zwi- schen dem Coach und dem Gecoachten und die Mittel und den Stil der verwendeten Kom- munikation.“ Lauterbach (2003, S. 106) überträgt die Einflüsse des Beziehungsgeschehens zwi- schen Therapeut und Klient, die als die am besten gesicherten Ergebnisse in der Psychothera- pieforschung gelten, direkt auf Coaching: „durch die Herstellung und Aufrechterhaltung einer gu- ten Beziehung leistet der Coach einen wesentlichen, möglicherweise sogar den wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Coaching-Prozesses.“ Dabei betont er, dass „gute Beziehungen“ je nach Klient und Situation sehr unterschiedlich aussehen können. Für ihn muss ein guter Coach die Fähigkeit besitzen auf Grundvariablen wie Empathie, Wertschätzung u.a.m. aufbauend je- weils die passende Beziehung herzustellen. Wenn einem Coach das gelingt, kann er durch sein Beziehungsverhalten auch die Offenheit für Veränderungen und eine engagierte Mitarbeit beim Coachingprozess des Klienten verstärken, die genauso notwendig für einen Erfolg sind. Obwohl die Verantwortung für den Erfolg des Coachingprozesses beim Klienten liegt, ist es die Aufgabe eines professionellen Coaches, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der Klienten angstfrei lernen können. Denn der Druck einer Situation, der einen Klienten zur Einsicht für ein Coaching bringt, ist häufig von Ängsten begleitet. Solche Ängste sind aber lernhinderlich und können eine Ver- änderungsbereitschaft aufhalten, wie Looss und Rauen erklären. (2002, S.130) Um eine solche Beratungsbeziehung zu erreichen, braucht der Coach „fachliche komplexe und menschliche
Qualitäten, die weit über antrainierbare Techniken hinausgehen.“ (Looss & Rauen, 2002, S. 122) Daher kann es auch vorkommen, dass auch relativ unerfahrene Coaches hervorragende Beratungen leisten können, wenn ihnen gelungen ist, eine entsprechende Beziehung zum Klienten aufzubauen und wenn die „Chemie“ zwischen beiden stimmt. Damit man für jeden Klienten einen passenden Coach finden kann, ist ein Beraterpool notwendig, der aus männlichen und weiblichen, aus jüngeren und älteren sowie psychologisch und manageriell orientierten Coaches besteht. (Looss & Rauen, 2002, S. 139-140)
Neben möglichen Ängsten können Gefühle der Isolation und Abkapselung für Führungskräfte eine große Rolle spielen. Daher gehört die Fähigkeit, gut zuhören und verstehen zu können zu den wichtigsten Eigenschaften eines Coaches. (Rauen, 2003a, S. 27)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 Elemente des Coaching, aus Riedel, 2003, S. 25
Riedel (2003, S. 25) nennt fünf Elemente des Coaching, die in ihren Ausprägungen alle für den Erfolg oder Misserfolg eines Coaching entscheidend sind: der Klient, der Coach, ihre Beziehung zueinander, das gemeinsame Ziel und das Beratungskonzept, in das die anderen Elemente ein- gebettet sind. Dabei betont er an verschiedenen Stellen die wichtige Bedeutung der Beratungs- beziehung. (Riedel, 2003, S. 151-158) „Das Verhältnis von Coach zu Coachee impliziert eine Rollenasymmetrie - aber nicht die zwischen einem technisch-fachlichem Experten und einem Laien, sondern die zwischen einem methodisch versierten Sparrings-Partner und einem selb- ständig Lösungen suchenden Klienten als Experten in eigener Sache. Der Interaktionsstil sollte dabei immer von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein." (Riedel, 2003, S. 28)
3.4 Aktueller Stand der Coachingforschung
Im Frühling 2003 stellte Wasylyshyn fest, dass es noch wenig „outcome research“ über Coaching gibt, obwohl „executive coaching“ immer mehr praktiziert wird.
Auch in Deutschland gibt es noch nicht so viel Forschung über Coaching wie man sich das bei der Ausbreitung von Coaching wünschen würde. Doch ist in den letzten Jahren ein vermehrtes Interesse der Wissenschaft für Coaching zu bemerken. Auf http://www.coaching-report.de/for- schung_wissenschaft/index.htm (Rauen, 2004c) kann man (Stand vom 8.7.2004) 34 deutsch- sprachige Forschungsarbeiten finden, die zur Zeit durchgeführt werden oder schon abge- schlossen sind. Darunter sind sieben Dissertationen, während die meisten Arbeiten Diplom- arbeiten sind. Die ersten Arbeiten stammen von 1998. Seit 2003 stieg die Anzahl der Arbeiten überdurchschnittlich schnell an, wobei die wenigsten Arbeiten auch veröffentlicht werden. Riedel (2003, S. 56) konnte 30 englische und deutsche Forschungsarbeiten identifizieren, wobei er keine Diplomarbeiten oder ähnliches mit einbezog. (vgl. z.B. Geßner, 2000; Hall et al., 1999). Er unterscheidet die Forschungsprojekte zum einen nach den Ebenen der Forschungsfragen: „Definitionen“, „Angebot“ und „Nachfrage“, „Evaluation“ und „Wirkunsweise & -mechanismen“ sowie zum anderen nach den verwendeten Untersuchungsmethoden „Konzeptionelle Arbeiten“, „Quantitativ-empirische Arbeiten“ und „Qualitativ-empirische Arbeiten.“ Riedel bemerkte in seiner Arbeit, dass die Angebots- und Nachfrageseite von Coaching am besten erforscht sei, während Coaching selten evaluiert wurde, da vielen Forschern der Zugang zu Coaching-Klienten fehlt. (Riedel, 2003, S. 49-50) Dieses Problem war auch in dieser Studie nicht ganz einfach zu lösen, denn man konnte nur über Coaches an Klienten kommen. Auch Schmidt und Keil bemängeln die wenigen Studien zu Wirkweisen und Evaluation von Coaching. Die wenigen Forschungsansätze auf diesem Gebiet sind meist qualitativ-explorativ, wobei hauptsächlich Coaches als Experten befragt werden (vgl. Heß & Roth, 2001; Roth, Brüning, & Edler, 1996). „Die Perspektive der Coachingnehmer wurde bisher kaum berücksichtigt. Es fehlt ein Screening der Coachinglandschaft aus Klientensicht Die bereits geleisteten umfang- reichen Evaluationsstudien qualitativ-explorativer Ausrichtung stehen in einem Missverhältnis zu den wenigen darauf aufbauenden adäquaten quantitativen Untersuchungen.“ (Schmidt & Keil, 2004, S. 240)
Mit dieser Arbeit wird das Coaching mit einem quantitativen Verfahren aus Klientensicht bewertet, womit das oben genannte Missverhältnis angegangen wird.
Hier sollen nun einige - für diese Arbeit bedeutende - veröffentlichte Forschungsarbeiten aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum vorgestellt werden.
Die Expertenbefragung zur Qualitätseinschätzung und -entwicklung von Heß und Roth (2001) wurde schon im vorigen Kapitel erwähnt. Hier wurden professionelle Coaches u.a. danach befragt, was für ein qualitativ hochwertiges Coaching notwendig erscheint. Die Ergebnisse wurden teilweise oben referiert, da die Beziehung zwischen Coach und Klient als ein Aspekt der Strukturqualität angesehen wird; sie begründen also die Forschungsfragen dieser Arbeit mit. Boyatzis (2002, S. 7-19) hat Berater danach unterschieden, ob sie durchschnittliche oder über- durchschnittliche Erfolge aufweisen konnten. Dabei konnte er acht Kompetenzen finden, nach denen man die herausragenden von den durchschnittlichen Beratern unterscheiden konnte, von denen fünf Merkmale nach t-Tests signifikant waren, nämlich 1) der Glaube an die Fähigkeit der Menschen, sich zu ändern, 2) Wirksamkeit und Kraft, 3) psychologische diagnostische Fähigkeiten, 4) Empathie und 5) Echtheit oder Kongruenz. Empathie und Echtheit konnten davon am stärksten zwischen mehr und weniger erfolgreichen Beratern differenzieren. Er übertrug diese Ergebnisse direkt auf das Coaching und nannte Empathie und Echtheit die beiden wichtigsten Kompetenzen für effektives Coaching.
Hall et al.(1999, S. 44-52) interviewten 75 Führungskräfte aus bedeutenden Unternehmen sowie 15 führende Coaches und fragten sie nach den Erfolgsfaktoren für Coaching. Aus der Sicht der Klienten waren das ehrliches Feedback, gutes Zuhören, klare Ziele sowie Zugänglichkeit und Verfügbarkeit des Coaches. Die Coaches hielten eine persönliche Verbindung mit dem Klienten, Verständnis dafür, wo der Klient steht, gutes Zuhören, gemeinsames Nachdenken, Empathie, Nachhalten von Plänen, Vorleben einer „Trial & error“-Haltung für die Erfolgsfaktoren von Coaching. (zit. nach Riedel, 2003, S. 50-51)
Holm-Hadulla führte 2002 eine Prozessstudie durch, „in der die Effektivität und Effizienz seines Coachingkonzeptes empirisch überprüft und einzelnen Prozessvariablen (hilfreiche Beziehung, kognitiv-verhaltenstherapeutisches Lernen, psychodynamisches Verstehen und ressourcenorientiertes Verstärken) erforscht“ wurden. (Holm-Hadulla, 2002, S. 247) Die entgültigen Ergebnisse wurden aber noch nicht veröffentlicht.
Riedel (2003) hat Coachingsitzungen mit eigenen Klienten audiotechnisch aufgezeichnet und ausgewertet. Er konnte zeigen, dass Coaching wirkt, indem es handlungsleitende Kognitionen von Führungskräften verändert. Obwohl er die Beziehung zwischen Coach und Klient in seinem theoretischen Teil als wirksames Coachingelement erwähnt, geht er in seinem empirischen Teil nicht mehr ausdrücklich auf den Beziehungsaspekt ein.
Wasylyshyn (2003) führte eine Studie zu Coachingergebnissen durch. Darin ging es 1. um die Reaktionen der Führungskräfte, wenn sie gecoacht werden sollten, 2. um die Vorraussetzungen, die Führungskräfte verlangen, wenn sie einen Coach suchen, 3. um die persönlichen Charakter- eigenschaften von effektiven Coaches, 4. um „für und wider“ von externen bzw. internen Coa- ches, 5. um die schwerpunktmäßigen Ziele von Coachingprozessen, 6. um Bewertungen von Coaching-Tools, 7. um Indikatoren von erfolgreichem Coaching und 8. um das Andauern von Lerneffekten oder von Verhaltensveränderungen als Folge von Coaching. Der hier interessierende Aspekt der „persönlichen Charaktereigenschaften von effektiven Coa- ches“ zeigte, dass eine starke Verbindung zwischen Coach und Klient als wichtigste Eigenschaft gilt. Darunter sind z.B. die konkreten Eigenschaften wie Empathie, Wärme, Vertrauensbildung und die Fähigkeit zuhören zu können zu verstehen - Begriffe, die auch von Rogers' Theorie be- kannt sind. (Wasylyshyn, 2003, S. 98)
„The Coaching Study 2004“ (Arnott & Sparrow, 2004) wurde u.a. durch die University of Central England verwirklicht. Dort wurden an über 1000 Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbei- tern Fragebögen über die Erfahrungen mit Coaching geschickt, von denen 110 Organisationen antworteten. Von diesen Organisationen nutzten 55% Coaching für ihre Mitarbeiter. Es wurden drei Faktoren gefunden, die den Wert des Coaching positiv beeinflussen: 1. ein strukturiertes Coachingkonzept, 2. Coachingqualifikationen, die aber nicht näher beschrieben wurden und 3. der persönliche Stil eines Coaches.
Schmidt und Keil (2004) haben in einer quantitativen Studie mit einem Fragebogen nach den Er folgsfaktoren von Einzel-Coaching, nach der Rolle des Coaches wie sie vom Klienten wahr- genommen wird, nach den kontrainduzierten Faktoren, die zum Misslingen von Coaching füh- ren, sowie nach den Kriterien zur Erfolgsbeurteilung durch die Coachingklienten gesucht. Dabei konnten sie faktorenanalytisch zehn Erfolgsfaktoren extrahieren. Als erster Faktor mit der deutlich höchsten Faktorladung wurde die Qualifikation des Coaches genannt. Dabei wurde be- tont, dass die sogenannte Beziehungsgestaltungskompetenz eine größere Rolle spielte als die fachliche Qualifikation. Für die gefundenen zehn Faktoren wurde dann regressionsanalytisch un- tersucht, welche der Faktoren eine prädiktive Wirkung für den Coachingerfolg haben. „Eine prädiktive Wirkung im Sinne echter Determinanten für den Coachinggesamterfolg kommt in un- serer Studie somit nur den seitens der Klienten zugeschriebenen Ausprägungen bezüglich der beiden Faktoren Qualifikation des Coaches und Involvement des Coaches zu.“ (Schmidt & Keil, 2004, S. 246)
Das Executive Coaching Forum hat in seinem Executive Coaching Handbook, das online zu
finden ist (The Executive Coaching Forum, 2004), auf der dort verwendeten Definition von Coaching aufbauend sechs offene Forschungsfragen formuliert, die ein millionenschwerer Wirtschaftsbereich, wie Coaching es mittlerweile ist, seinen Klienten, deren Familien und Organisationen schuldig ist; denn Coaching kann nicht nur auf praktischen Weisheiten als einziger Führung bauen. Diese sechs Forschungsthemen sind:
1. Die Führungskraft
2. Der Coach
3. Die Beziehung zwischen Führungskraft und Coach
4. Der Coachingprozess
5. Der organisationale Kontext des Coachings
6. Coachingergebnisse
Der 3. Punkt zur Beziehung zwischen Führungskraft und Coach lässt sich wie folgt weiter diffe- renzieren:
- Welche Faktoren beeinflussen die Passung von Coach und Klient?
- Wie sollte der Coach mit den Erwartungen des Klienten von Coaching umgehen?
- Welche Rolle spielen bewusste oder unbewusste Beziehungsaspekte zwischen Coach und Klient für den Erfolg oder Misserfolg des Coachings?
- Wie sollte sich die Beziehung über die Zeit entwickeln?
- Welche ethischen Fragen können und werden in der Beziehung zwischen Führungskraft und Coach auftauchen? (THE EXECUTIVE COACHING FORUM, 2004, S. 8-13) Somit ist diese Arbeit ein Schritt, um eine dieser offenen Forschungsfragen näher zu beleuch- ten.
3.5 Coaching und Psychotherapie
3.5.1 Differenz und Konvergenz
Nachdem nun die beiden maßgeblichen Theoriebestandteile dieser Arbeit, nämlich Rogers' Psychotherapieansatz und Coaching, vorgestellt wurden, soll hier gezeigt werden, wie diese beiden Ansätze zusammengehören und wie man begründen kann, einen Psychotherapieansatz, nämlich den personzentrierten Ansatz von Rogers, auf Coaching anzuwenden.
In der Coachingliteratur wird häufig auf den Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie hingewiesen. Mit dieser Betonung des Unterschiedes will man sicher auch die Bedenken von potentiellen Klienten ausräumen, die zuweilen Angst haben könnten, bei einem Coach plötzlich „auf der Couch“ zu landen und als „nicht normal“ oder „Problemfall“ abgestempelt zu werden, wenn sie sich mit einem Coach treffen.
Rauen (2003a) differenziert das Problem, indem er feststellt, dass beim Coaching durchaus psy- chotherapeutische Techniken, wie z.B. Gesprächstechniken, kognitive Verfahren oder Rollen- spiele, verwendet werden. Aber Coaching soll hauptsächlich helfen, die Probleme zu bearbeiten, die mit dem Beruf und dem Arbeitsleben zu tun haben, auch wenn diese mit persönlichen Pro- blemen zusammenhängen können. Der Fokus liegt aber auf der „Berufspersönlichkeit“. Zudem geht es beim Coaching nicht - wie bei der Psychotherapie - darum, die Ursachen hinter den Problemen zu erforschen, sondern konkrete Ziele zu erreichen. Dabei ist beim Coaching die Fä- higkeit der „Selbstwirksamkeit“ des Klienten Vorraussetzung. Ist diese nicht gegeben, wenn z.B. psychische Probleme oder Abhängigkeitserkrankungen vorliegen, muss der Coach den Klienten an einen Psychotherapeuten verweisen. Schließlich gibt es bei der Psychotherapie keine beson- dere Zielgruppe, wie das beim Coaching meist die Führungskräfte sind. (Rauen, 2003a, S. 69) Rauen (2003a) hat die Gemeinsamkeiten und Unterschiede übersichtlich in einer Tabelle (siehe Tabelle 2, S. 36) zusammengefasst.
Lauterbach, der die Ergebnisse der Psychotherapieforschung auf Coaching übertragen hat, argumentiert, dass der entscheidene Unterschied nur in den verschiedenen Rahmenbedingungen und Vertragsbedingungen von Coaching und Psychotherapie liegt. (Lauterbach, 2003, S. 105) Auch für Schmidt-Lellek (2003, S. 231) scheinen die Instrumente der Psychotherapie zu wertvoll zu sein, um sie nur bei Krankheiten anzuwenden.
Holm-Hadulla betont, „dass auf der Grundlage der bewährten und wissenschaftlich fundierten psychotherapeutischen Techniken verlässliche und nachvollziehbare Coachinghaltungen, Strategien und Techniken eingesetzt werden können. Mit vier effektiven Bestandteilen von Psychotherapie könnte Coaching wissenschaftlich begründet werden:
- Gestaltung einer hilfreichen Beziehung,
- kognitiv-verhaltensorientiertes Training von Fähigkeiten,
- psychodynamisches Verstehen von Konflikten,
- systematisches Verändern dysfunktionaler Interaktionsmuster.
Hinzu tritt die Orientierung an wissenschaftlich bestätigten psychischen Ressourcen und die
Möglichkeit mit den Methoden der psychotherapeutischen Ergebnis- und Prozessforschung das Coaching zu evaluieren." (Holm-Hadulla, 2002, S. 244) Demnach ist es sinnvoll, die wissen- schaftlichen Erkenntnisse aus der Psychotherapie auch für Coaching zu nutzen, gerade auch weil es für Coaching selbst noch nicht genügend Empirie nachzuweisen gibt. Allerdings sollte es nicht dabei bleiben, sondern die Ergebnisse der Psychotherapieforschung, die man auf Coa- ching überträgt, sollten für die Coachingpraxis ebenfalls empirisch überprüft werden. Dazu soll diese Arbeit ihren Beitrag leisten.
[...]
- Arbeit zitieren
- Stefanie Dzierzon (Autor:in), 2004, Personzentriertes Beziehungsverhalten beim Coaching, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36564
Kostenlos Autor werden





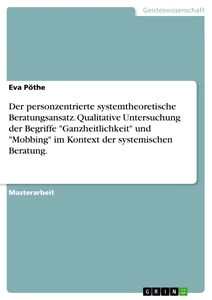
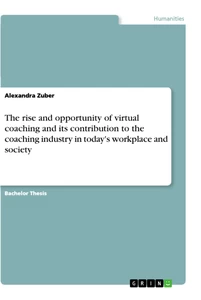



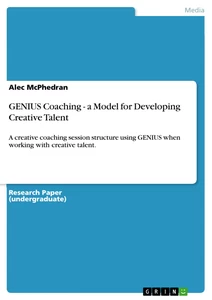

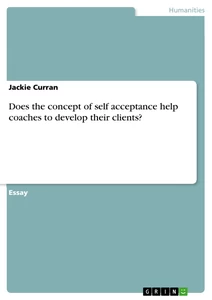

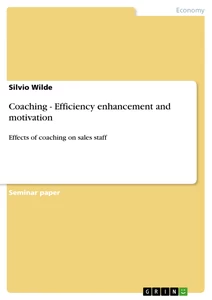
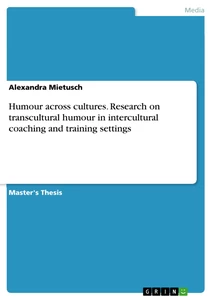

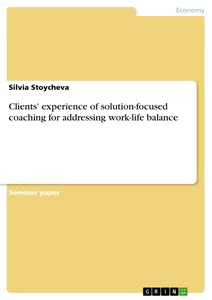
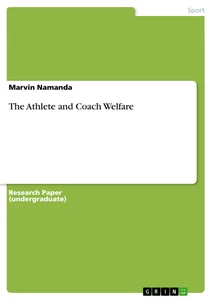



Kommentare