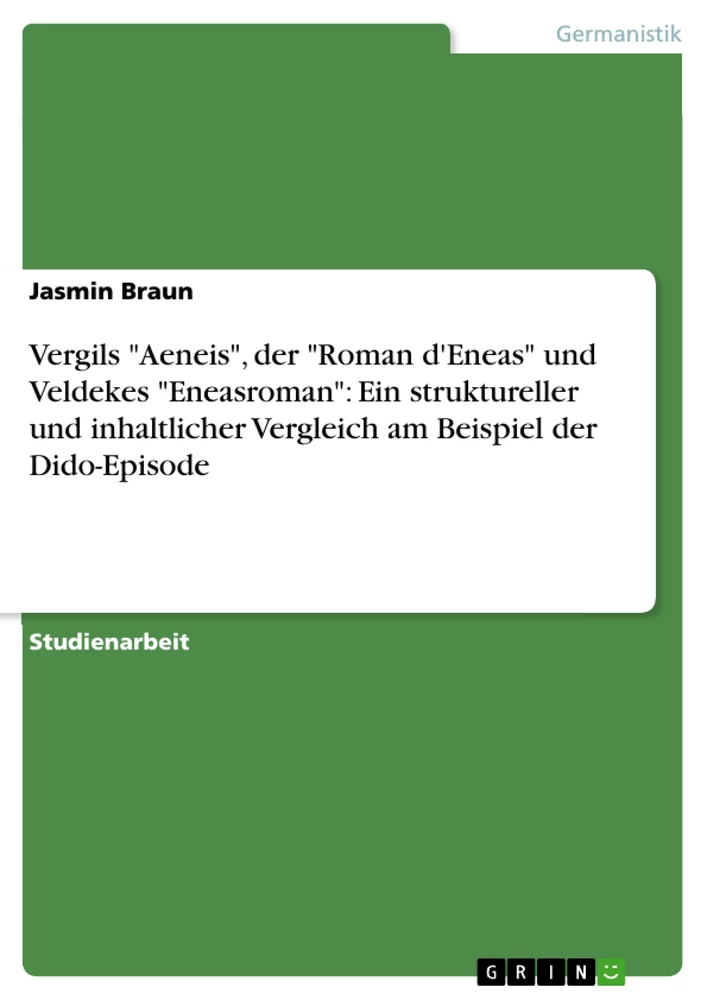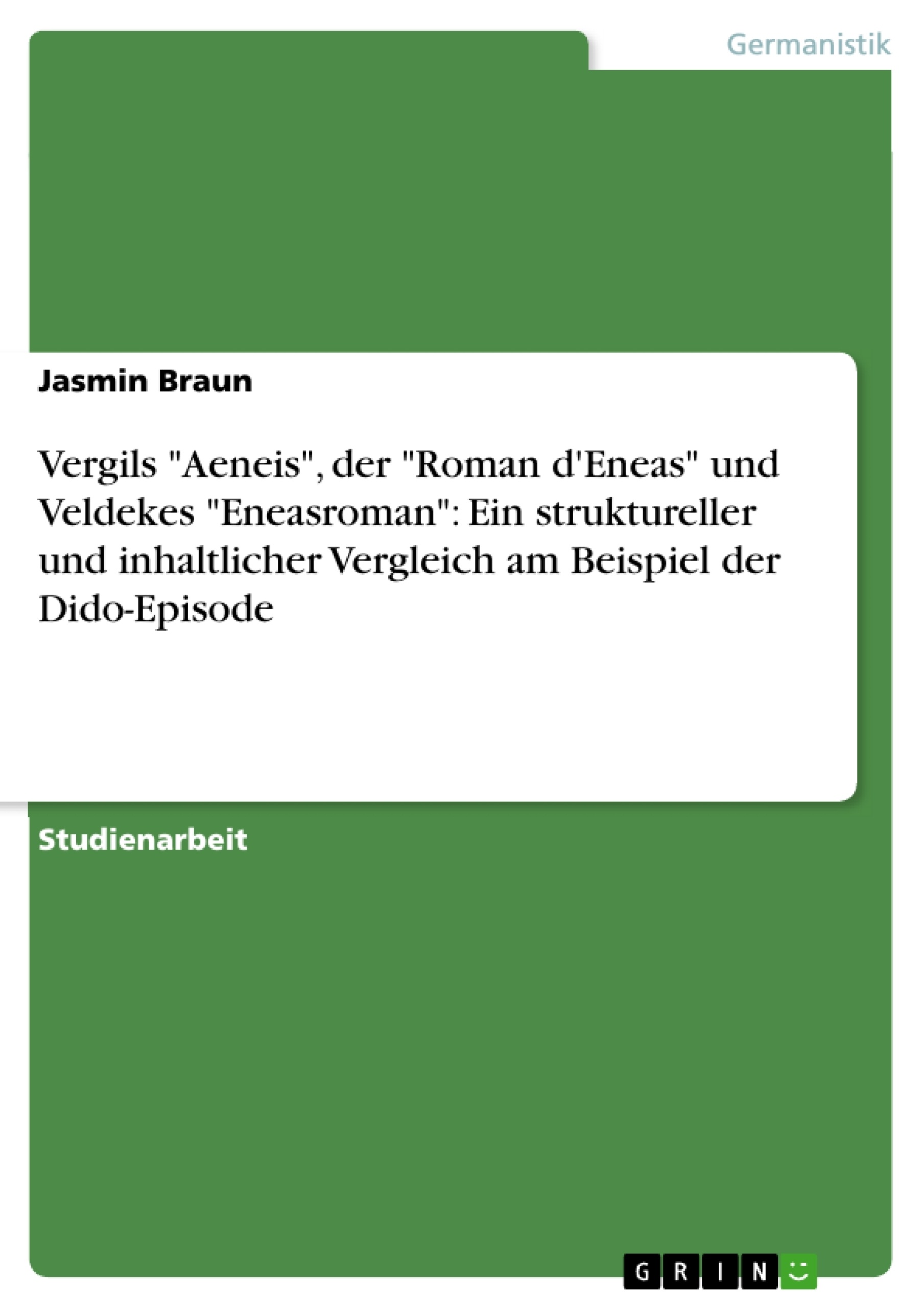Der epische Dichter Vergil sorgte mit seinem römischen Nationalepos, das zwischen 29 und 19 v. Chr. entstand und dem er den Namen ‚Aeneis‘ gab, dafür, dass im Verlauf der deutschen Geistesgeschichte stets „der Bezug auf Roms Recht und Rede; auf Roms Reich und Regiment allenthalben mit Händen zu greifen“ war. Das Werk erzählt in einer inhaltlichen Zweiteilung die Geschichte des Helden Aeneas; im ersten Teil (Buch 1-6) von dessen Irrfahrten, dem verhängnisvollen Aufenthalt in Karthago und vom Aufbruch nach Latium, im zweiten Teil (Buch 7-12) von der dortigen Kriegführung und dem folgenden Landgewinn. Es ist erkennbar, dass Vergil sich in der Erzählkonzeption bei Homers Werk der ‚Odyssee‘ bedient um die politische Größe Roms zu seiner Zeit unter Kaiser Augustus in eine mythische Geschichtstradition einzubetten. Im Protagonisten Aeneas erfüllt sich durch alle Schwierigkeiten hindurch der vorbestimmte Götterwille der Gründung Roms, er selbst gerät zum idealen Paradigma eines Römers.
Im Mittelalter nun gilt Vergil bei solchen, die in den Genuss einer klerikalen Schulausbildung kommen, als absoluter Pflichtautor. Die Gründe dafür liegen allerdings weniger bei der vermittelten nationalrömischen Idee, sondern mehr bei der verwendeten epischen Dichtungsform. Zum einen fasziniert die mittelalterlichen Rezipienten die verhüllende Darstellungsform des Werkes, die allegorisch gedeutet wird und somit den Weg des Helden als philosophischen Weg durch die verschiedenen Lebensalter bis zur Weisheit versteht. Zum anderen setzt Vergils Dichtkunst qualitative Maßstäbe. Ein Beispiel hierfür ist der Beginn des Werkes: „Die ‚Aeneis‘ springt, antiker epischer Konvention folgend,medias in res;sie beginnt mit dem Seesturm, der Aeneas an Karthagos Küste verschlägt; die Vorgeschichte wird vor allem in Aeneas‘ Erzählungen bei Dido nachgeholt (ordoartificialis).“ Durch die mittelalterliche Rezeption und Bearbeitung der ‚Aeneis‘ erfährt das Werk strukturelle und inhaltliche Veränderungen, am stärksten und offensichtlichsten ist das erstmals 1160 der Fall, als ein unbekannter Kleriker am anglonormannischen Hofe Heinrichs II. Plantagenet und Eleonores von Poitou seinen altfranzösischen ‚Roman d’Eneas‘ vollendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Didos minne
- 2.1 Die erste Begegnung
- 2.2 Die Entstehung der minne und die Rolle der Götter
- 2.3 Dido als Herrscherin und der Begriff der êre
- 2.4 Didos Selbstmord
- 3. Die moralische Bewertung der Dido-Episode
- 4. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen strukturellen und inhaltlichen Vergleich der Dido-Episode in Vergils Aeneis, dem Roman d'Eneas und Veldekes Eneasroman durchzuführen. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Darstellung Didos und der Minne-Thematik in den mittelalterlichen Adaptionen im Kontext der damaligen gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen.
- Vergleich der Darstellung Didos in den drei Werken
- Entwicklung der Minne-Thematik von der Antike zum Mittelalter
- Der Einfluss der mittelalterlichen Weltanschauung auf die Interpretation des antiken Stoffes
- Strukturelle Unterschiede in der Erzählweise
- Die Rolle der Götter und ihre Veränderung in den Adaptionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die drei zu vergleichenden Werke – Vergils Aeneis, den Roman d'Eneas und Veldekes Eneasroman – vor und erläutert deren Entstehungszusammenhänge. Sie hebt die Bedeutung Vergils als Pflichtautor im Mittelalter hervor und beschreibt die Unterschiede in der Erzählkonzeption und der Interpretation der Aeneis in der Antike und im Mittelalter. Der Fokus liegt auf der strukturellen und inhaltlichen Veränderung des antiken Epos durch die mittelalterlichen Bearbeitungen, insbesondere die Verschiebung der Akzente und die Anpassung an den damaligen Verständnis Horizont. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Dido-Episode als zentralen Gegenstand der Analyse an.
2. Didos minne: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Didos Liebe in den drei Werken. Es untersucht die erste Begegnung zwischen Dido und Aeneas, die Entstehung ihrer Liebe unter dem Einfluss der Götter, Didos Rolle als Herrscherin und der Begriff der Ehre im Kontext ihrer Beziehung, sowie schließlich ihren Selbstmord. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Perspektiven auf die Liebeshandlung und deren Interpretation im Wandel der Zeit aufzeigen.
3. Die moralische Bewertung der Dido-Episode: Dieses Kapitel befasst sich mit der moralischen Bewertung der Dido-Episode in den drei Werken. Es wird untersucht, wie Didos Handlungen und ihr Schicksal moralisch beurteilt werden und wie sich diese Beurteilung im Laufe der Zeit verändert. Der Vergleich beleuchtet die unterschiedlichen ethischen Maßstäbe der antiken und mittelalterlichen Weltanschauung und deren Auswirkungen auf die Interpretation der Dido-Figur.
Schlüsselwörter
Vergil, Aeneis, Roman d'Eneas, Veldekes Eneasroman, Dido-Episode, Minne, mittelalterliche Rezeption, antike Literatur, Vergleichende Literaturwissenschaft, höfische Literatur, Ehre, Götter, moralische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen zum Vergleich der Dido-Episode in Vergils Aeneis, dem Roman d'Eneas und Veldekes Eneasroman
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Darstellung der Dido-Episode in Vergils Aeneis, dem Roman d'Eneas und Veldekes Eneasroman. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Darstellung Didos und der Minne-Thematik in den mittelalterlichen Adaptionen im Kontext der damaligen gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen.
Welche Aspekte werden im Vergleich berücksichtigt?
Der Vergleich umfasst die Darstellung Didos in den drei Werken, die Entwicklung der Minne-Thematik von der Antike zum Mittelalter, den Einfluss der mittelalterlichen Weltanschauung auf die Interpretation des antiken Stoffes, strukturelle Unterschiede in der Erzählweise und die Veränderung der Rolle der Götter in den Adaptionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Didos Minne, ein Kapitel zur moralischen Bewertung der Dido-Episode und abschließende Schlussfolgerungen. Die Einleitung stellt die drei Werke vor und erläutert deren Entstehungszusammenhänge. Das Kapitel über Didos Minne untersucht die erste Begegnung zwischen Dido und Aeneas, die Entstehung ihrer Liebe, Didos Rolle als Herrscherin und ihren Selbstmord. Das Kapitel zur moralischen Bewertung untersucht, wie Didos Handlungen und ihr Schicksal moralisch beurteilt werden und wie sich diese Beurteilung im Laufe der Zeit verändert.
Welche Werke werden verglichen?
Verglichen werden Vergils Aeneis, der Roman d'Eneas und Veldekes Eneasroman.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Darstellung Didos, die Minne-Thematik, der Einfluss der mittelalterlichen Weltanschauung, die strukturellen Unterschiede der Erzählweise, die Rolle der Götter und die moralische Bewertung der Dido-Episode.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vergil, Aeneis, Roman d'Eneas, Veldekes Eneasroman, Dido-Episode, Minne, mittelalterliche Rezeption, antike Literatur, Vergleichende Literaturwissenschaft, höfische Literatur, Ehre, Götter, moralische Bewertung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf einen strukturellen und inhaltlichen Vergleich der Dido-Episode in den drei Werken ab, um die Veränderungen in der Darstellung Didos und der Minne-Thematik in den mittelalterlichen Adaptionen aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Jasmin Braun (Autor:in), 2006, Vergils "Aeneis", der "Roman d'Eneas" und Veldekes "Eneasroman": Ein struktureller und inhaltlicher Vergleich am Beispiel der Dido-Episode, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65361