Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Grundlegung: Zur Stellung, Motivation, Fragestellung und methodischen Vorgehensweise
2 Die zentralen Begriffe Autonomie und Selbstwert
2.1 Autonomie
2.1.1 Etymologie: Herkunft und Bedeutung des Begriffs der Autonomie
2.1.2 Philosophische und Anthropologische Bedingungen der Autonomie
2.1.3 Soziologische Theorien
2.1.4 Der Autonomiebegriff bei Sallinger
2.1.5 Zur Fokussierung der Autonomie auf unterschiedlichen Ebenen
2.1.6 Synthese: Modell der Autonomie auf verschiedenen Organisationsstufen
2.2 Selbstwert
2.2.1 Selbstwertbegriffe
2.2.1.1 Vielfalt der Selbstbegriffe
2.2.1.2 Selbstwertgefühl
2.2.1.3 Selbsttheorie
2.2.1.4 Selbstkonzept
2.2.1.4.1 Menschen als Konstrukteure ihres Wissens
2.2.1.4.2 Quellen selbstbezogenen Wissens
2.2.1.4.3 Prinzipien der Verarbeitung selbstbezogenen Wissens
2.2.1.4.4 Naive Handlungstheorie
2.2.1.5 Therapeutischer Ansatz des Selbstwerts
2.2.2 Synthese: Selbstwert als kognitiv-emotionales Schema mit praktischer Anwendbarkeit
3 Selbstwert im Kontext von Arbeit und Beruf
3.1 Der Stellenwert von Arbeit und Beruf für die Person
3.2 Der Selbstwert in seiner beruflichen Dimension: Die Ansätze von Super und Korman
3.3 Vergleich der Ansätze von Super und Korman
3.4 Die Bedeutung des Selbstwertkonzepts für die betriebliche Weiterbildung
4 Vorstellungen, Ansätze, Theorien zum Erwerb von Selbstwert und Autonomie
4.1 Identitätstheoretischer Ansatz
4.1.1 Die Bedeutung von Selbstwert und Autonomie im Rahmen des identitätstheoretischen Ansatzes
4.1.1.1 Autonomie im identitätstheoretischen Ansatz
4.1.1.2 Selbstwert im identitätstheoretischen Ansatz
4.1.2 Möglichkeiten des Erwerbs von Selbstwert und Autonomie
4.1.3 Grenzen und Kritik der Möglichkeiten von Selbstwert und Autonomie im identitätstheoretischen Ansatz
4.1.3.1 Kritik des identitätstheoretischen Ansatzes
4.1.3.2 Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedingungen als Grenzen des lebensweltorientierten, identitätstheoretischen Ansatzes
4.1.3.3 Grenzen der Autonomie im identitätstheoretischen Ansatz
4.1.3.4 Kritik des Selbstwerts im identitätstheoretischen Ansatz
4.1.4 Konsequenzen der identitätstheoretischen Sichtweise für eine betriebliche Weiterbildung
4.2 Technologischer Ansatz
4.2.1 Schlüsselqualifikationen
4.2.1.1 Historische Entwicklung des Begriffs
4.2.1.2 Kritik am Konzept der Schlüsselqualifikationen
4.2.2 Betriebswirtschaftlich - unternehmerische Aspekte: Personalentwicklung in der Unternehmenskultur
4.2.2.1 Unterschiedliche Vorstellungen von der Unternehmenskultur
4.2.2.2 Personalentwicklung und betriebliche Weiterbildung in der Unternehmenskultur
4.2.2.3 Betriebliche Subkulturen als Ausdruck der Mitgestaltungsmöglichkeiten innerhalb von Unternehmen
4.2.3 Selbstwert und Autonomie im Rahmen von technologischen und Personalentwicklungsansätzen
4.2.3.1 Personalentwicklung nach humanistischen, subjektorientierten Ansätzen
4.2.3.2 Berufliche Autonomie als ein dialektisch-geschichtlicher Entwicklungsprozeß von Menschen und Organisationen
4.2.3.3 Selbstreflexion in der Personalentwicklung
4.2.3.4 Thematisierung der Macht in Unternehmen
4.2.3.5 Zur Mitwirkungsfähigkeit der Mitarbeiter
4.2.3.6 Selbstmanagement als Maßnahme subjektorientierter Personalentwicklung
4.2.3.7 Intrapreneurship
4.2.4 Grenzen und Kritik der Möglichkeiten von Selbstwert und Autonomie im technologischen Ansatz
4.3 Zusammenfassender Vergleich der Ansätze
5 Abschließende Betrachtung: Selbstwert und Autonomie im gesellschaftlichen Fokus
1 Grundlegung: Zur Stellung, Motivation, Fragestellung und methodischen Vorgehensweise
Die ursprüngliche Thematik, die mich beschäftigt hat, war die Frage, ob es möglich ist die personalen Bedingungen und Anforderungen, die Persönlichkeitsmerkmale und Qualifikationen, die zur Selbständigkeit von Nöten sind, über Bildungsprozesse zu erlangen. Dabei spielt vor allem die gegenwärtige Problematik einer sehr großen Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle. Selbständigkeit ist in diesem Zusammenhang sowohl anthropologisch, als auch wirtschaftlich zu verstehen. Es geht um die Selbständigkeit der Person, wie auch um die „unternehmerische Selbständigkeit“ und insbesondere darum, wie sich diese beiden Dimensionen wechselseitig beeinflussen. Die Fragestellung war also zunächst: Ist es möglich Persönlichkeitsattribute zu erwerben, im Rahmen einer Bildungsveranstaltung oder eines Bildungsprogramms, welche zu einem Unternehmertum qualifizieren und ermutigen, um somit einen Weg aus hoher Arbeitslosigkeit, hinein in eine sinnvolle und realistische Selbständigkeit zu ermöglichen.
Bei der weiteren Ausformulierung des Themas war nun die Frage, welche Persönlichkeitsattribute, welche personalen Bedingungen die Fähigkeit zur Selbständigkeit im doppelten Sinne wohl am besten würden greifen können. Autonomie und Selbstwert erschienen mir als die beiden Begriffe, Konstrukte, Ansätze, die meinen Vorstellungen am ehesten entgegenkamen, denn sie umfassen ein Menschenbild, das den einzelnen als Ausgangspunkt, als selbstursprüngliche Kraft für eine verändernde, gestaltende Handlung ansehen.
Um die Bildungsprozesse und -programme, die den Erwerb von Selbswert und Autonomie gewährleisten könnten, griffiger beschreiben und untersuchen zu können, war es geboten mich auf aktuelle Vorstellungen von Erwachsenenbildung zu beziehen. Um der doppelten Sinnhaftigkeit der Selbständigkeit gerecht zu werden, erschienen mir deshalb der identitätstheoretische und der technologische Ansatz der Erwachsenenbildung (vgl.Siebert 1993,S.36ff) besonders geeignet. Bei ersterem bezieht sich das andragogische Bemühen auf die Person in ihrer biographischen, lebensweltlichen Entwicklung, mithin auf die personbezogene Dimension der Selbständigkeit. Bei zweiterem steht der betriebswirtschaftliche, unternehmerische Gesichtspunkt der Selbständigkeit im Vordergrund, ein klares Verwertungsinteresse und Kosten-Nutzen-Denken bestimmt das andragogische Vorgehen, berufliche Utilitarität und Schlüsselqualifikationen lauten die zugehörigen Schlagworte. Deswegen erscheint eine Untersuchung beider Ansätze, insbesondere im Vergleich der Bedeutung von Selbstwert und Autonomie darin, als gewinnbringend für die Fragestellung der Selbständigkeit. Da sich die ursprüngliche Intention der Arbeit auch auf die Selbständigkeit und Selbsttätigkeit imwirtschaftlichenSinne bezieht, wurde hier der eingegrenztere Kontext der Weiterbildung gewählt. So ergab sich das Thema: Erwerb von Selbstwert und Autonomie aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven im Kontext der betrieblichen Weiterbildung.
Die Thematik der Hineinführung in ein Unternehmertum wird demnach nur allgemein gestreift. Die Arbeit mag jedoch als spätere Grundlage für weiterführende andragogische Maßnahmen dienen, welche zu einer Selbständigkeit im doppelten Sinne anleiten.
Die Fragestellung nach Grenzen und Möglichkeiten des Erwerbs von Selbstwert und Autonomie im betrieblichen Kontext beruht auch auf dem Hintergrund der Forderung des Deutschen Bildungsrates 1970 (vgl.Siebert 1985,S.12), daß Identitäts- und Qualifikationslernen sich in der Erwachsenenbildung in der Waage halten sollen. Mit dieser Forderung sollte die historische Dialektik zwischen nutzenorientierter Qualifizierung, als Aneignung von verwertbarem Fachwissen und andererseits Bildung, als tiefer Ausdruck der Subjektivität, Individualität und Kultur des Individuums, endlich zu einer Synthese geführt werden. Es ging um die Überwindung des Widerstreits von Qualifikationslernen und Identitätslernen, um die Überwindung des Widerspruchs der Prinzipien von Humanität und Utilitarität in der Erwachsenenbildung.
Die Untersuchung von Selbstwert und Autonomie, auf dem Hintergrund betrieblicher Weiterbildung, stellt auch den Versuch dar, aufzuhellen inwieweit dieser Forderung inzwischen Rechnung getragen wird, inwieweit Bildung und Qualifizierung sich nicht wechselseitig ausschließen, sondern tatsächlich ineinander integrierbar sind, sich ergänzen und bereichern können. Autonomie und Selbstwert sind dabei die angelegten Maßstäbe und Medien des Vergleichs.
Mit dem Terminus „betriebliche Weiterbildung“ ist jener Teilbereich der Erwachsenenbildung gemeint, der sich auf die Zeit nach der (beruflichen, schulischen, universitären) (Aus-)Bildung bezieht und der in einem engen Zusammenhang zu der Institution oder Organisation steht, in der die jeweiligen Teilnehmer*der Maßnahme bzw. Veranstaltung arbeiten bzw. ihren Lebensunterhalt verdienen. Die betriebliche Weiterbildung mag dabei als der Spezialfall der beruflichen Weiterbildung gelten, denn zweitere kann auch ohne Bezugnahme auf einen konkreten Betrieb oder Organisation, beispielsweise von Berufsbildungswerken o.ä. durchgeführt werden. Im Gegensatz zur Fortbildung schließt die Weiterbildung nicht an vorhandenes Wissen oder Können im fachlichen, funktionalistischen Sinn an, sondern es geht vielmehr um den Erwerb und die Thematisierung neuer Inhalte und Stoffe.
Der anzulegende Bedeutungsgehalt von Selbstwert und Autonomie wird im zweiten Kapitel vorgestellt, ihr Verhältnis zu Arbeit und Beruf im dritten Kapitel dargestellt.
Das vierte Kapitel bemüht sich sodann um eine ausführliche Darstellung und Untersuchung von Selbstwert und Autonomie innerhalb der beiden erwähnten andragogischen Ansätze. Dabei werden Möglichkeiten und Grenzen untersucht, um auf dieser Grundlage eine vergleichende Zusammenschau und Kritik zu ermöglichen. Der Kontext der betrieblichen Weiterbildung wird dabei immer wieder aktualisiert und betrachtet. Er bildet den Hintergrund, die Folie auf der die Betrachtungen und Untersuchungen stattfinden.
Es handelt sich bei dieser Arbeit, was die Methode anbelangt, um ein klassisch hermeneutisches Vorgehen. Auf der Grundlage der vorgestellten Fragestellung und Motivation soll der Gehalt, die Bedeutung von Selbstwert und Autonomie erfaßt und verstanden werden, und zwar in Auseinandersetzung mit andragogischen Ansätzen und Theorien, im speziellen auf dem Hintergrund der betrieblichen Weiterbildung. Genauer gesagt bemühe ich mich um ein hermeneutisches Vorgehen im Sinne Gadamers (vgl.Danner 1994,S.31ff). Das bedeutet, es wird die heutige Situation, die momentane Fragestellung des Interpreten eines hermeneutischen Gegenstands akzeptiert. Der Versuch den Autor eines Textes kongenial zu verstehen und nachzuerleben unterbleibt. Es wird vielmehr, auf dem Hintergrund der oben dargestellten Motivation und Fragestellung, versucht die aktuelle Praxis aus Sicht aktueller Theorien zu verstehen, um somit in einer hermeneutischen Zirkelbewegung die Theorie zu erweitern und neue Perspektiven für die Praxis zu ermöglichen (vgl.ebd.,S.110ff).
Ich habe mich dabei um einen möglichst breiten, interdisziplinären Zugang zu dem Thema bemüht, so daß auch Texte aus der Kulturforschung, der Betriebswirtschaftslehre, der Kognitionspsychologie oder den Sozialwissenschaften Eingang gefunden haben.
2 Die zentralen Begriffe Autonomie und Selbstwert
2.1 Autonomie
Der Begriff der Autonomie umfaßt in unserem Sprachgebrauch vielfältigste Dimensionen. Beinahe alle wissenschaftlichen Fakultäten nehmen ihn für sich in Anspruch. So gibt es juristische, politische, ökonomische, staatliche, religiöse... Autonomie, sowie die Autonomie der Lebewesen (vgl.Portele 1989,S.19ff) oder die Autonomie der Pädagogik als eigenständiger Wissenschaft (Schiess 1973).“Jeder Mensch und jegliche menschliche Gemeinschaft streben einerseits nach Autonomie, das heißt nach dem Erlangen von Freiheit und Selbständigkeit, die es ihnen ermöglichen, selbst die Gesetze zu bestimmen, nach denen sie funktionieren. Andererseits stehen Individuen wie Gruppen ständig auch in Gefahr, sich ihrer Autonomie zu begeben, um sich vor der - sie ängstigenden - Verantwortungsübernahme bewußt oder unbewußt zu drücken. Der homo sapiens hat sich daher zeit seines Lebens mit dem Problem von Selbstfindung und Mündigkeit auseinandergesetzt“ (Battegay & Rauchfleisch 1990,S.7) Selbst in Kontext von Erwachsenenbildung sind zahlreiche Perspektiven des Autonomiebegriffs von Bedeutung: Philosophie, Anthropologie, Psychologie, soziologische Theorien, geisteswissenschaftlich-kulturphilosophische, konstruktivistische und kritisch pädagogische Ansätze und Theorien leisten dazu einen Beitrag. Daneben gibt es verwandte Begriffe und Theorien, wie etwa die des „Selbst“, des „Ich“ und der „Identität“, die sich teilweise überschneiden, oder ähnliches wie die menschliche Autonomie meinen. Deswegen erscheint mir eine Definition des hier verwandten Autonomiebegriffs von Nöten. Die genannten Dimensionen des andragogischen Autonomiebegriffs werde ich im folgenden skizzieren, um sodann mein Verständnis von menschlicher Autonomie für die daran anknüpfenden Überlegungen festzulegen.
2.1.1 Etymologie: Herkunft und Bedeutung des Begriffs der Autonomie
Das Wort Autonomie stammt aus dem Griechischen: <<autos>> heißt „selbst“, <<nomos>> bedeutet „Gesetz“. „Selbstgesetz“ also, oder „Selbstgesetzlichkeit“. Doch wer darf, und wer kann sich selbst Gesetze geben? Der Mensch, ein Volk, ein Staat, eine Gebietskörperschaft - mehrere Alternativen sind denkbar und werden sowohl fachlich, als auch umgangssprachlich so verwandt. Laut Duden ist Autonomie das „Recht auf Unabhängigkeit und Selbstgesetzlichkeit...“,autonom bedeutet demnach „nach eigenen Gesetzen lebend, selbständig, unabhängig“ (Der große Duden - Herkunftswörterbuch 1963,S.43), und weiter...“im Gegensatz zur Heteronomie (die) Fähigkeit, die Gesetze des sittlichen Handelns selbst zu bestimmen“ (Der große Duden - Fremdwörterbuch 1966,S.81).
Der Begriff der Autonomie entstand in der griechischen Antike und bezeichnet „´das Recht sich selbst Gesetze zu geben`, allgemeiner: ´das Recht, nach eigenem Gesetz zu leben`. So hat ihnCiceroverstanden, wenn er über die griechischen Städte seiner Provinz...schreibt: ´Alle haben ihre eigenen Gerichte und leben nach ihren eigenen Gesetzen. Im Besitz der Autonomie sind sie wieder aufgelebt`“(v.Ungern-Sternberg 1990,S.9). Im antiken Griechenland war damit in erster Linie die Unabhängigkeit und das Verlangen nach Selbständigkeit der Bundesgenossen Athens gemeint. Autonomie war also zunächst ein juristischer und politischer Begriff. Es ging um eigene Gerichtsbarkeit, die Selbstbestimmung eigener Gesetze, eine eigene Rechtsordnung und Verwaltung und um „schlechthin die Fähigkeit, die eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln“ (ebd.,S.14), vergleichbar mit dem heutigen Prinzip der „Gemeindeautonomie“.
„Ein einziges Mal in der klassischen Epoche Griechenlands wird Autonomie einer einzelnen Person zugeschrieben. Merkwürdigerweise ist es zugleich der älteste erhaltene Beleg überhaupt (442v.Chr.). Die Antigone desSophokleshat sich mit der symbolischen Bestattung ihres Bruders Polyneikes gegen den ausdrücklichen Befehl des gegenwärtigen Herrschers in Theben, Kreon, entschieden und für das ungeschriebene Gebot, die Toten zu begraben“(v.Ungern-Steinberg 1990,S.16). Antigone stirbt letztendlich durch die Todesstrafe, gemäß dem gültigen Gesetz, was ihr von Anfang an bewußt ist...“und das muß hier die Bedeutung von ´autònomos` sein:in Konsequenz des eigenen, selbstgewählten Handelns“ (ebd.,S.16f). „Eine gewisse Ironie der Geschichte liegt dann aber darin, daßSophoklesgerade wegen des Erfolgs der ´Antigone` zum Strategen gewählt worden sein soll, und als solcher leitend am Feldzug der Athener gegen Samos beteiligt war, der die Autonomie der Insel beseitigte“ (ebd.1990,S.18).
Das auf die Persönlichkeit des einzelnen Menschen bezogene Verständnis von Autonomie entwickelt sich also erst langsam im Laufe der Geschichte. In Griechenland liegt „allein außerhalb der Polis...demnach der Bereich möglicher Autonomie des Einzelnen“ (ebd.1990,S.19). Die Vorstellung des Menschen, der sich sein ´eigenes Gesetz` gibt, erwächst aus diesen Grundlagen. Die Stoiker etwa erkannten, daß der Mensch „ein vernunftbegabtes Lebewesen“ sei, welches „bestrebt sei, diese seine Vernunftsnatur zu entfalten und auszubilden. Damit wurde der Mensch nicht notwendig zum ´Einzelkämpfer`, er blieb für die Stoa ein auf die Gemeinschaft angewiesenes, Gemeinschaft - nicht aber mehr: die Polis - bildendes Wesen. Indes sein Gesetz fand er nunmehr in seiner eigenen Natur, im ´Logòs` (Vernunft). Wenn er diesem entsprechend handelte, handelte er sittlich.Zenonhat dafür die berühmte Formel geprägt, Ziel des Menschen sei das ´in sich stimmige Leben`...“(ebd.,S.21).
Ende des 16. Jahrhunderts tritt dann die latinische Form der „Autonomia“ auf (vgl.Der große Duden - Herkunftswörterbuch 1963,S.43). Im folgenden Abschnitt werde ich auf anthropologische und philosophische Dimensionen des Autonomie- und Freiheitsbegriffs, für die die Zeit der Aufklärung einen wesentlichen Ausgangspunkt darstellt, eingehen.
2.1.2 Philosophische und Anthropologische Bedingungen der Autonomie
Inwieweit ist der Mensch fähig selbständig, autonom zu sein? Welche anthropologischen Mindestbedingungen müssen gegeben sein um von der individuell zu füllenden Freiheit sprechen zu können? Mit diesen Fragen beschäftigte sich im weiteren Sinn auch die pädagogische Anthropologie, indem sie die Lernfähigkeit und Erziehbarkeit der Menschen untersucht. Als wesentlichste Erkenntnisse dieser Überlegungen lassen sich die folgenden menschlichen Besonderheiten hervorheben:
A. Portmann (1956) bezeichnet den Menschen als eine „normalisierte Frühgeburt“. Wenn der Mensch als Säugling zur Welt kommt, so ist er alleine nicht lebensfähig (vgl.Spitz & Wolf 1946, S.313ff), sondern er bedarf neben Pflege und Fürsorge auch einer sicheren Bindung zu einer Bezugsperson (vgl.Ainsworth et al. 1974,S.99ff). Diese hier nur kurz angedeuteten Ergebnisse der Hospitalismusforschung, sowie der Bindungstheorie deuten darauf hin, daß es einen Spielraum gibt, innerhalb dessen sich der Mensch zunächst entwickeln und später dann auch selbst entscheiden kann.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die sogenannte „Weltoffenheit“ des Menschen. M. Scheler (1962) sieht darin die räumliche und gedankliche Ungebundenheit der Menschen. Im Gegensatz zu Tieren sind die Menschen nicht an eine bestimmte Umwelt gebunden, sondern vielmehr in der Lage, in allen Vegetations- und Klimazonen zu siedeln und zu überleben. Darüber hinaus vermag der Mensch “...seine natürlichen Sinnesgrenzen, mit Hilfe selbstgeschaffener technischer Hilfsmittel zu überwinden, um im Mikro- und Makrobereich immer neue Welten zu entdecken. Sein Erlebnishorizont ist auch nicht auf das hier und jetzt mit den Sinnen Wahrnehmbare eingeengt. Der Mensch vermag sich vorstellend und denkend in räumlich ferne Zonen zu versetzen und sich Sachverhalte aus der Vergangenheit und Zukunft zu vergegenwärtigen“ (Weber 1982,S.14).
Darüber hinaus besitzen die Menschen die Fähigkeit zur „exzentrischen Positionalität“ (Plessner 1965,S.288ff). Das bedeutet die Fähigkeit sich gedanklich neben sich selbst zu stellen, bzw. sich selbst in seinem Verhalten und Denken gleichsam in einem Spiegel zu betrachten. Diese Grundlage für Reflexion und Selbstreflexion ermöglicht es verschiedenste Positionen zu sich selbst und gegenüber anderen einzunehmen und zu durchdenken. Dies beinhaltet die Möglichkeit sich von sich selbst zu distanzieren. Hier zeichnet sich bereits ein zumindest mentaler Freiraum ab, der die Grundlage für eine eigenständige und autonome Wahrnehmung seiner selbst und auch seiner Umwelt ist.
Eine weiterer Gedanke ist die Sichtweise des Menschen, als ein unspezialisiertes, biologisches „Mängelwesen“ (vgl.Gehlen 1962). Diese biologische Betrachtungsweise erkennt, daß dem Menschen eine natürliche Spezialisierung seines Körpers, wie sie etwa für die Jagd nötig wäre, fehlt. Das bedeutet, daß der Mensch in Ermangelung einer angeborenen Überlebens- oder Jagdfähigkeit dazu gezwungen ist, seine biologischen „Mängel“ durch Organisation auszugleichen. Auf Grund dieses Defizits muß Kreativität und Organisationstalent das Überleben sichern. „Wenn der Mensch auch in vielen Einzelleistungen seiner Sinnes- und Bewegungsorgane von spezialisierten Tieren übertroffen wird, ist er ihnen infolge seiner Vielseitigkeit und Plastizität insgesamt betrachtet überlegen (...) Die intellektuelle Leistungsfähigkeit ermöglicht es dem Menschen, seine biologischen Mängel auszugleichen.(...) Nach A. Gehlen läßt sich die humane Sonderstellung zusammenfassend auf die Formel bringen, daß derMenschinfolge seiner biologischenMängel von Natur aus ein Kulturwesenist“ (Weber 1982,S.16f). Die im Laufe der Menschheitsgeschichte erschaffenen Kultur ist somit logisches Ergebnis der biologischen Unspezialisiertheit. Auch in dieser Hinsicht wird deutlich, daß es einen Freiraum gibt, der mit Kultur gefüllt werden kann, wobei in diesem Kontext Kultur sehr allgemein, als bearbeitete Natur verstanden werden soll.
In diesem Zusammenhang sei „das Philosophische Problem der Freiheit“ kurz erörtert.
Wie frei ist der Mensch? Hat er tatsächlich einen autonom zu gestaltenden Spielraum? Ist er nicht vielmehr durch Erb- und Umweltfaktoren determiniert?
E. Weber, der sich mit diesem Problem der Freiheit befaßt, konstatiert: „Nur gering von den Erbanlagen beeinflußt und sehr stark durch Umwelt- Erziehungswirkungen veränderbar sind zum Beispiel psychische und soziokulturelle Bedürfnisse und Interessen... Motivationen, Werteinstellungen, Gesinnungen und Haltungen, Gewissensausprägungen, Lebens- und Weltanschauungen sowie politische und religiöse Überzeugungen“ (ebd.,S.32). Was nun die Freiheit selbst anbelangt, sieht Weber einen Mittelweg zwischen Determinismus und Unbestimmtheit. Einerseits ist der Mensch festgelegt durch Erbanlagen und Umwelteinflüsse, die sich auch in persönlichen Entscheidungen und „als frei erlebten ideellen Entwürfen“ (ebd.,S.33) manifestieren, andererseits scheint auch die Freiheit menschlichen Denkens und Handelns Realität zu sein. „Wenn der Mensch nicht die kreative Möglichkeit besitzen würde, selbstursprünglich den Anfang einer neuen Kausalreihe zu setzen, wären alle produktiven soziokulturellen Veränderungen, die sich nicht alleine auf den Zufall zurückführen lassen, unerklärlich. Wenn der Mensch nicht die Freiheit besäße, aus eigener, nicht erzwungener Entscheidung zu handeln, überzeugt davon, daß er sich auch hätte anders verhalten können, würden Phänomene wie Verantwortung und Gewissen, Reue und Schuld, Achtung und Verachtung jeglichen Sinn verlieren.(...) Freiheit kann dabei als Wählenkönnen zwischen verschiedenen vorgegebenen Möglichkeiten begriffen werden. Freiheit läßt sich aber auch als produktive Möglichkeit verstehen, über die gegebenen Verhältnisse hinauszugehen. Dies geschieht dadurch, daß man in kreativer Weise z.B. Vorstellungen von einem besseren als dem realen Leben entwirft und diese gedanklich vorweggenommenen Ideen zu Richtmaßen und Impulsen für die Veränderung der Wirklichkeit werden läßt, die durch Lernvorgänge sowie durch soziale und politische Prozesse erst hervorzubringen ist“ (ebd.,S.33). Eine so verstandene Freiheit ist die Grundlage und der Hintergrund für den Erwerb von Autonomie im Kontext jeglicher Aus- und Weiterbildung. Die Idee, wie das Leben besser sein könnte, und der Mut kreative Veränderungs- und Lernprozesse politisch, sozial und individuell handelnd zu realisieren, sind die Dimensionen der Autonomie, die ich hier meine. Es geht darum Mißstände, Unzulänglichkeiten der sozialen Umwelt, also beispielsweise auch im eigenen Betrieb zu erkennen, aber auch eigene Defizite, Hindernisse und Grenzen wahrzunehmen, und sich auf den Weg einer Verbesserung zu machen.
„Die Freiheit des Menschen, die im logischen Sinne weder bewiesen noch widerlegt werden kann wird...zum ethischen Postulat“ (ebd.,S.33). Dieses „ethische Postulat“ entspricht Kants kategorischem Imperativ: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant,1965,S.42). Dieser Imperativ sieht einen Handlungsfreiraum, welcher jedoch von der Vernunft gefüllt werden soll, unter der Maßgabe im Sinne der Gemeinschaft, bzw. eines „allgemeinen“ Gesetzes zu handeln. Was jedoch die Gemeinschaft will und wie die Vernunft des einzelnen durch eine moderne Industriegesellschaft mit ihrer Komplexität und ihren Manipulationsmechanismen beeinflußt ist, geht hier nicht ein. „Bei der Annahme absoluter persönlicher Freiheit werden alle kollektiven und individuellen Unzulänglichkeiten ausschließlich dem einzelnen angelastet und nicht auch auf ihre gesellschaftlichen Ursachen zurückgeführt, welche beseitigt werden müßten. Die Freiheit ist nicht etwas von vorneherein individuell Gegebenes, sondern etwas gesellschaftlich Aufgegebenes. Die Freiheit des einzelnen läßt sich nur in einer freien Gesellschaft verwirklichen“ (Weber 1982,S.34;vgl.Sallinger 1983,S.197f). Mit diesen aktuellen Fragen der Freiheit beschäftigt sich desweiteren auch die Kritische Theorie:
Bezogen auf Kant bemerkt Adorno: „Seine Idee der Freiheit wird paradox der Kausalität der Erscheinungswelt einverleibt, die ihrem kantischen Begriff unvereinbar ist. Mit der großartigen Unschuld, der noch Kants Fehlschlüsse ihren Vorrang über alle Gewitztheit verdanken, spricht er das aus in dem Satz von den Wesen, die nicht anders als unter der Idee von Freiheit handeln könnten, deren subjektives Bewußtsein an diese Idee gekettet sei. Ihre Freiheit hat zur Basis ihre Unfreiheit, das nicht anders können (...). Wird Freiheit positiv, als Gegebenes oder Unvermeidliches inmitten von Gegebenem gesetzt, so wird sie unmittelbar zum Unfreien. Aber die Paradoxie von Kants Freiheitslehre entspricht streng ihrem Standort in der Realität (...). Sämtliche Begriffe, welche in der Kritik der praktischen Vernunft, zu Ehren von Freiheit, die Kluft zwischen dem Imperativ und den Menschen ausfüllen sollen, sind repressiv: Gesetz, Nötigung, Achtung, Pflicht. Kausalität aus Freiheit korrumpiert diese in Gehorsam. Kant, wie die Idealisten nach ihm, kann Freiheit ohne Zwang nicht ertragen; ihm schon bereitet ihre unverborgene Konzeption jene Angst vor der Anarchie, die später dem bürgerlichen Bewußtsein die Liquidation seiner eigenen Freiheit empfahl“ (Adorno 1982,S.230f).
Adorno sieht in Kants Freiheitsbegriff eine Paradoxie begründet, die durch die Herleitung aus der Vernunft zu erklären ist. Desweiteren konstatiert er bei Kant eine Angst vor der Anarchie. Zunächst zu dieser Paradoxie. „Kants Vorstellung der durch die Natur des Menschen als Vernunftswesen vorgegebenen Bindung des Willens an die Ratio suche den Umstand zu verbergen, daß auch diese Bindung letztendlich einen Zwang darstelle, daß Freiheit also nach Kant auf der Grundlage der Unfreiheit entstehen solle, eine Forderung, die Adorno als bestenfalls weltfremdes, schlimmstenfalls aber als ein die sozialen Realitäten vertuschendes Konstrukt betrachtet“ (Schörner 1989,S.163). Adorno und der kritischen Theorie geht es also in erster Linie um die sozialen Realitäten. Unterdrückungs- und Repressionsmechanismen unfreier Gesellschaften gilt es zu erkennen und zu bekämpfen. „Freiheit ist einzig in bestimmter Negation zu fassen, gemäß den konkreten Gestalten der Unfreiheit“ (Adorno 1982,S.230). „Autonomie und Freiheit positiv zu bestimmen war nie Ziel der kritischen Theorie“ (Schörner 1989,S.156). Der damit angesprochene Gedanke, daß menschliche Freiheit und Autonomie durch die gesellschaftlichen und institutionellen Gegebenheiten beschränkt sind und zugleich den historischen Auftrag beinhalten, die Gesellschaft kritisch zu reflektieren und zu verändern, wird hier aktualisiert: „...im Zeitalter universaler gesellschaftlicher Unterdrückung (lebt) nur in den Zügen des geschundenen oder zermalmten Individuums das Bild von Freiheit gegen die Gesellschaft (...). Konkret wird Freiheit an den wechselnden Gestalten der Repression: im Widerstand gegen diese“ (Adorno 1982,S.262). Wie dieser Widerstand aussehen soll, welche Möglichkeiten er hat, erwähnt Adorno nicht. Die Bedeutung der Erziehung und der (Weiter-/Aus-) Bildung dabei ist ihm jedoch ein Anliegen: Formen des Erwerbs von mehr Freiheit, Autonomie und Selbstwert sind „Abbau jeglicher Art von unerhellter Autorität“ (Adorno 1971,S.131), und die Fähigkeit und Bereitschaft zu „kritischer Selbstreflexion“(Adorno 1971,S.90).
Den Aspekt der Angst vor der Freiheit und ihrer anarchistischen Anteile möchte ich jetzt nochmals aufgreifen.
„Autonomie muß man sichnehmen. Ein jeder kann nur in dem Maße autonom sein, wie er bereit ist, sich selbst Freiheit und Verantwortung zuzutrauen“ (Erni,1987,S.77). Die hier beschriebene Angst vor Freiheit und Autonomie, die innerhalb eines freiheitlichen Spielraums möglich ist, stellt einen ernsthaften Hinderungsgrund, autonom zu handeln dar (vgl.Fromm 1983). Diese Angst liegt begründet in einer echten Verantwortungsübernahme für sich und die Gesellschaft. „Die Angst vor der tatsächlichen Freiheit werde umgesetzt in Schein- und Ersatzaktivitäten, die dazu dienen sollen von der Misere, in der sich das Subjekt befindet abzulenken“(Schörner,1989,S.161). Wahre Autonomie besteht demnach in der „Kraft zur Reflexion zum Nichtmitmachen“(Adorno 1971,S.93). Es ist nicht selbstverständlich den möglichen Freiraum, den man als Mensch besitzt, auch auszufüllen. Wer Verantwortung übernimmt und handelt, wer sich selbst und die Umstände kritisch reflektiert, kann auch Fehler machen. Sich in einer eventuell bequemeren Unmündigkeit und Unfreiheit sicher und geborgen fühlen, mag häufig als der leichtere Weg erscheinen, man verliert dabei jedoch letztendlich die Verantwortung für sich selbst und die Energie und das Selbstverständnis diese Welt zu gestalten.
Als einstweiliges Fazit sei an dieser Stelle festgehalten, daß menschliche Autonomie nur immer relativ sein kann. Sie ist abhängig von der Begrenztheit des Menschen, durch Erb- und Umweltfaktoren, und sie erfordert den Willen und den Glauben an die Veränderbarkeit erlebter Einschränkungen. Selbstreflexion und Befreiung von eigener Unzulänglichkeit und Angst gegenüber der Verantwortung sind begleitende Notwendigkeiten. Eine lediglich negativ definierte Form der Freiheit, als Kampf gegen Repressionen und Unfreiheit, wie dies die kritische Theorie fordert, erscheint jedoch zu kurz gegriffen und insbesondere zu wenig konkret (vgl.Schörner,1989,S.171ff).
Daneben existieren allerdings gesellschaftliche Zwänge, Repressionen und Mechanismen, die autonomes Handeln und eine uneingeschränkte Reflexion der herrschenden Verhältnisse erschweren. Hier kommt es, je nach Gesellschaftssystem zu erheblichen Unterschieden. Sich befreien und die Gesellschaft zu entwickeln ist eine aufgetragene Aufgabe in jeder politischen Staatsform, wobei man jedoch nie vergessen sollte, daß der eigene Blickpunkt immer schon auf getroffenen Vorannahmen und bereits Durchlebtem beruht (vgl.Watzlawick 1991).
2.1.3 Soziologische Theorien
Welche soziologische Theorie läßt wieviel Spielraum innerhalb ihres Konstrukts, um Autonomie einzelner, innerhalb der Gesellschaft zu erklären bzw. auch nur vorzusehen als Faktor gesellschaftlicher Entwicklung?
Die marxistische Gesellschaftstheorie sieht die Dynamik gesellschaftlichen Wandels begründet in der Verteilung der Produktionsmittel, gemäß dem historischen Materialismus. Die Produktionsverhältnisse bestimmen das Bewußtsein des einzelnen, sowie die sozialstrukturellen Verhältnisse. Der „Klassenkampf“ um ökonomische Vorteile ist Ursache einer gesetzmäßig ablaufenden, historischen Entwicklung. Das Menschenbild der materialistischen Gesellschaftstheorie sieht die ökonomischen Interessen des Arbeiters als Grundlage seiner Handlungen an. Darüberhinausgehende Motive oder die Vorstellung autonomen Handelns, jenseits ökonomischer Überlegungen sind nicht vorgesehen (vgl.Sallinger 1980,S.17f).
Der Strukturfunktionalismus nach Parsons interpretiert die Gesellschaft als ein allgemeines Handlungssystem. Dieses „besteht aus den vier Subsystemen kulturelles (1), soziales (2) und Persönlichkeitssystem (3) sowie Verhaltensorganismus (4), die in dieser Reihenfolge eine Hierarchie der kontrollierenden Faktoren mit dem kulturellen System an der Spitze sowie in umgekehrter Reihenfolge eine Hierarchie der bedingenden Faktoren mit vom Verhaltens-Organismus (im Regelfall der Mensch, d. Verf.) aus abnehmendem Maß an Energie bilden“ (Sallinger 1980,S.18; vgl.Parsons 1975,S.56). Dabei erfüllen die verschiedenen Subsysteme unterschiedliche Funktionen für das Gesamtsystem: Strukturerhaltung, Integration, Zielerreichung und Anpassung. Für das einzelne „Persönlichkeitssystem“ bedeutet dieses Modell, daß es im Rahmen seiner Stellung unterhalb von kulturellem und sozialem Subsystem, in deren Funktionsgefüge durch Sozialisation eingefügt wird. Sozialisation ist also der Prozesse der Einpassung und Internalisierung vorhandener generalisierter sozialer und kultureller Norm- und Wertvorstellungen. Es gibt keine großen Handlungs- oder Entscheidungsspielräume, in denen kreative autonome Handlungen erwartet würden. Nur die Vorgaben der übergeordneten Subsysteme geben die Orientierung vor (vgl.Sallinger 1980,S.18f; Parsons 1975,S.71).
Die Systemtheorie Luhmanns entwirft auf dem Strukturfunktionalismus aufbauend ein Konstrukt der „Autopoiesis“ (Maturana 1981,S.21ff), welches Entwicklungen und Wandel besser erklären kann. Dabei kommt der Kommunikation und insbesondere der Sprache eine große Bedeutung zu. „Auf diese Weise wird sowohl der einzelnen Person...die Möglichkeit der Autonomie als auch über sprachliche, „sinngebende“ Erfassung von biologischen Einflüssen die Möglichkeit der Begrenzung sozialisatorischer Persönlichkeitsformung durch physische Prozesse eingeräumt“ (Sallinger 1980,S.19).
Der Symbolische Interaktionismus, wie er vor allem von Mead, Turner und Blumer formuliert wurde, sieht einen weit größeren Handlungsspielraum der autonomen Individuen vor, deswegen sei er an dieser Stelle etwas ausführlicher dargestellt:
Blumer hebt insbesondere drei Prämissen dieses Handelns hervor. „Die erste Prämisse besagt, daß Menschen ´Dingen` gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung handeln, die diese Dinge für sie besitzen... Die zweite Prämisse besagt, daß die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Die dritte Prämisse besagt, daß diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozeß, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert werden“ (Blumer 1973,S.81). Menschen handeln untereinander die jeweils zu besetzenden Rollen, Normen und Werte, die gelten sollen aus. Die Kommunikation ist dabei ein Balanceakt. Alle Beteiligten haben einerseits einen historischen, biographischen Hintergrund und andererseits Vorstellungen vom eigene und vom Verhalten des Gegenüber. Es findet ein Prozeß des Aushandelns und Akzeptierens, oder Nichtakzeptierens angebotener Rollen und Verhaltenserwartungen statt. Können sich die Interaktionspartner nicht einigen, so ist der Prozeß vom Abbruch bedroht. Das Selbstverständnis der Beteiligten wird ständig neu definiert und nicht durch ein fixiertes „role-taking“ festgelegt. Die Person ist in der Lage sich selbst, Interaktionssituationen und größere soziale Kontexte zu reflektieren und zu gestalten. Dem Menschen, als autonom handelndem und interpretierendem Wesen kommt in dieser mikrosoziologischen Theorie große Bedeutung zu (vgl.Tillmann 1995).Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Erwartungen sind nie völlig deckungsgleich, Befriedigung immer nur partiell. Kommunikation ist daher immer vom Abbruch bedroht.
Abbildung 1: Zusammenhang Interaktion, Identifikation, Identität
nach Tillmann (1995,S.138)
Interaktion bedeutet, daß der Einzelne ständig und lebenslang gefordert ist Situationen zu deuten und zu interpretieren, was vor allem bedeutet, daß die Erwartungen des Gegenübers gedeutet werden und daß ich mich selbst deute. So entsteht Identität aus der Interaktion. Weil beide Rollenpartner dieses Problem haben, deshalb kommt es zum gegenseitigen Abtasten, wobei jeder dem anderen eine Rolle zuschreibt, eine Rolle zugeschrieben bekommt und sich mit seinen eigenen Vorstellungen von Rolle dagegen wehrt etwas zugeschrieben zu bekommen, was nicht zu ihm paßt. Kurzum: die Rollenerwartungen werden ausgehandelt. Es gilt herauszufinden, welche Fähigkeiten und Qualifikationen ein Mensch braucht, um am Interaktionsprozess erfolgreich teilnehmen zu können.
Fünf Grundqualifikationen werden dabei deutlich:
Grundqualifikationen für die alltägliche „Leistung“ der Interaktion:
- Sprachfähigkeit
- Empathie
- Frustrationstoleranz, d.h. trotz geringer Bedürfnisbefriedigung eine Interaktion fortsetzen zu können
- Ambiguitätstoleranz, d.h. trotz Unklarheiten in der Interpretation der Rollenerwartungen handlungsfähig bleiben
- Rollendistanz, d.h. trotz der Fähigkeit eine Rolle auszufüllen, auch die Fähigkeit zu besitzen, sich reflektiert und bewußt davon zu distanzieren.
Je stärker die Qualifikationen entwickelt sind, desto eher ist das einzelne Subjekt in der Lage, Identität auch unter schwierigen Bedingungen zu wahren.
Wünschenswertes Ziel der Subjektentwicklung ist das stabile Selbst, eine Ich-Identität als Balance von sozialer und personaler Identität, das Verfügen über obige Grundqualifikationen und die selbstbewußte und bedürfnisorientierte Teilnahme an gesellschaftlichen Interaktionen.
Identität ist somit die Fähigkeit sich ein Bild von sich selbst zu machen (vgl.Tillmann 1995,S.136).
Identität entsteht, wenn Ego sich im Kommunikationsprozeß mit den Augen von Alter zu sehen vermag und auf diese Weise ein Bild von sich selbst entwickelt.
Goffmann unterscheidet zwei Dimensionen: Ich-Identität ist
- personale Identität: Selbstinterpretation der Biographie durch Ego.
- soziale Identität: Eingebundensein in Gruppen- und Rollenstrukturen.
Die Erwartungen, denen ein Subjekt bei der Selbst-Repräsentation ausgesetzt ist, lassen sich in zwei Dimensionen unterscheiden: In der zeitlichen Linie verfügt das Individuum über eine Biographie, deren Selbstinterpretation als personale Identität bezeichnet wird. In der aktuellen Situation ist das Individuum in unterschiedliche Gruppen- und Rollenstrukturen eingebunden; die darauf bezogene Selbstinterpretation ist die soziale Identität. Aus der Balance von personaler und sozialer Identität wiederum ergibt sich die Ich-Identität. „Während persönliche Identität so etwas wie die Kontinuität des Ich in der Folge der wechselnden Zustände der Lebensgeschichte garantiert, wahrt soziale Identität die Einheit in der Mannigfaltigkeit verschiedener Rollensysteme, die zur gleichen Zeit ´gekonnt`sein müssen“ (Tillmann 1995,S.137).
Die Persönlichkeitsentwicklung durch Sozialisation wird betrachtet als, Einheit von Vergesellschaftung und Individualisierung. Die reflexive Aneignung der Sprachsymbole, Werte, Normen seiner sozialen Umgebung ermöglichen es dem Sozialisanden ein handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft, ebenso wie ein einmaliges, unverwechselbares Individuum zu sein bzw. zu werden. Im Laufe der biographischen Entwicklung der Ich-Identität, ist diese immer wieder, lebenslang, durch Interaktionsprozesse neu auszuhandeln und auszubalancieren.
Im Rahmen dieser Entwicklung entsteht ein Selbstverständnis für die Möglichkeit und Wichtigkeit der zu gestaltenden Freiräume, die dem Individuum Autonomie ermöglichen. Das Aushandeln und Ausbalancieren der Verhältnisse im Kommunikationsprozeß, sowie die dargestellten Grundqualifikationen können als Rahmenbedingungen für personale Autonomie und deren lebenslange Bearbeitung gewertet werden.
Im weiteren geht auch der vorzustellende Ansatz von Sallinger nochmals auf den Zusammenhang von Identität und Autonomie aus Sicht des symbolischen Interaktionismus ein.
2.1.4 Der Autonomiebegriff bei Sallinger
Sallinger beschäftigte sich intensiv mit der Frage der Möglichkeit und der Bedingungen persönlicher Autonomie im Kontext von Sozialisation, Persönlichkeit und Freiheit (vgl.Sallinger 1980,1983). Dabei steht die Frage im Mittelpunkt,„...welche Qualität der sozialisierenden Umwelt zur Bildung einer autonomen, psychischen und kognitiv freien Persönlichkeit zukommen muß. Vorrangiges Ziel ist es dabei, konkrete, bewußt beeinflußbare Bedingungen dieser Autonomie und deren Verknüpfungen mit Hilfe einer analytischen Unterscheidung persönlichkeitsbildender Komponenten zu erarbeiten“ (ebd.,S.11). Es handelt sich dabei um ein sehr personzentriertes Verständnis von Autonomie. Der „Begriff der Autonomie der Persönlichkeit“ wird dabei zunächst in seiner ursprünglichen Grundsemantik von „Unabhängigkeit“ und „ ´Wahlfreiheit` auf die Formung der eigenen Persönlichkeit einschließlich Motiviertheit, aktuellem Verhalten und die Qualität des Erlebens in rationaler, bewußter und erlebensnaher Erfassung aller denkbaren diesbezüglicher Alternativen...“(ebd.,S.14f) verstanden. Die oben erwähnten persönlichkeitsbildenden Komponenten stellen dabei die Möglichkeiten und Grenzen der Ausgestaltung persönlicher Autonomie dar. „Da eine vollkommene und detaillierte Erfassung aller in verschiedenen Wissenschaften als persönlichkeitsformend (und damit unter zu erkundenden Umständen autonomiefördend) erkannten biologischen und sozialen Bedingungen nicht zu leisten ist, werden...analytisch abgegrenzte, faktisch interdependente Kategorien und Komponenten der biologischen respektive sozialen Persönlichkeitsformung gebildet, welche entsprechend verschiedenen Disziplinen und Theorien (z.B. Lerntheorie, Psychoanalyse, symbol. Interaktionismus, Ethologie, Sozio- und Psycholinguistik, Sozialphilosophie) einzeln oder kombiniert die Struktur der Persönlichkeit, ihr Verhalten und teilweise das Erleben beeinflussen.
Im einzelnen handelt es sich um die Kategorien: Instinkte, Impulse, Regeln, Werte, Identität, Sprache und Denken.
Das Besondere an diesem Ansatz ist das Bemühen operationalisierbare Kategorien zu gewinnen, um das Vorhandensein und die prinzipielle Möglichkeit von Autonomie auf einer sehr personzentrierten Ebene überprüfen zu können. Dabei werden auch die Grenzen und Chancen der persönlichen Autonomie plastischer. Die von Sallinger gewonnenen Hypothesen und Postulate, sowie Sätze und Thesen möchte ich nicht alle im einzelnen kritisieren, da ihre Validität und empirische Überprüfbarkeit, auf die hin sie zwar, entsprechend dem Wissenschaftsverständnis des Kritischen Rationalismus, formuliert sind, in der Praxis sehr schwer zu ermitteln sein dürften. Dennoch erscheinen mir die gewonnenen Kategorien eine Hilfe bei der Darstellung persönlichkeitsbezogener Aspekte der Autonomie. Sie seien im folgenden vorgestellt, zusammen mit dem jeweils angenommenen Einfluß auf die persönliche Autonomie.
- Instinkte
Hier konnte Sallinger „keine operationalen oder operationalisierbaren Bedingungen für Ansatzpunkte einer Vergrößerung der Autonomie bezüglich der Verhaltensbeeinflussung“ finden, „außer ethisch indiskutabler und methodisch begrenzter...Genmanipulation“ (ebd.,S.92).
- Impulse
Impulse sind Antriebe, „die zu Verhaltensweisen einer bestimmten ´Richtung` motivieren“ (ebd.,S.92). Lernabhängig, sozialisierbar und kognitiv beeinflußbar sind demnach diejenigen Impulse, die auf Außenreizen, motorischem Verhalten und Emotionen, als auslösenden Größen beruhen. Deswegen können sie prinzipiell autonom gestaltet werden. „Je stärker derartige Sozialisationsbedingungen vorliegen, welche die Sozialisation personaler Autonomie steigern..., desto unabhängiger von biologischer Richtungsbeeinflussung des Verhaltens kann dieses (und möglicherweise Erleben) gestaltet werden. Demgemäß sprechen die in Kategorie 3-7 (Regeln - Denken, d.Verf.) skizzierten autonomiefördernden Sozialisationsbedingungen auch gemäß den Erkenntnissen über biologische Impulse für eine die personale Autonomie erhöhende Wirkung. (...) Dies impliziert zwar nicht die Unterdrückbarkeit biologischer Antriebe, jedoch die Möglichkeit zu bewußter Wahl nahezu aller eigenen Verhaltensweisen (und damit Autonomie)“ (ebd.,S.95).
- Regeln
„Alle Sozialisationstheorien schließen als zentrale Merkmale die Vermittlung von Regeln ein, so die Lerntheorie beim Konditionieren bestimmter Umweltmerkmale mit spezifischen Reaktionen, die Rollentheorie über mehr oder weniger interpretierbare Rollenerwartungen, der symbolische Interaktionismus beim Erlernen sprachlicher Sinn- und Bedeutungsregeln und die Psychoanalyse in der geradezu überragenden Bedeutung der Über-Ich-Regeln.(...) Aufgrund ihres definitionsgemäß erlernten Einflusses sind die Komponenten dieser Kategorie (ungleich Kategorie 1 und 2) nicht angeborenermaßen wirksam.(...) Der konkrete Inhalt der in den Individuen einer Gesellschaft verankerten Regeln entscheidet (neben anderen Faktoren wie Werten) über die konkreten Wahlmöglichkeiten und Chancen zur Selbstgestaltung des eigenen Lebens, demnach...über die Bedingungen der Autonomie eines Individuums zumindest mit“ (ebd.,S.96f). Als exemplarische Regel mag der Kantsche kategorische Imperativ gelten, bei dem „...jedem einzelnen...von der Seite der gesellschaftlichen Einflüsse her im Vergleich zu jeder denkbaren Alternative logisch am ehesten die Chance zu bestmöglicher, autonomer Gestaltung seines Er-Lebens gegeben würde...mit der Ergänzung der Berücksichtigung der Besonderheiten des individuellen Erlebens“ Und somit wird der kategorische Imperativ „als bestmögliche soziale Grundregel zur Vergrößerung der Autonomie der einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft betrachtet“ (ebd.,S.98).
- Werte
Unter Werten versteht man „Selektionskriterien zur Entscheidung zwischen unterschiedlichen Zuständen“ (Reimann 1991,S.260). Dabei geben die Werte Orientierungshilfen, legen jedoch das Handeln nicht fest. Dementsprechend ist jeder Wert bezüglich seines Einflusses auf die menschliche Autonomie einzeln zu untersuchen. „Einigen konkreten gesellschaftlichen Wertvorstellungen - wie solchen, die Haß auslösen oder verstärken - kommt ´negative Erlebens-Bedeutung`, insbesondere Abbau der Autonomie zu.(...) Die Autonomie negativ beeinflussende Wertvorstellungen sind durch rationale Kritik beeinflußbar“ (Sallinger 1980,S.100f).
- Identität
Interaktionistische Identitätsvorstellungen passen am ehesten in Sallingers Kategoriesystem (siehe 2.1.3.). „Die Anführung der ´Identität` als eigene, verhaltensbeeinflussende Kategorie scheint sinnvoll, da sie werde biologisch wirksam noch unter Werte und Regeln subsumierbar ist, sowie qualitativ anders als Sprache und Denken auf das Verhalten des Erwachsenen Einfluß nehmen kann“ (ebd.,S.102). Die Kategorie ´Identität` wird vor allem auf den Ansätzen Meads, Goffmans, Habermas` und Krappmanns aufbauend konstruiert.
Zentrale ist dabei die Rollentheorie, die von einem Aushandeln der Rollen ausgeht, und als Gundlage - aber auch als Ergebnis - nicht den „angepaßten Rollenspieler“ sieht, sondern ein Persönlichkeitsmodell, das eine Ich-Identität als Balanceakt zwischen sozialer (Anpassung an Erwartungen) und persönlicher (eigene Bedürfnisse und Identitätsentwürfe aufgrund der eigenen Biographie) Identität versteht. Möglich wird das Ganze durch obengenanntes „Aushandeln“ von Rollen: durch die Interaktion (mittels sprachlicher Symbole, die auf die dahinterliegende „natürliche“ Umwelt verweisen und Einstellungen und Handlungsaufforderungen enthalten).
„Entsprechend dieser balancierenden, in jedem Interaktionsprozeß neu zu gewinnenden Struktur der Identität wird diese erst durch die kreative Fähigkeit zur entsprechenden Norminterpretation, welche durch widersprechende Normen stimuliert wird, ermöglicht. Dementsprechend gilt (bis zu einer Grenze individueller Verarbeitungskapazität...)...: Mit zunehmender Zahl und Widersprüchlichkeit der Erwartungen an das Individuum in einer Interaktionssituation steigt die Chance zu höherer Identität“ und somit auch „...zu höherer Autonomie... Diese Erwartungen (hängen) von der Vielzahl und Vielfalt der Normen und Rollenanforderungen und der Repressionsfreiheit (zur Bedeutung der Repressivität in institutionellen, betrieblichen Kontext siehe auch 4.2.3.2. und Abb. 11, d.Verf.) einer Gesellschaft (ab).(...) Die Beziehung zwischen Identität und Autonomie besteht auf zwei Ebenen: Erstens ermöglicht... das Vorliegen bestimmter situativer Bedingungen wie Normen- oder Rollenvielfalt über ihre Stimulierung zu und Ermöglichung von kreativer Interpretation nicht nur die Ausprägung seiner Identität, sondern aufgrund ihrer impliziten Wahlmöglichkeit und fehlender Festgelegtheit des Individuums dessen Autonomie. Zweitens führt auch im interaktionistischen Identitätsmodell - zumal hier über die Biographie vergangene Ich-Identitäten in neue eingehen und eine starke Identitätsbasis die Identitätsbalance unterstützt - eine starke Identität zu einem tendenziell festeren Selbst-Erleben, das wahrscheinlich eher eigener Reflexion und Handlungsbestimmung vertrauen läßt. Deshalb soll gelten: Ein hohes Maß an Identität ist ein konstituierendes Merkmal personaler Autonomie“ (ebd.,S.106).
„Individuen, die mit Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz in eine Interaktion eintreten, können in unterschiedlichem Maße eine ´Ich-Identität` sichtbar werden lassen. Da nur die Identitätsmerkmale, die das Individuum in den Interaktionsprozeß einführt, in ihm wirksam werden können, ist deren Darstellung wichtige Bedingung einer aus der Kommunikation resultierenden eindeutigen Identität“ (ebd.,S.109).
- Sprache
Der Sprache kommt eine wesentliche Dimension zu, wenn es um menschliche Autonomie geht, da Sprache „als Medium der Vermittlung, Symbole und Datenspeicherung als Mittel der Weitergabe...Kennzeichen spezifisch menschlicher geistiger Möglichkeiten (sind)“ (Macha 1989,S.237). Sallinger definiert Sprache als „...ein System von Zeichen, die gemeinsame Bedeutung (bei Sender und Empfänger) besitzen und verallgemeinernd und abstrahierend eine Vermittlung zwischen Wirklichkeit und Mensch (´Information`) sowie Sprecher und Hörer (´Kommunikation`) vornehmen können“ (Sallinger 1980,S.114). Desweiteren teilt er die Sprache in vier „Funktionen“ ein:
„Sprache hat für den Menschen die Funktionen
1. des Ausdrucks und der Kundgabe
2. der Auslösung (des Appells) von (an)
a) Verhaltenstendenzen
b) Emotionen
3. der Information und
4. der Argumentation und ist dialogisch wie monologisch einsetzbar“ (ebd.,S.114).
Diese Funktionen untersucht er im weiteren, wobei meines Erachtens die Einschätzung der Auslösefunktion von Sprache zu einseitig rationalistisch, kognitivistisch ausgefallen ist. Unter Auslösefunktion der Sprache versteht Sallinger in diesem Kontext das Vermögen einer Person durch Sprache einen erfolgreichen Appell an Emotionen und Verhaltenstendenzen zu richten. „Je größer die Zahl und Vielfalt der (verarbeiteten) Informationen und Argumente, desto schwächer ist die Auslösefunktion einer Sprache. Die Auslösefunktion der Sprache schränkt jedoch... die Autonomie ein, da sie den Menschen zu Emotion (bzw. deren Verstärkung) und Verhalten anregt, welche die rationale, langfristig orientierte Wahl von Handlungen und damit...die Autonomie einschränken“ (ebd.,S.115ff).
Das hier gezeichnete Verständnis, daß mehr Rationalität eine „langfristige Wahl von Handlungen“ und somit autonomes Verhalten fördert, und im Gegensatz dazu Emotionen Verhalten und Handlungen fördern, welche die persönliche Autonomie einschränken, ist eine verkürzte Betrachtungsweise. Neuere Untersuchungen, Studien und Überlegungen zur Bedeutung und Entwicklung von Emotionen (z.B. Ulich & Mayring 1992; Goleman 1996; Zimbardo 1988,S.380ff) skizzieren eine wesentliche Bedeutung der Emotionen, nicht zuletzt auch unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit des Menschen. Das Ausblenden oder Abwerten der menschlichen Emotionalität entspricht zwar einer rationalistischen Denkungsart, erscheint jedoch auch unter wissenschaftlich-rationalistischen Gesichtspunkten nicht länger haltbar. Autonomie kann nicht Freiheit von Emotionen bedeuten. Von daher erscheint der Aspekt der Emotionalität und des Umgangs mit Emotionen durchaus auch einen Bereich im Kontext der Erlangung von mehr Autonomie zu sein. Das bewußte Erkennen , Annehmen und Ausleben der eigenen Gefühle ist als weitere Dimension der menschlichen Autonomie denkbar und wünschenswert.
Zusammenfassend folgert Sallinger:
„Je größer die Zahl und Vielfalt der Kategorien, die Zahl der Begriffe...und je vielfältiger und zahlreicher die Begriffs- und Kategorienverknüpfungen (untereinander und zwischen Begriffen und Kategorien), desto stärker ist die Informationsfunktion einer Sprache ausgeprägt(...).
Je größer die Zahl und Vielfalt sprachlicher Begriffe ...- und der Begriffs- und Kategorieverknüpfungen (untereinander und zwischen Begriffen und Kategorien), desto stärker ist die Argumentationsfunktion einer Sprache“ (Sallinger 1980,S.120f).
Die Verbindung zwischen den hier aufgezeigten operationalisierbaren Variablen der Sprache und der menschlichen Autonomie geschieht aber erst in der zusätzlichen Betrachtung der Kategorie „Denken“, denn diese hängt hier mit der Sprache sehr eng zusammen.
- Denken
Denken wird als das „konstituierende Merkmal“ der Autonomie gesehen und als „entscheidende Grundlage menschlicher Autonomie“ (ebd.,S.121ff). Dabei werden als eine Art Schnittmenge des Denkbegriffs in verschiedensten Wissenschaften die Merkmale „gerichtetes Verknüpfen“, „Verallgemeinerung“ und „Abstrahierung der Wirklichkeit in Begriffen“ genannt und belegt. Diese operationalen Merkmale des Denkens verweisen auf den engen Zusammenhang zur Sprache. Desweiteren wird Sprache und Denken in einer „Leistungssymbiose“ (Wygotski 1974) gesehen, wobei eine wechselseitige Beeinflussung nachgewiesen wird, in Abgrenzung zu Ansätzen, die eine Wesensgleichheit von Denken und Sprache postulieren, bzw. die andererseits eine völlige Verschiedenheit von Sprache und Denken feststellen. Diese „Leistungssymbiose“ sieht Denken und Sprechen als eigenständige Bereiche mit einer großen Schnittmenge, dem „sprachlichen Denken“ an. Dementsprechend werden gemeinsame Kategorien von Sprache und Denken in Anlehnung an die Kategorie Sprache (6.) untersucht (Kategorisierung, Begriffsdeutung, Syntax und Verknüpfung dieser Bereiche), bezüglich ihrer Bedeutung für die Autonomie und folgende Ergebnisse gefolgert (vgl.Sallinger 1980,S.121ff):
„Je differenzierter und vielfältiger die Kategorienbildung (v.a. der Wortschatz) einer Sprache, desto tendenziell größer ist die Autonomie. Da menschliche Fragestellung an die Wirklichkeit einen Akt des Denkens voraussetzt und die Qualität und Menge der Fragen die Antwort mitbestimmt, welche wiederum zu sprachlicher Kategorisierung führt, hat das Denken im Bereich der Kategorisierung Einfluß auf die Sprache. (...) Je differenzierter, vielfältiger und wertneutraler die Begriffe der beherrschten Sprache, desto tendenziell größer ist die Autonomie.(...) Je größer die Zahl der Syntaxregeln, die unterschiedliche Fälle von Wortkombinationen regeln, desto stärker wird das Denkpotential und damit ... die Autonomie gefördert.(...) Mit Zunahme der Systematisierung, Hierarchisierung und der Zahl der Verknüpfungen zwischen Kategorien und Begriffen (untereinander und gegenseitig) steigt das Denkpotential und damit der Grad an Autonomie“ Sallinger 1980,S.128ff)
Diese sieben Kategorien persönlicher Autonomie stellen einen interessanten Versuch dar, auf einer sozialen Mikroebene Autonomie zu operationalisieren und vor allem griffiger, eindeutiger zu machen. Für die Betrachtung und Untersuchung pädagogisch - andragogischer Maßnahmen können diese Aspekte der persönlichen Autonomie interessante Fragedimensionen und weiter zu operationalisierende Untersuchungsitems bieten. Auf dieser Grundlage könnten Auswertungen von Seminaren, Kursen und Unterricht, bezüglich ihrer Leistungen für die persönliche Autonomie, stattfinden.
2.1.5 Zur Fokussierung der Autonomie auf unterschiedlichen Ebenen
Wie bereits mehrfach angedeutet, ist die Sichtweise, die mikro- oder makroperspektivische Betrachtung der Autonomie eine wichtiges Unterscheidungskriterium für die Art der gemeinten Autonomie. In Anlehnung an die Bedeutung der Sozialisation für die Autonomie bei Sallinger, möchte ich an dieser Stelle auch eine Anleihe in der Sozialisationsforschung machen. Die vier Bedingungsebenen des Sozialisationsprozesses (siehe Abbildung 2) seien analog als Bedingungsebenen der Autonomie zu verstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: (modifiziert und vereinfacht übernommen nach Tillmann 1995,S.18):
Die Skizze verdeutlicht, daß die Bedingungsebenen, die auf die Subjektentwicklung Einfluß nehmen, in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Die jeweils höhere setzt die Rahmenbedingungen für die Strukturen und Abläufe in der nächst niedrigeren. Daß damit kein deterministisches Verhältnis gemeint ist, deuten die doppelseitigen Pfeile an: Strukturen und Abläufe der unteren Ebene wirken immer auch auf die nächsthöhere zurück und können dort Veränderungen bewirken. (Tillmann 1995,S.17)
Die Gliederung der Ebenen strukturiert den Gegenstandsbereich:
a) eher psychologische Fragestellung:
„Wie eignen sich Subjekte ihre unmittelbare soziale Umwelt an und wie
bilden sie dabei ihre Persönlichkeitsstrukturen aus?“
b) eher soziologische Problemstellung:
„Welche Zusammenhänge bestehen zwischen diesen Umweltbedingungen
und umfassenderen gesellschaftlichen Strukturen?“ (ebd.,S.17f)
Eine ebensolche Betrachtung soll auch für die Autonomie angelegt werden. Zum einen kann die subjektbezogene Ebene gesehen werden. Dann steht das Individuum mit seinen Erfolgen, Einstellungen, seinem Wissen, den emotionalen und kognitiven Strukturen im Zentrum der Betrachtung. Die Kategorien Sallingers (siehe 2.1.4.) stellen eine solche personzentrierte Betrachtungsweise der Autonomie dar. Der Blickwinkel des Betrachters kann jedoch auch die Autonomie, die in Interaktionen möglich ist erfassen. Auf dieser Ebene stellt sich die Frage nach autonomen Frei- und Gestaltungsräumen innerhalb sozialer Beziehungen, z.B. innerhalb einer Arbeitsgruppe, im Kontext des Arbeitsplatzes, zwischen den Mitarbeitern und gegenüber Vorgesetzten. Die Kommunikation zwischen Menschen, die miteinander zu tun haben, oder eben gerade nichts miteinander zu tun haben, aufgrund von Hierarchien. Auf Institutionsebene wäre die Fragestellung an die Autonomie eher, inwieweit eine Institution, z.B. ein Betrieb selbst Autonomie im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang hat, welche Sachzwänge tatsächlich vorliegen und welchen Anteil an selbst zu gestaltendem Freiraum an Mitarbeiter abgegeben werden kann oder muß.; welche positiven und negativen Folgen daraus erwachsen können. Gesamtgesellschaftlich gesehen sind Fragen des Demokratieverständnisses, der ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Struktur durchaus auch die Fragen an darin enthaltene Autonomie. Autonomie der gesellschaftlichen Gewalten, Autonomie gegenüber anderen Gesellschaften, Autonomie der Wirtschaft, der Politik, des Rechtssystems - auf dieser obersten Ebene tauchen andere Fragen der Selbstgesetzlichkeit auf, die jedoch ihre Auswirkungen auf die unteren Ebenen haben. All diese Ebenen sind jedoch nicht losgelöst voneinander zu betrachten, sondern wirken jeweils wechselseitig aufeinander!
Eine rein persönlichkeitszentrierte Sichtweise der Autonomie macht demnach alleine keinen Sinn. Abhängigkeiten und Wechselseitigkeit sind stets mitzubedenken. Andererseits muß man sich darüber klar werden, daß man immer einen bestimmten Schwerpunkt, einen Fokus auf eine bestimmte Ebene legt und alle Ebenen gleichzeitig nicht zu erfassen sind. Unter Berücksichtigung dieser Maßgabe sei in dieser Arbeit ein Schwerpunkt in der Mikroebene auf das Verhältnis von Subjekt und Interaktion in einem betrieblichen Kontext gelegt.
2.1.6 Synthese: Modell der Autonomie auf verschiedenen Organisationsstufen
Das Verständnis, das ich im weiteren von menschlicher Autonomie anlege bezieht sich auf die ursprüngliche Semantik des Wortes im Griechischen. „Auto-nomos“ - Selbstgesetzlichkeit; das bedeutet mehr als nur „Wahlfreiheit“; das bedeutet selbst die Gesetze zu setzen, der Mensch entwickelt seine eigene Gesetzlichkeit, kann selbst Ursprung einer neuen Kausalkette sein und das bewußt erleben und bestimmen (vgl.Erni 1987, Weber 1982). Die Kraft und Energie für ein derartiges Verständnis der Eigengesetzlichkeit nimmt das Individuum aus dem „Kern des Ich“ (Macha 1989). Der „Kern des Ich“, der die körperlich-emotionale und geistig-kognitive Dimension des Subjekts, deren Trennung sich durch die philosophisch-anthropologische Geschichte des Abendlandes zieht, wiedervereinigt und zu harmonischer wechselseitiger Bezogenheit bringt, ist als relativ stabil zu sehen (vgl.Macha 1989,S.233ff). „Es ist die innerste Zone des Menschen, die nur bei intensivem Kontakt in Interaktionen aktiviert wird. Hier ist die biographische Identität als die Summe der bewußten und verdrängten Lebenserfahrungen gespeichert. Der Mensch handelt aus dieser Mitte heraus und zieht sich dahin zurück, um sich seiner Person wieder innezuwerden. Das Erlebnis der Mitte kann über das Gewahrsein des Körpers ebenso empfunden werden... wie auch über die Selbstreflexion.(...) ...der Mensch ist zwar von außen determiniert, aber er verarbeitet die Bedingungen subjektiv und gestaltet umgekehrt seine Umwelt“(Macha 1989,S.310). „Während dabei die äußeren Schichten der Person im Kontakt auf die Erwartungen der Umwelt reagieren und das Ich je nach Situation strukturieren, bleibt der Kern relativ beständig als Erlebnisstrom erhalten, nur z.T. verdeckt durch das Erleben in der aktuellen Situation“ (Macha 1989,S.312). Der „Kern des Ich“ ist Grundlage der Subjektivität des Individuums und somit Substanz und Quelle der Kraft und Energie für autonomes Fühlen, Erkennen und Handeln. Das Verständnis dieser sieht so aus, „daß a.) der Körper-Kern mit der Energie zum Geist-Kern und damit zum bewußten Ich hin verbunden ist, und daß b.) die Energie aus sich selbst heraus keine triebhafte Eigentendenz aufweist, sondern nur ein Potential ist, das vom Ich gerichtet wird hinsichtlich seiner geistigen und körperlichen Tendenzen. Das Körpergewahrsein gestattet es, die organismische Vernunft in die Handlungen des Ich neben den geistigen Impulsen einzubeziehen und somit eine Ganzheit des Erlebens herzustellen“ (Macha 1989,S.323).
Der „Kern des Ich“, mit seiner Kraft und Energie kann nun jedoch in seiner Bedeutung für die menschliche Autonomie eventuell nicht zur Geltung kommen, wenn weniger tiefgehende, oberflächlichere Schichten der Person in inter-, intrapersonalen oder institutionellen oder gesellschaftlichen Manipulationen, Repressionen oder Abhängigkeiten gefangen sind. Hier liegen die Möglichkeiten einer ( Aus-, oder Weiter-) Bildung im umfangreicheren Sinne, die ein mehr an Autonomie und Selbständigkeit als oberstes Bildungsziel postuliert (vgl.Geißler 1984,S.276). In dieser Arbeite lege ich also ein person- und persönlichkeitsbezogenes Verständnis von Autonomie zugrunde, jedoch gerichtet auf die Interaktions- und Institutionsebene des sozialen Kontextes (siehe 2.1.5.).
Als konkrete Indikatoren oder Variablen der Autonomie seien an dieser Stelle die Kategorien Sallingers genannt, wobei auf die „Instinkte“ und „Impulse“ verzichtet sei, da ihnen als biologische Dimensionen im Bildungsbereich nur sehr bedingt realistische und nachzuweisende Maßnahmen gegenüberstehen können. Dahingegen sei die Kategorie „Sprache“ um den nonverbal, körperlich emotionalen Anteil der Sprache, um Gestik und Mimik erweitert. Denn diesen Interaktionsmodi kommt aus einer ganzheitlichen Sicht des Individuums, wie sie auch der Konzeption des „Kern des Ich“ innewohnt, eine entscheidende Bedeutung, insbesondere emotional-körperbetonter Botschaften zu. Dieses Kategoriensystem könnte im weiteren als erster Schritt einer Operationalisierung der Autonomie, analog zu Sallingers, dem Kritischen Rationalismus verpflichteten Vorgehensweise, genutzt werden. Es wäre denkbar aus diesen Grundkategorien Items zu gewinnen, die sodann in Fragebogenform auf Aus- und Weiterbildungsangebote angewendet werden könnten, um die Befähigung zu autonomem Denken und Handeln, herbeigeführt durch die Maßnahmen, zu überprüfen. Ein weiterer Aspekt dieser Autonomievorstellung basiert auf einer systemischen Betrachtungsweise. Der Mensch ist in seinem Denken, Handeln und Fühlen in verschiedenen Systemebenen (Meso, Mikro, Makro, Exo...usw.) eingebunden (vgl.Abbildung 3). Die Abbildung entspricht einer systemischen Betrachtungsweise, wie sie in der Familientherapie angelegt wird. Ein Symptomträger der mit einem bestimmten Symptom in die Familientherapie kommt, wird als ein in vielerlei Systemebenen eingewobenes Individuum betrachtet. So gehören beispielsweise soziokulturelle Bedingungen, wie die Arbeitsbedingungen oder die politische Lage zum Makrosystem, oder die Arbeitsgruppe eines nahen Verwandten wird als Exosystem zum Mikrosystem Familie, um das es in diesem speziellen Fall geht, betrachtet. Die Gruppen, in denen sich der Symptomträger selbst bewegt, z.B. eine Schulklasse würden als Mesosystem begriffen. Hierunter wird auch das gesamte soziale Netz subsumiert (vgl.v.Schlippe 1995,S.28). „Systemisches Denken erfaßt Ganzheiten und nicht Individuen. Es achtet auf die in diesen Ganzheiten geltenden Regeln und die in und zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen. Das systemische Denken verläßt somit die Kategorien von Ursache - Wirkung ... zugunsten einer zirkulären Sichtweise. Alles im System ist aufeinander in Wechselwirkung bezogen. Menschen sind keine isolierten Einzelwesen, und daher ist jede Handlung darauf zu befragen, welche Bedeutung sie für das System hat, in dem der Mensch lebt“ (ebd.,S.30). Darüber hinaus ist es dieser systemischen Betrachtungsweise eigen, daß jedes System seinerseits wieder aus Subsystemen besteht. „Eines der Axiome systemischen Denkens ist, daß sich die Charakteristika lebendiger Systeme auf jeder Organisationsstufe (Organismus, soziales Mikrosystem, Gesellschaft) wiederfinden lassen. Die Staffelung ist hierarchisch, d.h. daß die höher geordneten Systeme alle untergeordneten Systeme umfassen (die Gesellschaft enthält z.B. alle Familien und Individuen). Ein System (z.B. Familie) kann also immer auch als ein Untersystem zu Übersystemen (einer Dorfgemeinschaft) gesehen werden oder als Übersystem für Untersysteme (z.B. geschwisterliches Subsystem). Die gesamte Komplexität ist nicht erfaßbar...“ (ebd.,S.26f). Deswegen muß sich insbesondere der Familientherapeut bewußt sein, daß immer ein bestimmter Blickwinkel, ein Fokus bei der Betrachtung von Systemen angelegt ist. Indem ein Aspekt scharf betrachtet wird, werden andere unscharf. Ein bestimmtes Symptom bedeutet demnach auch eine bestimmte Fokussierung und das Ausblenden anderer Begleitumstände. Da das Gesamte, in seiner Komplexität nicht zu erfassen ist, gilt es sich stets der Fokussierung sehr bewußt zu sein und mitunter auch die Blickwinkel zu verändern. Mit diesem systemischem Verständnis sei die Frage geklärt, wie aus der personzentrierten Betrachtungsweise der Autonomie auf die Ebenen Interaktionen und Institutionen (siehe 2.1.5.) eingegangen werden soll.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Dimensionen sozio-psycho-physischer Gesundheit
nach von Schlippe (1995,S.28)
Analog zur familientherapeutischen Betrachtung, in der das systemische Denken auf ein Symptom, im Kontext des Mikrosystems Familie bezogen ist, sei nun das systemische Denken auf die Autonomie gerichtet.
Bedingungen und Auswirkungen autonomen menschlichen Denkens und Handelns sind demnach immer bezüglich einer bestimmten Systemebene zu betrachten. Das autonome Handeln des einzelnen oder von Gruppierungen, wie z.B. den Gewerkschaften, kann im Verhältnis zur Gesellschaft und deren Bedingungen, Abhängigkeiten, Manipulationen und Repressionen gesehen werden. Es kann jedoch der Fokus auch auf den intrapsychischen Bereich, beispielsweise eines Arbeitslosen, gelegt werden, so daß bezüglich der Fragestellung der Autonomie andere, jetzt intrapsychische Dimensionen, in den Vordergrund treten. Im Kontext der betrieblichen und beruflichen Weiterbildung erscheint jedoch die Perspektive des Individuums innerhalb einer Organisation bzw.Institution als maßgeblicher Fokus. Nichtsdestotrotz muß immer wieder auf die anderen Systemdimensionen verwiesen werden, sowie auf deren Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zueinander und insbesondere auf die einmal gewählte Perspektive.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Systemisches Fokusmodell für Autonomie
zu Makrosystem: soziokulturelle Bedingungen, Arbeitsbedingungen,
Umweltbelastung, politische Lage, Außenpolitik,
Abhängigkeiten und Verträge des Staates
zu Exosystem: Gruppen von Menschen die momentan nicht konkret
betrachtet werden jedoch mittelbar Einfluß haben, z.B.
Gewerkschaftsfunktionäre, wenn eine Arbeitsgruppe im
Rahmen betrieblicher Weiterbildung das Mikrosystem ist
zu Mesosystem: Betrieb, Unternehmen, Partei, Institutionen, Organisationen
andere Gruppen in denen die Mitglieder der
Arbeitsgruppe ebenfalls Mitglieder sind, z.B.
Nachbarschaft, Vereine
zu Mikrosystem: Arbeitsgruppe eines Betriebs, Abteilungsleiterkonferenz,
Mitarbeiterstruktur, Kommunikationsmuster, Konflikt-
lösungspotentiale
zu Subsystemen: kleinere Gruppierungen innerhalb der Arbeitsgruppe,
Paar-, Dreier-, Viererbeziehungen und deren eigene
Stile, (Kommunikations-) Muster, Umgangsformen
zu Individuum: Persönliche Biographie, Selbstwert, Kognitive Stile,
Lebensereignisse (vgl.Filipp 1981), Selbstkonzept
Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, daß die Autonomie, von der weiterhin die Rede ist, die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstgesetzlichkeit beinhaltet; ihre Kraft und Energie aus dem „Kern des Ich“ schöpft; als mögliche weiter operationalisierbare Aspekte die Kategorien: Regeln, Werte, Identität, Sprache und Denken, auch als Dimensionen des Erwerbs von Autonomie hat; und unter den Maßgaben des Bewußtseins einer Fokussierung auf einen bestimmten Betrachtungsblickwinkel, und mit dem Wissen, daß es weitere, wechselseitig abhängige Perspektiven gibt, zu sehen ist. Für die weitere Arbeit bedeutet dies Möglichkeiten, Grenzen und Chancen der Selbstgesetzlichkeit von Menschen in Betrieben und im Beruf, bezüglich deren Aus- und Weiterbildung unter Maßgabe der oben genannten Vorstellungen zu betrachten. Die Reflexion vorhandener Handlungs- und Gestaltungsspielräume zur autonomen (Selbst-)Bestimmung ist dabei von entscheidender Bedeutung.
2.2 Selbstwert
2.2.1 Selbstwertbegriffe
2.2.1.1 Vielfalt der Selbstbegriffe
Bereits zu Zeiten der Vorsokratiker waren Fragen und Konzepte des „Selbst“ Thema der Philosophie und der beginnenden Wissenschaften (vgl.Gilich 1992,S.29ff). Bis zum heutigen Tag haben sich daraus vielfältige Ansätze und Betrachtungsperspektiven entwickelt. Einige wesentliche und grundlegende Überlegungen blieben über die Zeit dabei erhalten. Eine solche stellt die Trennung der Kategorien „Me“ und „I“ dar (vgl.James 1890, Mead 1932). Die damit verbundene wesentliche Fragestellung ist: Geht es um die Person, das Individuum als „Objekt der Erkenntnis“ (Me) oder wird der einzelne als „erkennendes Subjekt“(I) betrachtet (Filipp 1985,S.347; Epstein 1979,S.31)? Dies sind zwei ganz unterschiedliche Zieldimensionen in der Fragestellung, die jedoch auf einer philosophischen Ebene eine Synthese finden können, wenn man das „Selbst“ „immer als eine identitätsstiftende Größe innerhalb dialektischer Spannungsfelder“ (Gilich 1992,S.48) erkennt. „´Selbst` hat auf jeden Fall etwas mitIdentitätzu tun, ist offensichtlich weithin mit ihr deckungsgleich, denn der Inhalt des Begriffs differiert in gleicher Weise je nach dem, wie man ´Identität` umschreibt und variiert, außerdem je nach den unterschiedlichen Ebenen, auf denen Identitätssuche stattfindet“ (ebd.,S.47). Das bedeutet, daß man das „Selbst“ getrennt als passives Objekt einerseits oder aktive Größe, als handelndes Subjekt andererseits nicht trennen kann, sondern, daß beide Aspekte des „Selbst“ sich wechselseitig bedingen. „´SELBST` ist nicht nur das eine oder das andere, sondern bringt beide Positionen zueinander ins Verhältnis“(ebd.,S.48). Dennoch handelt es sich um zwei mögliche Betrachtungsperspektiven. Im ersten Fall wird von außen der Mensch als ein sich in einem ökologischen Kontext Verhaltender gesehen, wie beispielsweise im klassischen Behaviorismus. Der zweite Fall, der Mensch als erkennendes und handelndes Individuum, der sich seine Kognitionen und Emotionen einzigartig gestaltet, war bis vor wenigen Jahrzehnten kein Schwerpunkt empirischen oder naturwissenschaftlichen Interesses, sondern war eher Domäne der philosophischen und geisteswissenschaftlichen Betrachtungen. Diese zweite Perspektive, der Mensch als Gestalter eigener Kognitionen und Emotionen, eines eigenen „Selbstbildes“, einer „Selbsttheorie“ eines „Selbstkonzepts“ ist die weiterhin gewählte Position, wohlwissend, daß das Objekt der Betrachtung, das „Selbst“ in einer synthetischen Verbindung zum erkennenden Subjekt steht. Ziel ist es weiterhin unter dem Begriff „Selbstwert“ eine Synthese zu formulieren, welche die wesentlichsten Aspekte des „Selbst“-Begriffs, bezüglich seiner Bedeutung für die berufliche und betriebliche Weiterbildung, festlegen kann.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des „Selbst“-Begriffs ist die Trennung in einen inneren und einen äußeren Anteil des „Selbst“. Der äußere Anteil des „Selbst“ interagiert stark mit der Umwelt und befindet sich dadurch ständig in Entwicklung. Er ist sozusagen der dynamische, flexible und formbare Teil des „Selbst“. Demgegenüber steht ein innerer Anteil des „Selbst“. Er wird von äußeren Einflüssen kaum berührt und kann als relativ statischer und fester Bestandteil der Person, als Grundlage der Individualität gesehen werden. Dieser Anteil der Person wird häufig auch als „Kern des Ich“(Macha 1989,S.233ff) bezeichnet (vgl.Filipp 1985,S.348f).
An dieser Stelle seien noch die besonderen Probleme der empirischen Forschung mit den Theorien und Ansätzen des „Selbst als erkennendes Subjekt“ erwähnt. Ein Subjekt, das sich selbst erkennt, das sich selbst einen Wert beimißt, das nach eigenen Kognitionen Selbstkonzepte entwirft und die eigenen Kognitionen und Emotionen als einzigartig erlebt, das sich also weitgehend selbst konstruiert und definiert und sich somit als „´epistemologisches Subjekt`“(Filipp 1979,S.149) manifestiert, ist einer empirischen Wissenschaft, die messen und zählen will, bestenfalls indirekt zugänglich. Die üblichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität stoßen allzuschnell an ihre Grenzen, wenn es um sie Selbstsicht von Individuen geht. Dennoch liegt es auf der Hand, daß Kognitionen und Emotionen einer Person bezüglich der eigenen Wesenhaftigkeit, des eigenen Seins, des eigenen Werts wesentlichen Einfluß auf Denken, Handeln, Verhalten und Erleben, nicht nur des arbeitenden Menschen haben (vgl.ebd.,S.149).
2.2.1.2 Selbstwertgefühl
Sehr häufig geschieht eine unreflektierte Vermischung des kognitionspsychologischen Begriffs des „Selbstkonzepts“ mit dem Begriff „Selbstwertgefühl“. Es wird von einem positiven oder negativen „Selbstwertgefühl“ gesprochen, wobei damit aus Erleben und Handeln resultierende, selbstbezogene Kognitionen als Quelle von Emotionen gemeint sind. „Selbstwertgefühl“ und „Selbstkonzept“ werden hier als Begriffe häufig synonym verwandt (vgl.ebd.,S.147; Filipp 1985,S.348). Unter Selbstwert ist mehr als nur „Selbstwertgefühl“ zu verstehen. Selbstwert ist ein Wert, den sich die Person selbst zuschreibt, und der auch auf kognitiven und rationalen Überlegungen basiert. Andererseits korrespondiert mit dem Selbstwert, um den es in dieser Arbeit im wesentlichen gehen soll, auch ein Gefühl, bzw. Emotionen zur eigenen Person in einer bestimmten Situation. Beide Elemente haben ihre Berechtigung. Der Selbstwert ist mehr als die „Repräsentation der Person im Sinne einer affektiv getönten Wertschätzung“(Filipp 1985,S.348). Es ist daneben auch die Summe der kognitiven Selbstschemata, die als Form von bereichs- und situationsspezifischen Partialmodellen der eigenen Person einen Wert beimessen, je nach Handlungskontext unterschiedlich gewichtet (vgl.ebd.,S.348). Diese Vorstellung vom Selbstwert beruht auf dem Ansatz des „Selbstkonzept“ von Filipp: Demnach besteht das „Selbstkonzept“ einer Person aus den vielfältigen Selbstschemata, welche sich durch ihren thematischen Gehalt und die Art ihrer strukturellen Verknüpfung auszeichnen. Ein einzelnes Selbstschema ist eine bereichs- und situationsabhängige Modellvorstellung der eigenen Person. Diese Vorstellungen werde ich als Synthese in einem „kognitiv-emotionalen Schema“ verstärkt mit der Betrachtung der emotionalen Komponente selbstbezogener Kognitionen verbinden. Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, daß das „Selbstwertgefühl“ nur eine Betrachtungsmöglichkeit ist, bezüglich der erwähnten Vorstellung von Selbstwert; andere Perspektiven sind möglich und nötig um ein umfangreiches Bild zu erhalten. Nach Epstein, der diesen Ansatz teilt, stellt zwar „...Selbstwertschätzung die zentrale Komponente im Selbstsystem einer Person dar“(Epstein 1979,S.38), aber letztendlich ist das „Selbstwertgefühl“ nur eine von drei Funktionen der „Selbsttheorie“ einer Person. Epstein sieht im „Selbstwertgefühl“ einer Person den wesentlichsten - aber nicht den einzigen - Bestandteil des Funktionieren des „Selbstsystems“. Im Laufe der Kindheit entwickelt sich nach seiner Vorstellung aus einer ursprünglichen Lust-Unlust-Balance, die es zu optimieren gilt, eine „Selbsttheorie“, bei der der Mensch, analog einem naiven Wissenschaftler, Hypothesen, Postulate und Theorien über sich selbst entwickelt. Sobald das Kleinkind diese „Selbsttheorie“ entwickelt hat „...erhält das Selbstwertgefühl den größten Einfluß auf die individuelle Lust-Unlust-Balance. Man könnte argumentieren, daß die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls nicht eine dergrundlegenden Funktionendes Selbstsystems ist, sondern vielmehr der Optimierung der Lust-Unlust-Balance subsumiert werden sollte. Das Selbstwertgefühl ist jedoch so bedeutsam für das Funktionieren des Selbstsystems, daß man ihm ohne weiteres den Status einer unabhängigen Kategorie zuweisen kann“(ebd.,S.18). Dem „Selbstwertgefühl“ kommt somit eine grundlegende Funktion für die „Selbsttheorie“ zu. „Die Konstruktion von Selbsttheorien stellt keinen Zweck an sich dar, sondern liefert ein konzeptuelles Gerüst mit den Funktionen, Erfahrungsdaten zu assimilieren, die Lust-Unlust-Balance über vorhersehbare Zeiträume zu maximieren und das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten“(ebd.,S.17). Ist das „Selbstwertgefühl“ niedrig, so ist auch die „Selbsttheorie“ instabil und desorganisiert. Depressionen und Suizide sind die vielleicht sichtbarsten Folgen. Ist das „Selbstwertgefühl“ jedoch hoch, so handelt es sich um eine Person optimistischer Lebenseinstellung, die Druck und Angst adäquat zu bearbeiten weiß und entsprechende Erfahrungen in die jeweilige Selbsttheorie gut integrieren kann (vgl.ebd,S.19ff). Desweiteren führt ein hohes „Selbstwertgefühl“ auch dazu, daß andere Personen mit ihren jeweiligen „Selbsttheorien“ leichter akzeptiert werden können (vgl.ebd.,S.38). Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das „Selbstwertgefühl“ eine sehr wesentliche und grundlegende Komponente des „Selbst“ ist. Es repräsentiert den emotionalen Aspekt von „Selbsttheorie“ und „Selbstkonzept“. Im Laufe der kindlichen Entwicklung kommt seiner positiven Ausgestaltung ebensolche Bedeutung zu, wie dem Erwerb von Bindungssicherheit (vgl.Ainsworth et al.1974,S.99ff). Es zeigt sich hier jedoch auch, daß kognitive, rationale, motivationale und handlungstheoretische Aspekte des Selbstwertbegriffs ebenfalls berücksichtigt werden sollten.
2.2.1.3 Selbsttheorie
Wie bereits oben angedeutet wird beim Ansatz der „Selbsttheorie“ der Mensch als „naiver Wissenschaftler“ betrachtet. Es wird davon ausgegangen, daß jeder Mensch sich eine „Theorie von der Wirklichkeit“ (Epstein 1979,S.15) macht. Diese besteht aus drei Subtheorien: über die eigene Person („Selbsttheorie“), über die Außenwelt und über die Wechselwirkungen der beiden (vgl.ebd.,S16). Diese Subtheorien wiederum setzen sich zusammen aus Postulaten verschiedener Ordnung.
*Die im Text benutzte männliche Form bedeutet eine sprachliche Vereinfachung, keine geschlechtliche Diskriminierung. Mit Teilnehmer, Erwachsenenbildner, Weiterbildner, Personalentwickler etc. ist immer auch Teilnehmerin, Erwachsenenbildnerin, Weiterbildnerin, Personalentwicklerin etc. gemeint.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Päd. (Univ.) Ulrich Wagenpfeil (Autor:in), 1997, Erwerb von Selbstwert und Autonomie aus unterschiedlichen Perspektiven im Kontext der betrieblichen Weiterbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74530
Kostenlos Autor werden




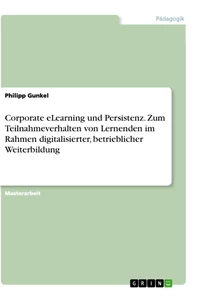















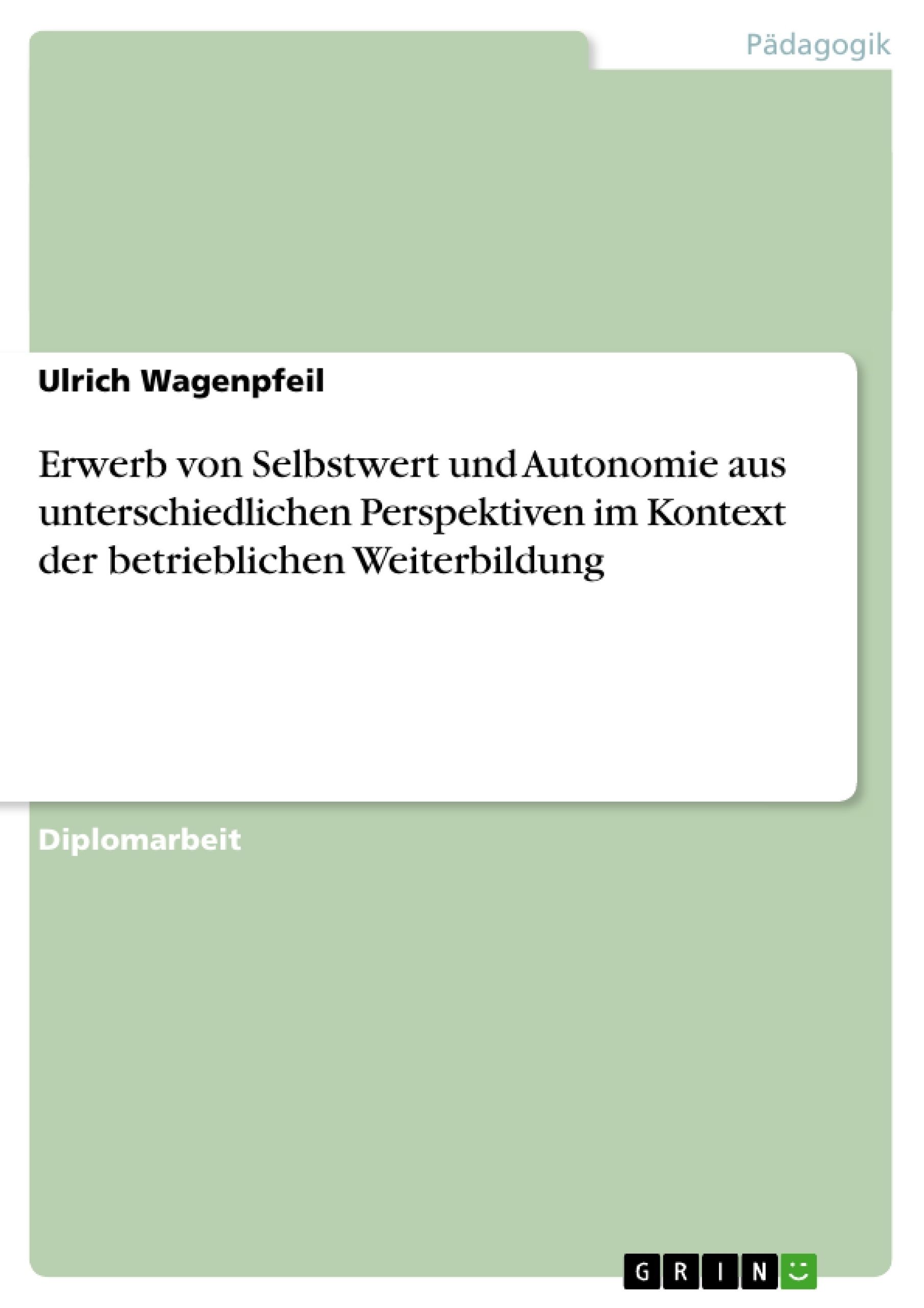

Kommentare