Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlegende Begriffe
2.1 Verhaltensauffälligkeit
2.1.1 Einteilungen
2.1.2 Häufigkeit
2.1.3 Ursachen und Handlungsmöglichkeiten
2.2 Gehörlosigkeit
2.2.1 Einteilungen
2.2.1.1 Nach Ausmaß
2.2.1.2 Nach Art
2.2.1.3 Nach Kulturzugehörigkeit
2.2.2 Häufigkeit
2.2.3 Ursachen
2.2.4 Förderungsmöglichkeiten
2.2.4.1 Medizinisch-technische Förderung
2.2.4.2 Auditiv-verbale Förderung
2.2.4.3 Bilinguale Förderung
2.3 Zusammenfassung
3. Formen
3.1 Häufigkeit von Auffälligkeiten bei Gehörlosen
3.1.1 Gehörlose mit Mehrfachbehinderungen
3.1.2 Gehörlose mit Verhaltensauffälligkeiten
3.2 Arten der Verhaltensauffälligkeiten
3.3 Zusammenfassung
4. Erklärungsansätze
4.1 Ansatzpunkt Kind
4.1.1 Was ist Sprache?
4.1.1.1 Die Bedeutung von Sprache
4.1.1.2 Der Aufbau von Sprache
4.1.2 Gehörlose Kinder und Lautsprache
4.1.2.1 Der Lautspracherwerb in seinem zeitlichen Verlauf
4.1.2.2 Schwierigkeiten des Lautspracherwerbs für das gehörlose Kind
4.1.3 Folgen der reduzierten Kommunikationsfähigkeit
4.2 Ansatzpunkt Eltern
4.2.1 Beziehungsstörung und mangelnde Akzeptanz
4.2.2 Ungünstiges Erziehungsverhalten
4.3 Ansatzpunkt Fachleute
4.3.1 Reduktion auf Kommunikation und Identität
4.3.2 Falsche Zuschreibung wegen ungenügender Kulturkenntnis
4.4 Zusammenfassung
5. Pädagogische Handlungsmöglichkeiten
5.1 Ansatzpunkt Kind
5.1.1 Adäquate Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen
5.1.2 Training sozialer Kompetenzen
5.1.2.1 Konstruktiver Umgang mit der Gehörlosigkeit
5.1.2.2 Kiosk-Projekt
5.1.3 Gehörlose Personen in den Erfahrungskontext einbeziehen
5.2 Ansatzpunkt Eltern
5.2.1 Akzeptanz fördern
5.2.2 Netzwerke bilden und Belastbarkeit stärken
5.2.2.1 Erfahrungsaustausch unter betroffenen Eltern
5.2.2.2 Familienentlastende Dienste (FED)
5.2.2.3 Kontakt zu gehörlosen Bezugspersonen herstellen
5.3 Ansatzpunkt Fachleute
5.3.1 Leiblichkeit er- und anerkennen
5.3.2 Interkulturalität als Norm des pädagogischen Handelns
5.4 Zusammenfassung
6. Schluss
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
Warum beschäftigt sich die vorliegende Arbeit gerade mit Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen? Die Entscheidung für dieses Thema lässt sich aus zwei Richtungen heraus begründen. Aus der Perspektive der Hörgeschädigtenpädagogik und der Verhaltensgestörtenpädagogik. Wissenschaftler und vor Allem Praktiker der ersten Disziplin stellen fest, dass gehörlose Kinder und Jugendliche immer häufiger auch zusätzliche Behinderungen haben. Zwar treten auch zusätzliche körperliche oder geistige Behinderungen oder Einschränkungen im Bereich Lernen auf. Im Besonderen sind mit den erwähnten Mehrfachbehinderungen aber Verhaltensauffälligkeiten gemeint. Es macht den Anschein, als würden diese bei Gehörlosen sogar häufiger auftreten, als in einer vergleichbaren Gruppe ohne Hörschädigung. Durch die veränderte Klientel entsteht für Lehrer, Erzieher und andere in diesem Bereich Tätige notwendigerweise auch eine veränderte Anforderung an das Arbeiten mit diesen Kindern und Jugendlichen.[1] Um diesem Anspruch zu genügen, informieren sie sich deswegen möglicherweise mittels Literaturrecherchen über Verhaltensauffälligkeiten oder durch den Kontakt mit Praktikern aus der Disziplin der Verhaltensgestörtenpädagogik. Eventuell wird von ihnen interdisziplinäres Arbeiten mit Vertretern beider Richtungen initialisiert.
Hier kann nun die Begründung des Themas aus der zweiten Richtung festgestellt werden. Denn wenn die Verhaltensgestörtenpädagogen mit der üblichen Vorgehensweise auf die verhaltensauffälligen und gehörlosen Kinder zugehen, werden sie oft feststellen, dass ihr Ansatz und ihre Methoden nicht greifen. Durch die erschwerte Kommunikation kann es häufig dazu kommen, dass sie erst gar keinen Zugang herstellen und somit auch keinerlei positiven Einfluss auf sie ausüben können.
„Bei der Lösung all dieser Probleme ist die Mitarbeit von verschiedenen Fachleuten unerläßlich: Psychiatern, Psychologen und Therapeuten verschiedenster Richtungen. Hierbei stellen sich neue Probleme und Schwierigkeiten ein, die sich für den Psychiater oder Psychologen ergeben, wenn er sich, meist bedrängt von vielen anderen Aufgaben, auch noch gehörloser Kinder annehmen soll. Da er nur schwer den sprachlichen Zugang finden und zudem die ihm vertrauten Therapieformen kaum anwenden kann, wird er zu oft die Aufgabe nicht vollständig lösen können.“ (Kunz 1988, S. 180).
Es wäre für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit mit dieser Klientel also notwendig, dass sich der Praktiker sowohl mit der Hörgeschädigten- als auch mit der Verhaltensgestörtenpädagogik beschäftigt und die jeweiligen Ansätze und Vorgehensweise miteinander abgleicht. Eine bloße Addition des Wissens und der Methoden beider Bereiche ist jedoch nicht fruchtbringend. Erst durch die Zusammenführung und Verschmelzung der jeweiligen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Grenzen beider Disziplinen – in Anbetracht und unter Abwägung der Möglichkeiten und Grenzen des sich vor dem Pädagogen befindlichen Kindes – könnte die volle Wirkung entfaltet werden.
In diesem Zusammenhang muss noch folgende Anmerkung getroffen werden. Der mittlerweile schon jahrzehntelang andauernde „Methodenstreit“ über die richtige Förderung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen innerhalb der Hörgeschädigtenpädagogik ist dem Autor durchaus bewusst. Die vorliegende Arbeit möchte sich jedoch weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Weder die Förderung mit Lautsprache noch die mit Gebärdensprache kann für die gesamte Klientel der Hörgeschädigtenpädagogik als „der“ richtige Weg bezeichnet und gefordert werden. Vielmehr ist es angebracht, genau diejenige Vorgehensweise zu favorisieren, die für das jeweilige Kind die optimale Ausnutzung seiner Möglichkeiten darstellt. Anders formuliert: Ressourcenorientiertes Denken und Handeln ist angebracht. Und das umso mehr, je weniger Ressourcen das Kind z. B. auf Grund einer Mehrfachbehinderung – oberflächlich betrachtet – zur Verfügung hat. Gerade dann ist es äußerst bedeutsam, sein Potenzial zu erkennen und voll auszuschöpfen.
Doch bevor in diesem Werk auf die Handlungsmöglichkeiten eingegangen wird, müssen erst einige Vorarbeiten geleistet werden. In Kapitel 2 werden zunächst die elementaren Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Gehörlosigkeit differenziert erläutert und in Abgrenzung zu verwandten Formulierungen festgelegt, damit im weiteren Verlauf dieser Arbeit klar ist, was bzw. wer gemeint ist. Wie später gezeigt wird, unterscheiden sich Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern allerdings qualitativ nicht von denen hörender Kinder. Für die Beschreibung der in dieser Arbeit anvisierten Zielgruppe ist deswegen vor Allem der Begriff Gehörlosigkeit bzw. die hinter diesem Begriff stehende Disziplin samt ihrer unterschiedlichsten Konzepte ausschlaggebend. Deswegen wird auf diesen Bereich ausführlich eingegangen. Zuvor wird jedoch die Bezeichnung Verhaltensauffälligkeit erläutert und gezeigt werden, was damit gemeint ist und warum im weiteren Verlauf dieser Arbeit gerade dieser Begriff und nicht ein vergleichbarer verwendet wird.
In Kapitel 3 wird anschließend untersucht, ob die erwähnte Beobachtung zur (steigenden) Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen überhaupt zutreffend ist. Hierzu werden die Ergebnisse einiger empirischer Studien zusammenfassend dargestellt. Außerdem wird gezeigt, ob es bestimmte gehörlosentypische Verhaltensauffälligkeiten gibt. Danach wird in Kapitel 4 analysiert, welche Erklärungen es für die Auffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen gibt. Es kann dabei nicht auf jeden einzelnen Ansatz zur Ursachenerklärung für jegliche Verhaltensauffälligkeit umfassend eingegangen werden.[2] Statt dessen werden spezielle Risikofaktoren für ihre Entstehung bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen gezeigt. Es wird hierbei aber nicht nur ein Aspekt untersucht und somit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Einem monokausalen Vorgehen und Denken soll dadurch vorgebeugt werden. Deswegen werden sowohl Risikofaktoren in der Person des Kindes, Ursachen, die sich eher den Eltern zuordnen lassen, als auch Bedingungen, auf Seiten der Fachleuten berücksichtigt. Hinterfragt werden also Umstände, die sich in der Person, den Eltern als unmittelbaren oder den Fachleuten als mittelbaren Bezugspersonen verorten lassen und die möglicherweise als Erklärung für die Verhaltensauffälligkeit des gehörlosen Kindes bzw. Jugendlichen fungieren können. Kapitel 5 stellt das für die meisten Leser wohl wichtigste Element dieser Arbeit dar. Hier wird gezeigt, welche Handlungsmöglichkeiten Pädagogen, Lehrer, Erzieher und auch Eltern haben, die mit verhaltensauffälligen, gehörlosen Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Hier wird einer vergleichbaren Struktur wie schon im Kapitel davor gefolgt. Es werden sowohl verschiedene Ansatzpunkte beleuchtet – das Kind selbst, seine Eltern und das es betreuende Fachpersonal – als auch verschiedene Stadien von Prävention bis Intervention angeführt. In Kapitel 6 werden die Kerngedanken dieser Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl eine theoretische Einführung in den Themenkomplex Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen, Angaben zu ihrer Häufigkeit und den Hintergründen zu präsentieren, als auch praktische Hinweise zu den unmittelbaren und mittelbaren Handlungsmöglichkeiten zu geben. Damit soll ein Beitrag zur besseren Förderung und damit auch Erziehung und Bildung gehörloser Kinder und Jugendlicher geleistet werden.[3]
2. Grundlegende Begriffe
Wie in geisteswissenschaftlichen Arbeiten üblich, muss zunächst eine Begriffsklärung durchgeführt werden. Es wird allerdings nicht möglich sein, eine umfassende und alle Faktoren einbeziehende Definition der beiden zentralen Begriffe zu erarbeiten und zu präsentieren, da selbst in Fachbüchern z. B. zum Thema Verhaltensgestörtenpädagogik keine von allen vollständig akzeptierte Definition enthalten ist. Statt dessen soll eine knappe Einführung in die Bedeutung des verwendeten Begriffes in Abgrenzung verwandter Formulierungen vorgenommen werden. Damit wird verhindert, dass Leser und Autor unterschiedliche Vorstellungen von den zentralen Begriffen haben und es in Folge dessen wegen differierender, gedanklicher Voraussetzungen zu einem falschen Verständnis der darauf folgenden Textpassagen kommt. Vielmehr wird erarbeitet, mit welcher Bedeutung die Begriffe im Weiteren verwendet werden. Dadurch wird eine gemeinsame Basis geschaffen, die die Grundlage für die weiteren Erörterungen bildet.
2.1 Verhaltensauffälligkeit
2.1.1 Einteilungen
Einteilungen von Verhaltensauffälligkeiten können auf der Grundlage verschiedener Kriterien durchgeführt werden. Eine erste Hilfe hierzu und auch zum Verständnis der Bedeutung dieses Begriffs ist die getrennte Untersuchung der beiden Worte, aus denen er zusammengesetzt wird.[4] Es geht um ein Verhalten, das auffällig ist. Unter Verhalten wird in einem engeren Sinne das nach außen in Erscheinung tretende Agieren einer Person verstanden, das von anderen wahrgenommen werden kann. Dieses sehr enge Verständnis von Verhalten ist im Kontext der Verhaltensgestörtenpädagogik jedoch keineswegs ausreichend. Denn zusätzlich zu dieser ersten Komponente des sichtbaren Handelns wird in einem weiteren Verständnis von Verhalten darunter auch das Erleben und Wahrnehmen von Emotionen verstanden, was von außenstehenden Personen nur sehr schwer wahrgenommen werden kann. Und die kognitive Komponente spielt ebenfalls eine Rolle, da es auch um die Bewertung – als einem kognitiven Akt – von Wahrnehmungen, Eindrücken, Emotionen und Handlungsmöglichkeiten geht. Und auch bei diesen Verhaltensarten im weiteren Sinn kann es zu Auffälligkeiten kommen. Die Nennung dieser drei Komponenten des Verhaltens gibt Hinweise auf eine erste, häufig vollzogene Einteilung von Verhaltensauffälligkeiten in einen emotionalen und einen sozialen Bereich. Diese Einteilung geschieht auf der Grundlage der Zuordnung des Verhaltens, Erlebens und Verarbeitens auf die zwei genannten Bereiche. Diese Unterteilung folgt den Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 10.3.2000, wobei der kognitive Bereich, zumindest der Begrifflichkeit nach, außen vor gelassen wird. Zum Beispiel wird die emotionale Regulationsfähigkeit und das Selbstwertgefühl dem emotionalen Bereich zugeschrieben, während Kommunikationsfähigkeit, Sachlichkeit und Toleranz dem sozialen Bereich angehören.[5]
Eine andere Einteilung, die sich von der gerade angeführten in Bezug auf die jeweils zugeteilten Erscheinungsformen inhaltlich kaum unterscheidet, ist die in externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten. Die klassisch externalsierenden Auffälligkeiten agieren nach außen so wie z. B. aggressives, impulsives und hyperaktives Verhalten. Diese sind somit im Großen und Ganzen mit Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Bereich, die klassisch internalisierenden Auffälligkeiten sind dagegen mit dem emotionalen Bereich so gut wie gleichzusetzen. Beispiele hierfür sind „ein negatives Selbstkonzept und ein geringer Selbstwert, starke Ängstlichkeit oder auch Depressivität“ (Stein 2006, S. 28). Die Kriterien für die bisher genannten Einteilungen basieren auf der Grundlage der Erscheinungsform der Verhaltensauffälligkeit.
Eine Alternative hierzu nennt Bach, wenn er entsprechend dem Außmaß – unabhängig vom Bereich – der Auffälligkeit auch verschiedene Bezeichnungen zur genauen Beschreibung und einem exakteren Verständnis der gemeinten vorschlägt.[6] Er nennt die vier Begriffe Pseudoverhaltensstörung, Verhaltensstörung, Verhaltensbehinderung und Verhaltensbeeinträchtigung. Pseudoverhaltensstörungen sind an sich gar keine Verhaltensstörungen, da die Zuschreibung auf der Grundlage falscher Bewertungssmaßstäbe erfolgte. Auch abweichendes Verhalten „das zufällig, aufgrund äußeren Zwangs, direkt durch motorische, sensorielle Schäden, durch Schäden der Sprechwerkezeuge, durch intellektuelle Schäden oder durch akute organische Erkrankungen bedingt ist,“ zählt er zu den Pseudobeeinträchtigungen (Bach 1989, S. 8, Hervorhebung im Original). Mit Verhaltensstörung meint er verläßlich beobachtbares, wiederholt auftretendes, abweichendes Verhalten, dass auf Grund seiner häufigen Durchführung auf eine entsprechende „individuale Bereitschaft schließen“ lässt (Bach 1989, S. 7, Hervorhebung im Original). Verhaltensbehinderungen grenzt er von diesen ab, indem er damit extremes Verhalten in Bezug auf die Länge des Zeitraums, in der es auftritt und ein gravierendes Ausmaß in Umfang und Grad bezeichnet. Und der Begriff Verhaltensbeeinträchtigung ist von ihm letztlich als ein Überbegriff gemeint, unter dem die anderen subsumiert werden können. Es bleibt anzumerken, dass die genannten Einteilungen trotz ihrer Nützlichkeit bezüglich der Strukturierung der Erscheinungsformen des verhaltensauffälligen Kindes immer auch eine gewisse Unsicherheit offen lassen, da Abgrenzungen häufig schwer fallen und deswegen unmöglich alle Phänomene einem Bereich eindeutig zugeordnet werden können.
Der zweite Teil des Wortes Verhaltensauffälligkeit deutet ebenfalls wichtige Aspekte an. Zunächst einmal gibt es eine Person, der das Verhalten auffällt. Dabei gibt es für die Person, der ein Verhalten auffällt bzw. auffallen soll, verschiedene Schwierigkeitsgrade, die genannten Komponenten tatsächlich zu bemerken. Denn das körperliche Handeln des Kindes, etwas zu werfen, zu sagen oder zu schreien, fällt Außenstehenden natürlich wesentlich leichter auf, als die Wahrnehmungen und Emotionen des Kindes oder seine (auch unbewusste) Bewertung der momentanen Situation. Diese abgestuften Herausforderungen an den Pädagogen, vom eindeutig sicht- oder hörbaren Handeln, über die möglicherweise durch Mimik ausgedrückten Emotionen, bis hin zu den unsichtbaren Bewertungen die im Kopf des Kindes stattfinden, gehören jedoch zu den unbedingt zu bewältigenden Aufgabenstellungen eines Pädagogen, der feststellen will, ob das Kind als verhaltensauffällig zu bezeichnen ist oder nicht. D. h. zudem, Verhaltensauffälligkeiten kommen als solche immer nur im sozialen Kontext zum Tragen, auch wenn hierzu nicht unbedingt eine andere Person (körperlich) anwesend sein muss. Außerdem fällt der Person dieses Verhalten auf, weil es von dem üblichen Verhalten abhebt. Es wird also – zumeist unbewusst – eine Norm zugrundegelegt, die dafür maßgeblich ist, ob ein Verhalten als auffällig bezeichnet wird oder nicht.[7] In diesem Zusammenhang müssen mehrere Arten von Normen angeführt werden, die als Bewertungsgrundlage fungieren können:
soziokulturelle Normen
explizite Normen (Gesetze und Vorschriften)
statistische Normen (empirische Daten oder individuelle Erfahrung)
Normen, die sich aus Überlegungen wissenschaftlicher Ansätze ergeben
Der Aspekt der Normabhängigkeit der Bewertung einer Handlung als Verhaltensauffälligkeit ist ein zentrales Moment, weil hierdurch die Relativität der Zuschreibung deutlich wird.[8] Für die Einteilung von Verhaltensauffälligkeiten werden häufig medizinische Kategorien bzw. Klassifikationssysteme wie das ICD-10 oder das DSM-IV herangezogen. Allerdings sind diese Klassifikationen nicht universal gültig, sondern nur ein System von Kategorien oder Normen, welches als Grundlage einer Bewertung dienen kann.
Es gibt – wie bereits gezeigt – neben der Bezeichnung Verhaltensauffälligkeit noch weitere Begriffe mit einer ähnlichen oder evtl. auch deckungsgleichen Bedeutung, wobei hier nicht der richtige Ort ist, sie alle zu nennen und zu diskutieren.[9] Sehr weit verbreitet sind unter Anderem die Bezeichnungen „verhaltensgestört“ und „psychosozial beeinträchtigt/gestört“. Der zweite Begriff wird z. B. in der Psychologie herangezogen, um förderliche oder gefährdende Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Kindes zu beschreiben. Und die Bezeichnung „verhaltensgestört“ ist in der Alltagssprache aber auch in der Wissenschaft sehr geläufig, wenn auch in letzterer mit einer anderen Konnotation. So impliziert dieser Begriff, dass eine Verhaltensstörung nicht nur beim Kind zu verorten ist, sondern dass das als gestört bewertete Verhalten des Kindes in Wirklichkeit nur wie ein Signal für eine dahinter liegende Störung fungiert. „Die Verhaltensstörung wird als Symptom des gestörten Systems gefaßt und nicht am Individuum festgemacht“, schreibt Dietze dazu (1998, S. 144).
Dennoch wurde bisher und wird auch im Weiteren hauptsächlich der Begriff „verhaltensauffällig“ verwendet. Das hat zwei Gründe: Zum einen sind „… Begriffe wie »Verhaltensauffälligkeiten« oder der »Verhaltensstörungen« insbesondere für Kinder und Jugendliche reserviert…“ (Schad, Stein 2005, S. 419). In diesem Sinne ist auch das Thema dieser Arbeit schon als eine Einschränkung der hier zu untersuchenden Zielgruppe zu verstehen. Zum Anderen wurde vorhin bereits ausgeführt, dass bei der Bezeichnung „verhaltensauffällig“ immer schon eine bewertende Person und das Vorhandensein einer Norm oder Regel mitgedacht werden. Wenn also im Folgenden von „Verhaltensauffälligkeiten“ die Rede ist, dann sollen zugleich diese beiden Aspekte ins Bewusstsein kommen und auch weiterhin präsent bleiben. Es folgen nun ein paar kurze Anmerkungen zur Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.
2.1.2 Häufigkeit
Entsprechend der angeführten Einteilungsmöglichkeit in externalisierende bzw, soziale und in internalisierende bzw. emotionale Verhaltensauffälligkeiten und der damit einhergehenden unterschiedlichen Schwierigkeit ihrer Feststellung wäre es zu erwarten, dass z. B. aggressive und hyperaktive Störungen wesentlich häufiger auftreten bzw. bemerkt werden als Störungen aus dem internalisierenden bzw. emotionalen Bereich. Als Standardarbeit zur Erforschung der Prävalenz wird immer wieder die von Ihle, Esser durchgeführte Metastudie zitiert (vgl. 2002). Sie untersuchten eine ganze Reihe bis dahin vorliegender Erhebungen und filterten methodisch unsauber geführte Arbeiten und auch solche, die keine genaue Vergleichbarkeit ermöglichten, aus und kamen bei dem Vergleich der 19 übriggebliebenen Untersuchungen zu überraschenden Ergebnissen. Unterteilt nach den einzelnen Arten von Verhaltensauffälligkeiten kamen sie zu folgenden Prävalenzraten:
Angststörungen 10,4 %
„dissoziale“ Störungen 7,5 %
depressive und hyperkinetische Störungen jeweils 4,4 %
Interessant ist hier, dass eben nicht eine externalisierende (oder soziale) Verhaltensauffälligkeit an erster Stelle steht, sondern eine an sich schwerer festzustellende internalisierende wie die Angststörung. Und als durchschnittliche Auftretenshäufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten konnten sie eine Rate von 18 % ermitteln. Und bezüglich der Geschlechterverteilung einzelner Arten von Verhaltensauffälligkeiten stellten sie fest, dass Hyperkinetische Störungen, Dissoziales Verhalten und Alkohol- und Drogenmissbrauch signifikant häufiger bei Jungen auftraten, wohingegen Essstörungen und psychosomatische Störungen bei Mädchen häufiger vorkamen. Keinen geschlechtsspezifischen Unterschied gab es allerdings bei den meist eher Mädchen zugeschriebenen Auffälligkeiten wie Angst oder Depressionen. Welche Ursachen die jeweiligen Verhaltensauffälligkeiten hatten, wurde von ihnen aber nicht untersucht.
2.1.3 Ursachen und Handlungsmöglichkeiten
Auf alle Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten in einem kurzen Unterkapitel einzugehen, ist so gut wie unmöglich. Es gibt beinahe ein Dutzend Theorien zu ihrer Erklärung, auf die in der Literatur eingegangen wird und von der jede an sich schon den Rahmen einer eigenen Arbeit verlangte.[10] Das gleiche trifft auf die Handlungsmöglichkeiten zu. In Bezug auf die Möglichkeiten der Förderung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher können kaum allgemeine Aussagen getroffen werden, da die vorgeschlagenen Handlungsansätze zum Einen von der speziellen Art der Verhaltensauffälligkeit und zum Anderen auch von der zugrunde gelegten Theorie zur Erklärung der Auffälligkeit abhängig sind. An dieser Stelle kann deswegen nicht viel mehr gemacht werden, als die unterschiedlichen Theorien zu benennen und auf die entsprechende Literatur zu verweisen. Das Gleiche gilt für die Handlungsmöglichkeiten und die unten stehenden Theorien, aus denen Programme und Trainingsmaßnahmen manchmal auch ohne die explizite Nennung der zugrunde gelegten Theorie abgeleitet wurden.
Psychoanalyse
Individualpsychologie
Lernpsychologie
Selbstkonzept-Theorie nach Rogers
Bindungstheorie
Theorie der Selbst- und Handlungsregulation
Systemtheorie
Subkultur und Kulturkonflikt
Theorien des differentiellen Lernens
Anomietheorien
Labeling Approach
Biophysisch-medizinische Theorien
Ein weiterer Grund für diese möglicherweise verkürzt erscheinende Vorgehensweise ist die bereits angeführte Tatsache, dass sich Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen qualitativ nicht von denen Hörender unterscheiden.[11] D. h., dass die Verhaltensauffälligkeiten gehörloser Kinder grundsätzlich auch die gleichen Ursachen haben können wie die Auffälligkeiten hörender Kinder. Gleiches gilt vermutlich auch für die Handlungsmöglichkeiten, wobei dieser Aspekt später noch näher untersucht werden muss. Allerdings gibt spezielle Risikofaktoren im Kontext der Gehörlosigkeit für das Entstehen von Verhaltensauffälligkeiten. Auf diese wird in Kap. 4 gesondert eingegangen. Da somit der Begriff Verhaltensauffälligkeit erläutert und die Verwendung gerade dieser Bezeichnung begründet wurde, kommen wir zum zweiten grundlegenden Begriff.
2.2 Gehörlosigkeit
Auch die Bedeutung (bzw. die Bedeutungen) des Begriffs „Gehörlosigkeit“ wird umrissen und die in dieser Arbeit anvisierte Zielgruppe beschrieben. Es soll kurz angeführt werden, welche Möglichkeiten der Einteilung es in diesem Kontext gibt und warum in den späteren Kapiteln nicht von Hörgeschädigten oder andersartig Bezeichneten gesprochen wird. Auch wird gezeigt, wie häufig Hörschädigungen im Allgemeinen auftreten und darauf aufbauend werden Zahlen zur Prävalenz von Gehörlosigkeit bei Kinder und Jugendlichen genannt. Außerdem wird ansatzweise auf die Ursachen von Gehörlosigkeit und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Förderung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen eingegangen.[12]
2.2.1 Einteilungen
Zu Beginn dieser Ausführungen ist festzuhalten, dass es nicht den Gehörlosen oder die Hörgeschädigte gibt. Bei Menschen mit einer Schädigung des Hörvermögens handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe: „Darüber hinaus weist praktisch jeder Hörgeschädigte hinsichtlich seines Hörschadens und seiner kommunikativen Situation individuelle Unterschiede und Auffälligkeiten auf“ (Leonhardt 2002, S. 20). Auch Hintermair, Lehmann-Tremmel bestätigten diesen Umstand: „Wichtig ist uns, dass wahrgenommen wird, dass die Population der hörgeschädigten Kinder eine äußerst heterogene Gruppe ist und entsprechend dieser Heterogenität mit pädagogischer Vielfalt zu reagieren ist. Pädagogik hat die vornehmliche Aufgabe, differenziert auf die Anforderungen der Gegenwart zu reagieren!“ (2003a, S. 198). Um dieser Heterogenität gerecht zu werden, ist es wichtig, die unterschiedlichen Formen von Hörschädigungen und ihre Auswirkungen auf das Leben der von ihnen betroffenen Personen in ihren unterschiedlichen Varianten kennen zu lernen. Es ist hier nicht möglich, alle Arten darzustellen, gerade weil es so eine Vielzahl von Störungs- und Entwicklungsverläufen gibt. Jedoch sollten Pädagogen diese Heterogenität immer im Hinterkopf behalten, um nicht einem schematischen Denken und Handeln auf Grund von Typisierungen zu verfallen.
Der bereits mehrfach angeführte Begriff „hörgeschädigt“ stellt eine übergeordnete Bezeichnung für alle Menschen mit einer Hörschädigung dar. Ebenfalls werden häufig die Bezeichnungen schwerhörig, taub, und gehörlos verwendet. Ihre Bedeutung kann je nach dem verwendeten Zusammenhang variieren. Die Untergliederung oder Einteilung kann nämlich an Hand verschiedener Maßstäbe erfolgen. Die hierfür meistens zu Grunde gelegten Maßstäbe basieren auf medizinischen Bewertungskriterien, nämlich dem Ausmaß und der Art der Hörschädigung, in Kombination mit dem Zeitpunkt des Eintritts der Hörschädigung. Ob es für eine pädagogische Disziplin wie die Hörgeschädigtenpädagogik allerdings sinnvoll ist, sich unreflektiert an Kategorien aus einer fremden Disziplin wie der Medizin zu orientieren und dadurch ihr implizites Menschenbild zu übernehmen und aus diesem die Therapie- und Handlungsmöglichkeiten abzuleiten, wird später thematisiert.[13] Vorab kann jedoch angemerkt werden, dass aus diesem Grund auch eine dritte Möglichkeit der Einteilung anzuführen ist: die nach der (von der betroffenen Person selbst gewählten) Kulturzugehörigkeit.
2.2.1.1 Nach Ausmaß
Eine erste Einteilung der Hörgeschädigten kann nach dem Ausmaß der Hörschädigung, als der in Dezibel (dB) gemessenen Höhe des Hörverlustes, vorgenommen werden. Zur besseren Übersicht sind die unterschiedlichen Grade in Tabelle 1 dargestellt. Es gibt also verschiedene Grade der Ausprägung einer Schwerhörigkeit. Was früher als Taubheit oder Gehörlosigkeit bezeichnet wurde, wird mittlerweile jedoch Resthörigkeit genannt, da ein hundertprozentiger, vollständiger Verlust des Gehörs nur bei ca. 2 % gehörloser Personen der Fall ist.[14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Ausmaß des Hörverlustes (in Anlehnung an Leonhardt 2002, S. 54)
Es ist jedoch anzumerken, dass eine Einteilung allein nach dem Ausmaß des Hörschadens keinesfalls ausreichend ist. Zum Einen, weil die tatsächlichen Auswirkungen des Hörschadens, selbst beim gleichen Ausmaß des Hörverlusts in dB, sich in Bezug auf die Qualität des Hörens sehr stark voneinander unterscheiden. Zum Anderen, bzw. daraus folgend, ist die Möglichkeit zum Hören und Verstehen von Lautsprache auch bei der gleichen Höhe der Hörverlusts ganz unterschiedlich ausgeprägt. Dies wird auch durch die Untersuchung der verschiedenen Arten von Hörschäden deutlich, der zweiten Möglichkeit der Einteilung hörgeschädigter Personen.
2.2.1.2 Nach Art
Dabei ist grundsätzlich nach der Lokalisierung der Hörschädigung zu unterscheiden. Es gibt periphere Hörschäden und zentrale. Periphere Hörschäden haben ihre Ursache im Außen-, Mittel- oder Innenohr, wobei zentrale Hörschäden ihre Ursache in einer Funktionsschädigung des Hörnervs oder der Verarbeitungsregionen im Gehirn haben. Zuerst wird hier auf die peripheren Hörschäden eingegangen.
Die verschiedenen Arten der Hörschädigung sind, wie bereits weiter oben genannt, Schwerhörigkeit, Taubheit, und Gehörlosigkeit. Als schwerhörig werden alle Personen bezeichnet, die eine nach „ Art und … Grad des Hörverlustes“ stark variierende Schädigung des Hörvermögens haben, aber dennoch in der Lage sind, Lautsprache – unter Umständen mit Hörhilfen – zu verstehen (Kaul 2006, S. 57, Hervorhebung im Original) . Der Hörschaden kann eine der drei folgenden Formen annehmen: Erstens kann es zu einer Schallleitungsschwerhörigkeit (oder Mittelohrschwerhörigkeit) kommen, bei der „eine Funktionsstörung des Gehörgangs, des Trommelfells oder des Mittelohres“ vorliegt (Leonhardt 2002, S. 50). Die Folge davon ist ein auf allen Frequenzen gesenktes Hörvermögen, was einem leiseren Hören gleichkommt. Diese Form der Schwerhörigkeit hat jedoch kaum eine sonderpädagogische Bedeutung, da ihre Auswirkungen durch medizinische Therapiemöglichkeiten – möglicherweise sogar ohne technische Hörhilfen – soweit reduziert werden können, dass das Hörvermögen für die Aufnahme und das Verstehen von Sprache und anderer Klänge im sozialen Kontakt ausreicht.
Die zweite Form ist die Schallempfindungsschwerhörigkeit, auch sensorineurale Schwerhörigkeit genannt, die es in zwei Unterformen gibt: „die sensorische (auch cochleäre) Schwerhörigkeit und die neurale (auch retrocochleäre) Schwerhörigkeit,… die auch gleichzeitig auftreten“ können (Leonhardt 2002, S. 51). Anders als die Schallleitungsschwerhörigkeit ist diese zweite Form der Schwerhörigkeit sehr wohl von sonderpädagogischer Bedeutung. Denn hier ist das Hören aller Frequenzen nicht gleichmäßig reduziert, sondern die Wahrnehmung der höheren Frequenzen wesentlich stärker eingeschränkt. Gerade diese sind aber für das Verstehen von Lautsprache entscheidend, so dass sie nur noch verzerrt gehört und somit sehr schlecht verstanden werden kann. „Eine einfache lineare Verstärkung der Intensität, z. B. durch lautes Sprechen, bietet dem von dieser Art betroffenen Schwerhörigen keine Hilfe. Hörgeräte können eine Hilfe sein“ (Leonhardt 2002, S. 52). Die dritte Form der Schwerhörigkeit ist vielmehr eine Kombination der ersten beiden. Sie wird synonym mit den folgenden Begriffen bezeichnet: kombinierte Schwerhörigkeit, kombinierte Schallleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit oder kombinierte Mittelohr- und Innenohrschwerhörigkeit. „Die Schallempfindungsschwerhörigkeit dominiert jedoch und bestimmt das Wahrnehmungssgeschehen“ (Leonhardt 2002, S. 53).
Bei allen drei genannten Formen der Schwerhörigkeit ist es für das weitere Leben, die Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen, das Empfinden und das psychosoziale Wohlbefinden dieser Personen von höchster Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt die Hörschädigung auftritt. Eine Schwerhörigkeit kann noch vor dem Erwerb der (Laut-)Sprache eintreten. Die betreffende Person wird dann als frühschwerhörig bezeichnet. Wenn sie ab einem Altern von ungefähr 3 oder 4 Jahren eintritt, also nach dem Abschluss des Spracherwerbs, als spätschwerhörig.[15] Der Zeitpunkt ist deswegen von so immenser Wichtigkeit, da bei Frühschwerhörigen der Erwerb von Lautsprache und die damit verbundene Kommunikationsfähigkeit einen wesentlich anderen Charakter hat, als bei Spätschwerhörigen. Soviel zur Kennzeichnung und den unterschiedlichen Formen von Schwerhörigkeit.
Die zweite Art der Hörschädigung ist die Taubheit. Bei ihr handelt es sich genau genommen nicht um eine eigene Art der Hörschädigung, sondern vielmehr um eine hochgradige Schallempfindungsschwerhörigkeit (der zweitgenannten Form von Schwerhörigkeit). Jedoch ist die Auswirkung, wie im Zitat beschrieben, eine wesentlich andere und gravierendere, so dass die Verwendung eines gesonderten Begriffs zur eindeutgen Kennzeichnung des gemeinten Personenkreises durchaus angebracht ist. Die Taubheit „tritt plötzlich oder nach einem progredienten Verlauf einer Schwerhörigkeit ein“ (Kaul 2006, S. 58). Im Besonderen werden Personen als ertaubt bezeichnet, deren Hörschädigung nach dem Spracherwerb auftritt, die also postlingual ertaubt sind. „Sie verfügen somit über eine normale Lautsprachkompetenz und sind als hörende Menschen sozialisiert. […] Darüber hinaus kann auch die Sprachproduktion beeinträchtigt sein, […] da die Eigenkontrolle des Sprechvorgangs über das Gehör fortgefallen ist“ (Kaul 2006, S. 58).
Wenn die Ertaubung nicht nach dem Spracherwerb, sondern prälingual eintritt, spricht man dagegen von Gehörlosigkeit, der dritten zu erwähnenden Art. Jedoch sind die Folgen einer prälingualen Ertaubung im Gegensatz zu den oben beschriebenen der postlingualen Ertaubung von einer ganz anderen Art. Leonhardt beschreibt die Auswirkungen der Gehörlosigkeit in Bezug auf die sprachliche Entwicklung folgendermaßen: „dass Lautsprache … bei Verwendung elektronischer Hörhilfen nur unter bestimmten Bedingungen, d. h. durch spezifische Förderung und Erziehung, erlernt werden kann“ (2002, S. 53–54). Dass die eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeit auf sprachlichem Gebiet nicht die einzige Auswirkung der Gehörlosigkeit sein wird, liegt dabei sehr nahe. An anderer Stelle heißt es, die davon betroffenen Kinder „können selbst mit Hörhilfen ein mögliches Restgehör für die Sprachwahrnehmung nicht nutzen. Hierdurch wird der Spracherwerb, die soziale und kognitive Entwicklung der Kinder wesentlich beeinflusst“ (Kaul 2006, S. 59). Für Praktiker und Praktikerinnen in der Gehörlosen- und der Hörgeschädigtenpädagogik ist diese Aussage sicher nichts neues.[16]
Neben all diesen peripheren Hörstörungen gibt es aber auch noch die zentralen Hörstörungen. Hinter diesem Begriff steht eine Vielzahl von Störungen der „zentrale(n) Verarbeitung und Wahrnehmung des akustischen Signals“ (Kaul 2006, S. 55), wobei es bis jetzt weder zu der übergeordneten Bezeichnung noch zu den ihr zuzuordnenden Untertypen einen übereinstimmenden Konsens gibt. So werden schon alleine zur Kennzeichung dieses Störungsbildes unzählige Begriffe verwendet.[17] Im deutschsprachigen Raum scheint sich inzwischen aber die Bezeichnung Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) durchzusetzen, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie verwendet wird. In einem von ihr herausgegebenen Konsenspapier wird diese Störung folgendermaßen definiert und beschrieben:
„Eine Auditive Verarbeitungs- und/oder Wahrnehmungsstörung (AVWS) liegt vor, wenn bei normalem Tonaudiogramm zentrale Prozesse des Hörens gestört sind. Zentrale Prozesse des Hörens ermöglichen u. a. die vorbewusste und bewusste Analyse, Differenzierung und Identifikation von Zeit-, Frequenz- und Intensitätsveränderungen akustischer oder auditivsprachlicher Signale sowie Prozesse der binauralen Interaktion (z. B. zur Geräuschlokalisation, Lateralisation, Störgeräuschbefreiung, Summation) und der dichotischen Verarbeitung“ (Nickisch et al. 2006, S. 7–8).
Die AVWS kann auf Grund der unterschiedlichen Prozesse, die dabei beeinträchtigt sein können, auch sehr unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Typische Erscheinungsbilder sind jedoch
„… Störungen der Erkennung und Unterscheidung von Schallreizen, des Richtungshörens, der Interaktion zwischen beiden Ohren (z. B. bei der Störgeräuschunterdrückung) führen. Dies kann u. a. eine gestörte Schallquellenlokalisation, eine eingeschränkte Spracherkennung im Störgeräusch und/oder Probleme beim Sprachverstehen in Gruppensituationen im Alltag zur Folge haben. Weiterhin können AVWS als Einschränkungen beim Verstehen von veränderten Sprachsignalen (z. B. zeitkomprimierter Sprache oder unvollständigen Sprachsignalen, z. B. bei Störgeräuschen), im Verstehen gesprochener Instruktionen oder in der Unterscheidung, der Identifizierung bzw. der Synthese und Analyse von Sprachlauten in Erscheinung treten“ (Nickisch et al. 2006, S. 10).
Da die Auswirkungen einer Behinderung wie der Hörschädigung, sowohl der peripheren wie auch der zentralen, sich aber nicht nur auf einer rein körperlichen und intrapersonalen Ebene abspielen, sondern jegliche Behinderung auch Auswirkungen auf die Interaktion mit anderen Menschen, also auf die Teilhabe am sozialen Leben hat, ist eine reine Orientierung an medizinischen Kriterien und Einteilungen für eine pädagogische Disziplin nicht angebracht.[18] Aus diesem Grund ist es auch notwendig, eine dritte Einteilung zu erörtern, die sich an der von den betroffenen Personen selbst gewählten Kulturzugehörigkeit zu orientieren sucht.
2.2.1.3 Nach Kulturzugehörigkeit
In der Alltagssprache wird von Personen, die noch nie mit gehörlosen Menschen zu tun hatten, meist die Bezeichnung taubstumm oder taub verwendet.[19] Diese Begriffe werden jedoch seit einigen Jahren (nicht nur) von Gehörlosen immer weniger gern benutzt. Hier schwingen negative Konnotationen mit, da zum Einen der Begriff „taub“ einen etymologischen Hintergrund hat, der von Fengler sehr gut beschrieben wird:
„Das Wort taub geht etymologisch mit vielen anderen zusammen auf die indogermanische Wortgruppe Dunst im Sinne von benebelt, verwirrt, betäubt zurück. Im Althochdeutschen heißt toub gehörlos, unempfindlich, ungereimt, stumpf(sinnig), dumm, im Mittelhochdeutschen toup nicht-hörend, nichts empfindend, nichts denkend, unsinnig, abgestorben, dürr. Das Gotische daufs heißt taub, verstockt; im zeitgenössischen Schwedischen bedeutet döv taub, im Englischen deaf taub und schwerhörig“ (1990, S. 13, Hervorhebung im Original).
Diese Begriffe und die dahinter stehenden Bedeutungen zeichnen ein Bild von gehörlosen Personen, das „nicht sehr schmeichelhaft ist und der die Hörgeschädigten vermutlich einen Teil ihrer langen Unterdrückung verdanken“ (Fengler 1990, S. 13).[20] Zum Anderen assoziiert man mit dem Wort „taubstumm“ automatisch eine Stummheit oder Sprachlosigkeit. Dass dies aber nicht mit der Realität übereinstimmt, dass gehörlose Personen keineswegs sprachlos sind, wird (nicht nur) durch die Gebärdensprache eindeutig sichtbar. Diese beiden Begründungslinien sprechen dafür, die Bezeichnungen „taub“ und „taubstumm“ nicht mehr zu verwenden. Als einzige Ausnahme sollte höchstens noch der Personenkreis der Menschen mit einem postlingualen Hörverlust mit dem Begriff „ertaubt“ klassifiziert werden. Dadurch wird nämlich angezeigt, dass sie ihr Gehör erst im Verlauf ihres Lebens z. B. als Erwachsene verloren haben. Um allerdings auch hier ein falsches Bild zu vermeiden, könnte statt dessen auch der bereits von Kaul verwendete und hier angeführte Begriff „spätschwerhörig“ verwendet werden.[21]
Die Bezeichnung schwerhörig kann aus der Perspektive der Kulturorientierung für all jene Personen verwendet werden, die sich eher dem Hören und der lautsprachlichen Kommunikation zugehörig fühlen. Dass bei der Benennung von Personenkreisen im Kontext der Hörgeschädigtenpädagogik allerdings nicht lediglich auf das Hörvermögen geachtet werden sollte, proklamiert auch Kaul: „Vor diesem Hintergrund (der Differenziertheit der Klientel; F. A.) ist es sinnvoll, neben der Unterscheidung anhand des Hörstatus (gehörlos, ertaubt, schwerhörig) den Kommunikationsstatus stärker zu berücksichtigen“ (2006, S. 60). Er schlägt vor, Personen, die sich eher in einem hörenden Umfeld bewegen, „lautsprachlich kommunizierende Menschen“ zu nennen (2006, S. 60, Hervorhebung im Original). Personen dagegen, die sich eher im Umfeld anderer gehörloser Menschen, also innerhalb der Gebärdensprachgemeinschaft bewegen, sollten „gebärdensprachlich kommunizierende Menschen“ genannt werden (2006, S. 60, Hervorhebung im Original). Mit diesen beiden Bezeichnungen würde zusätzlich zur Loslösung von rein medizinischen Kategorien zugleich auch eine Loslösung von einer defizitorientierten Sicht möglich.[22] Auch Leonhardt ist der Meinung, dass eine solche Unterscheidung medizinischer und pädagogischer Kritierien notwendig ist:
„Die Auffassung darüber, ob jemand beispielsweise „gehörlos“ oder „schwerhörig“ ist, sind aus der Sicht der Medizin, aus der Sicht der Pädagogik und aus der Sicht der Betroffenen oft abweichend: Aus der Sicht der Medizin wird jede Funktionsstörung der Hörorgans erfasst, während sich die Pädagogik auf solche beschränkt, die die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beeinträchtigen und damit soziale Auswirkungen auf den Betroffenen haben“ (2002, S. 22).
Diese Differenzierung der Beurteilungskriterien und der Maßstäbe für eine Klassifikation müsste dem Pädagogen im Umgang mit hörgeschädigten Kindern immer präsent sein.
Die von Kaul angeführte Unterscheidung stützt sich dabei zum Teil auf eine Verwendung von Begrifflichkeiten, wie sie von Padden, Humphries vorgenommen wurde. Genau genommen beziehen sie sich jedoch nur auf die Gruppe gehörloser Personen und versuchen die Orientierung an der Kulturzugehörigkeit im Gegensatz zum medizinischen Befund durch das Begriffspaar „Deaf“ und „deaf“ kenntlich zu machen: „Wir verwenden den Begriff “taub”, wenn es um den audiologischen Befund des Nicht-Hören-Könnens geht, “gehörlos” dagegen, wenn wir eine bestimmte Gruppe tauber Menschen meinen, die eine gemeinsame Sprache – Amerikanische Gebärdensprache (ASL) – und Kultur haben“ (1991, S. 10). In einer Fußnote ergänzt die Übersetzerin diesen Satz mit der folgenden Anmerkung: „ungefähre Entsprechung im Amerikanischen: ‘Deaf’ für ‘gehörlos’ und ‘deaf’ für ‘taub’“ (1991, S. 10). Als Einführung in das Thema, was unter der genannten Gehörlosenkultur zu verstehen sei, kann das eben zitierte Werk – das sich allerdings auf den Amerikanischen Raum bezieht – von Padden, Humphries genannt werden. Auch die Zeitschrift Das Zeichen enthält immer wieder Artikel, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Jedoch ist noch in Bezug auf die Übersetzung anzumerken, dass das Begriffspaar „gehörlos“ – „taub“ zur Kennzeichnung der Kulturzugehörigkeit aus weiter oben bereits angeführten Gründen nicht ohne Probleme verwendet werden kann.
Um den Bereich der Einteilung hörgeschädigter Personen zusammenzufassen, ist das folgende Zitat von Leonhardt hilfreich:
„Aus diesen beiden Ansätzen (Selbstbestimmung und -definition der Gehörlosen und Wissen über die Reifung des zentralen Hörsystems; F. A.) heraus wird deutlich, dass klassische Einteilungen in „gehörlos“ und „schwerhörig“ zu hinterfragen sind. Hinzu kommt, dass Entwicklungsverläufe nicht mit dem Hörstatus korrelieren: So können bei gleicher Art und annähernd gleichem Ausmaß eines Hörschadens völlig unterschiedliche Entwicklungsverläufe bei einzelnen Kindern zu beobachten sein“ (2002, S. 27).
Trotz der hier getroffenen Aussagen über die Einteilungsmöglichkeiten sollte der (Hörgeschädigten-)Pädagoge im Umgang mit dem hörgeschädigten Kind oder Jugendlichen also keinesfalls ein verfrühtes Urteil über seinen voraussichtlichen Entwicklungsverlauf fällen. Leonhardt schreibt dazu:
„Dringend anzumerken ist, dass die Einteilung nach dem Ausmaß (und der Form, F. A.) des Hörverlustes nur von begrenztem Wert ist, da die individuellen Auswirkungen und Folgeerscheinungen auch bei etwa gleichem Hörverlust und gleicher Art (bzw. Form, F. A.) des Hörschadens sehr unterschiedlich sein können. Daher sollten nach der Diagnose nicht voreilig Prognosen über mögliche Entwicklungsverläufe betroffener Kinder gegeben werden“ (2002, S. 54).
2.2.2 Häufigkeit
Daten zur Prävalenz von hörgeschädigten Personen im Allgemeinen und speziell von gehörlosen Kindern und Jugendlichen als eine zweifache Einschränkung in Bezug auf Hörgrad und Alter der betroffenen Personen sind leider nicht so umfassend vorhanden wie vermutet. Zudem widersprechen sich die Zahlen teilweise sogar. Bei den unterschiedlichen Einteilungsmöglichkeiten und Kriterien zur Klassifikation ist das aber nicht verwunderlich. Dennoch wird hier ein kurzer Überblick über die momentane Datenlage gegeben, von denen „viele epidemiologische Aussagen auf Einschätzungen und Interpretationen der wenigen Untersuchungen sowie auf Übertragungen aus anderen Ländern“ basieren (Kaul 2006, S. 56). Dadurch soll zumindest ein grobes, jedoch keinesfalls absolut gültiges Bild zur Häufigkeit von Menschen mit Hörschäden und speziell von gehörlosen Kindern in Deutschland vor Augen geführt werden. Erst werden Zahlen zur Häufigkeit aller Arten von Hörschädigungen vorgestellt, dann zur Häufigkeit von Gehörlosigkeit. Anschließend werden die gleichen Schritte in Bezug auf Kinder und Jugendliche vorgenommen.
Der Deutsche Schwerhörigenbund e. V. berichtet von einer Gesamtzahl an Menschen über 14 Jahren mit einer Hörschädigung in Höhe von 13 Millionen im Jahre 1999 und geht von einer jährlichen Zunahme von 0,3 Millionen aus.[23] Daraus folgt für das Jahr 2007 eine Gesamtzahl von 15,4 Millionen Menschen mit einer Hörschädigung, was mit ca. „19 % der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre“ sicher den größten Teil der Menschen mit einer Behinderung in Deutschland ausmacht (2007). Hier ist jedoch anzumerken, dass von dieser Gesamtzahl ca. 50 % nur leichtgradig schwerhörig sind und deswegen für eine sonderpädagogische Förderung kaum oder gar nicht in Frage kommen. Damit stellt sich die Frage, wie viele Menschen mit Gehörlosigkeit oder hochgradiger Schwerhörigkeit es gibt. Krüger berichtet von Studien aus den USA: „Als ‚deaf‘ (gehörlos und hochgradig schwerhörig, so daß sprachliche Kommunikation allein über das Gehör nicht möglich ist) werden rund 2 Millionen (knapp 1 %) eingestuft“ (1991, S. 26). Diesen sehr hohen Wert relativiert er durch seine Angaben zur Häufigkeit in Deutschland, da er hier von 60.000 gehörlosen Menschen spricht.[24] Leonhardt bezieht sich dagegen auf Angaben von Wisotzki aus dem Jahr 1998, der von 80.000 gehörlosen Menschen ausgeht.[25] Im Gegensatz zur Häufigkeit von Personen mit Gehörlosigkeit von beinahe 1 % der Bevölkerung in den USA scheint dieser massive Hörschaden in Deutschland nur ca. 0,1 % zu betreffen.
Wie sieht es aber mit Daten zur Häufigkeit von Hörschädigungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland aus? Kaul berichtet von Schätzungen aus dem Jahr 1994, nach denen „ca. 4-6 % aller Kinder eine leicht- bis mittelgradige Hörschädigung haben“ (2006, S. 56). In absoluten Zahlen wären das also um die 500.000 Kinder. Gleichzeitig erwähnt er aber auch Untersuchungen aus dem Jahr 2000, bei denen die Prävalenz für die gleiche Gruppe mit nur bis zu 0,06 % angegeben wird, also maximal 5.000 Kindern mit Hörschäden.[26] Auch die Zahlen zur Prävalenz gehörloser Kinder und Jugendlicher gehen stark auseinander. Nach Kaul sind „die Angaben zu hochgradig schwerhörigen und gehörlosen Kindern … vergleichbar konstant bei ca. 0,01 – 0,02 %“ (2006, S. 56). Leonhardt führt dagegen sieben Untersuchungen an, bei denen die Daten zwischen 0,03 und 0,05 % liegen.[27] Wenn all diese Untersuchungen zusammengefasst werden, so ist bezüglich hochgradiger Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen von einer Häufigkeit von 0,01 – 0,05 % auszugehen.
Dennoch machen die angeführten Zahlen deutlich, dass es bis jetzt keine stichfesten und eindeutigen Informationen zur Prävalenz von Hörschädigungen im Allgemeinen oder speziell von Gehörlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen gibt. Dennoch konnte auf Grund der hier präsentierten Untersuchungen eine Bandbreite zur Auftretenshäufigkeit von Gehörlosigkeit bei Kindern und Jugendlichen gezeigt werden. Wie sieht es aber mit den Gründen für eine Hörschädigung aus? Gibt es hierzu klare und allgemeingültige Informationen?
2.2.3 Ursachen
Damit komme ich zu dem Bereich der Ursachen von Hörschädigungen, zu denen die Gehörlosigkeit zählt. Da diese Arbeit jedoch weder eine medizinische, noch ein umfassendes Lexikon ist, kann hier unmöglich auf jede einzelne Ursache eingegangen werden. Hierbei ist zugleich anzumerken, dass beinahe die Hälfte aller Hörschädigungen eintreten, ohne dass eine exakte Ursache diagnostiziert werden kann. Leonhardt spricht von 40 % aller Diagnosestellungen und bezieht sich dabei auf Arbeiten von Biesalski und Collo aus dem Jahr 1991, wohingegen Kaul sogar von 45 % spricht und sich dabei auf neuere Zahlen von Gross aus dem Jahr 2002 stützt.[28] Dennoch soll an dieser Stelle zumindest ein grober Überblick über die möglichen Ursachen einer Hörschädigung vermittelt werden. Auf die Darstellung verschiedener Einteilungsmöglichkeiten wird dabei verzichtet.[29] Statt dessen wird hier die gängigste Variante der Einteilung verschiedener Ursachen vorgestellt, die nach dem Zeitpunkt des Eintritts der Hörschädigung. Dabei werden drei Zeitabschnitte voneinander unterschieden: pränatal, perinatal und postnatal. Die Hörschädigung tritt entweder vor der Geburt auf oder während bzw. kurz vor oder kurz nach der Entbindung oder auch erst nach der Geburt. So könnte ein pränataler Hörschaden entweder erblich bedingt oder auch die Folge einer Erkankung an Röteln der Mutter während der Schwangerschaft sein.[30]
Leonhardt hat für diese Variante der Einteilung eine übersichtliche Tabelle mit einigen Beispielen für die Ursachen erstellt (vgl. Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Mögliche Ursachen eines Hörschadens in der klassischen Einteilung (aus: Leonhardt 2002, S. 60)
Eine weitere Erörterung der Ursachen wird an dieser Stelle nicht vorgenommen, da dies an anderer Stelle bereits ausführlich behandelt wurde (siehe Fußnote 29). Es soll nun jedoch kurz gezeigt werden, welche Behandlungs- bzw. Therapie- und Frühfördermöglichkeiten im Umgang mit Gehörlosen angezeigt sind oder zumindest – falls sie im pädagogischen Alltag so noch nicht durchgeführt werden – gefordert werden.
2.2.4 Förderungsmöglichkeiten
Die Behandlung gehörloser Kinder und Jugendlicher ist eine Kooperation, um nicht zu sagen, eine Mischung medizinisch-technischer Interventionsmöglichkeiten und der auditiv-verbalen Therapie (früher als lautsprachorientierte Methode bezeichnet) und in Abgrenzung von den beiden der bilingualen Förderung. Denn ein besonderes Merkmal innerhalb der Gehörlosenpädagogik ist der seit mehr als 100 Jahren andauernde Streit über die Richtigkeit des jeweiligen Weges. Dieser „Methodenstreit“ macht dabei einen Großteil der erstellten Literatur über die Förderung(-smöglichkeiten) aus. Aus diesem Grund soll er weiter unten kurz angerissen, gleichzeitig aber auch Kritik dazu geäußert werden.
2.2.4.1 Medizinisch-technische Förderung
Als erstes besteht die Möglichkeit, eine Hörschädigung nach ihrer Diagnose mit Hörhilfen zu versorgen. Dies können sowohl Hörgeräte der verschiedensten Art sein, als auch die Einpflanzung eines Cochlea-Implantats (CI).[31] Bei Hörgeräten sind die Hinter-dem-Ohr- Hörgeräte (HdO-Geräte) und die In-dem-Ohr-Hörgeräte (IdO-Geräte) die bekanntesten und am weitesten verbreiteten Arten. HdO-Geräte befinden sich hinter der Ohrmuschel und haben mehrere Vorteile. Auf Grund ihrer Bauform und der Größe hat man hier die meisten Möglichkeiten für die spezifisch auf die Bedürfnisse des hörgeschädigten Kindes zugeschnittene Ausstattung und Einstellung. Außerdem können an sie auch sehr leicht externe Höranlagen, z. B. im Schulunterricht, angeschlossen werden. Schon bei einem einzelnen HdO-Gerät ist wegen der Schallaufnahme am Kopf durch leichte Kopfdrehungen die Richtung der Schallquelle grob festzustellen. Mit zwei HdO-Geräte ist die Ortung der Schallquelle dagegen besser möglich.
IdO-Geräte haben prinzipiell die gleichen technischen Merkmale. Sie sind jedoch wesentlich kleiner und werden entweder nur im Gehörgang getragen (Kanal-Gerät) oder befinden sich in der Ohrmuschel und ragen noch in den Gehörgang hinein (Concha-Gerät).[32] Der Vorteil der geringeren Sichtbarkeit wird durch das erschwerte Einsetzen und Entfernen und die leicht erschwerte Bedienbarkeit auf Grund der geringen Größe relativiert. Jedoch gibt es auch die Möglichkeit der Einstellung mittels einer Fernbedienung. Zwei weitere Nachteile gegenüber HdO-Geräten: „Aufgrund der Nähe des Mikrophons im Ohr (besteht) eine akustische Rückkopplungsgefahr …, die sich als unangenehmes Pfeifen (sog. Rückkopplungspfeifen) äußert“ (Leonhardt 2002, S. 130). Außerdem sind sie „für hochgradig Schwerhörige kaum geeignet, weil sie nicht die nötige Verstärkungsleistung haben“ (Eisenberg 2001, S. 67).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Schematische Darstellung der Versorgung mit einem CI (aus: Leonhardt 2002, S. 142)
Die dritte Hörhilfe, die hier kurz geschildert werden soll, ist das Cochlea-Implantat (CI). Es besteht genau genommen aus mehreren Elementen, die aber in einen internen (implantierten) und einen externen Teil gegliedert werden können (vgl. Abbildung 2). Im Mikrophon werden die akustischen Signale aufgenommen und an den Sprachprozessor weitergeleitet, der sich bei neueren CI-Modellen, vergleichbar mit HdO-Geräten, direkt hinter der Ohrmuschel befindet. Hier werden die Signale in elektrische Impulse umgewandelt und an die Sendespule (den Überträger) zurückgeschickt. Von hier werden sie durch die Haut an die implantierte Empfangsspule (den Cochleastimulator) übertragen und von dort dann durch den Elektrodenträger an die Haarzellen in der Cochlea weitergeleitet. Die Haarzellen werden durch die elektrischen Impulse gereizt und senden diese Signale dann über den Hörnerv an das Gehirn.
Für Personen, bei denen selbst leistungsstarke Hörgeräte keinen Vorteil für das Hörvermögen (von Sprache) haben, kann das CI angebracht sein, da es eine wesentlich bessere Leistung entfaltet. Voraussetzung für die Versorgung mit einem CI ist jedoch die Funktionsfähigkeit von Hörnerv und dem zentralen Hörsystem. Allerdings ist noch anzumerken, dass selbst durch ein CI kein „normales“ (Sprach-)Hörvermögen ermöglicht wird: „Man muss davon ausgehen, dass die Informationen, die auditiv wahrgenommen werden, reduziert sind.“ (Kaul 2006, S. 59). Außerdem hängt die Hör- und Sprachentwicklung nach einer Implantation von mehreren Faktoren ab, so dass keineswegs in jedem Fall eine vollständige Rehabilitation zu erwarten ist.
Das Ziel der medizinisch-technischen Förderung ist es, das Hörvermögen des gehörlosen Kindes so weit wie möglich dem normalen Zustand anzugleichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird erstens gefordert, die Versorgung mit Hörhilfen so früh wie möglich nach der Diagnose der Hörschädigung einzuleiten. Zweitens soll die Diagnose selbst auch so früh wie möglich gestellt werden. Untersuchungen zeigen, dass sie bislang zumeist erst in einem Alter von drei oder vier Jahren festgestellt werden. Für die Zukunft anvisiert wird eine Diagnose spätestens im ersten Lebensjahr, idealerweise sogar schon innerhalb der ersten sechs Monate nach der Geburt. Um diese frühe Diagnose zu ermöglichen, wird von manchen ein generelles und verbindliches Neugeborenenhörscreening gefordert.[33] Bundesweit ist es momentan jedoch noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern nur in vereinzelten Bundesländern. Oder es wird in manchen Regionen z. B. im Rahmen einer Studie angeboten.[34] Das Ziel der medizinisch-technischen Förderung ist die Ermöglichung der Integration der gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen in die (hörende) Gesellschaft und ihre Befähigung zur selbstständigen und unabhängigen Kontaktaufnahme und -aufrechterhaltung mit hörenden Menschen in der Lautsprache. Jedoch ist zu der rein medizinisch-technischen Förderung anzumerken, dass sie alleine nicht in der Lage ist die gehörlosen Kinder zu der Erreichung dieser Zieles zu befähigen: „Ein Hörgerät kann zwar die akustischen Wahrnehmung verbessern, aber ein normales Hören ist in vielen Fällen nicht möglich“ (Kaul 2006, S. 63). Deswegen wird sie meist in einer kaum zu trennenden Kooperation mit der nächsten Art der Förderung durchgeführt.
2.2.4.2 Auditiv-verbale Förderung
Die auditiv-verbale Förderung ist nicht zu verwechseln mit der lautsprachorientierten Methode. Die lautsprachorientierte Methode der Förderung gehörloser Kinder basiert zwar auch auf der Annahme, dass die Lautsprache elementar für das weitere Leben und die Möglichkeiten der sozialen Interaktion ist. Der Weg der Förderung ist bei ihr jedoch gänzlich anders ausgerichtet. Denn hier steht die Hörerziehung, die Entwicklung von Sprechfertigkeiten (z. B. der Artikulation) im Vordergrund vor einer natürlich Sprachumgebung und -förderung des gehörlosen Kindes.[35] Die auditiv-verbale Förderung dagegen „erlaubt es dem Kind, unsere Stimme auch dann wahrzunehmen, die Sprache zu verstehen, wenn es uns nicht ansieht, sondern in seinem Spiel fortfährt, auf Zurufe zu antworten, ohne dass es vorher berührt werden musste“ (Schmid-Giovannini 2004, S. 235). Es wird also versucht, dem Kind ein „altersgemäßes Spiel- und Sozialverhalten“ zu ermöglichen (Schmid-Giovannini 2004, S. 235). Zusätzlich zur Wahrnehmung von Sprache und dem intuitiv-natürlichen Umgang der Eltern mit dem gehörlosen Kind ermuntert die auditiv-verbale Förderung auch zum bewussten Umgang mit Alltagsgeräuschen:[36] Ihre Wahrnehmung soll dem Kind ermöglicht, ihre Bedeutung gezeigt und das Geräusch benannt werden. Im Gegensatz zu dem Geräusch einer Rassel oder einer Trommel zur reinen Stimulation des Gehörs meint Schmid-Giovannini damit im Besonderen
„Geräusche, die für das Kind etwas bedeuten, eine Signalwirkung haben […]. Das Rauschen des Wassers aber kündet Vergnügen an (wegen des bevorstehenden Badens; Anmerkung F. A.). Das Läuten ruft die Mutter weg, doch ihre Stimme ist noch zu hören. Das vorfahrende Auto bringt den Vater – oder die Mutter – nach Hause. Schritte bedeuten, dass jemand kommt … usw.“ (2004, S. 237).
Durch diese Art der Förderung soll sowohl das natürliche und emotional positiv besetzte Verhältnis zwischen Eltern und dem gehörlosen Kind bewahrt, als auch gleichzeitig ein natürlicher Umgang mit Geräuschen und der Lautsprache gegenüber dem hörgeschädigten Kind gefördert werden. Sie vermeidet dadurch einen künstlichen und erzwungenen Umgang mit der Lautsprache, wodurch der natürliche Lautspracherwerb eher gehemmt als gefördert würde.
Die Frühförderung gewinnt im Rahmen der auditiv-verbalen Förderung dabei immer mehr an Bedeutung.[37] Denn wenn, wie weiter oben angeführt, die Diagnose einer Hörschädigung bereits in den ersten Lebensmonaten erfolgt bzw. erfolgen soll und auch die medizinisch-technische Versorgung bereits zu diesem Zeitpunkt eintritt, so muss auch unmittelbar im Anschluss an die Diagnosestellung die auditiv-verbale Förderung des hörgeschädigten Kindes beginnen. Diese Aussage wird durch Erkenntnisse über den Prozess der Reifung des Gehirns gestützt. Für das Hör- und Verständnisvermögen ist bekannterweise neben der Funktionen des Ohres und seiner Bestandteile auch die Verarbeitung der empfangenen Signale im Gehirn notwendig. Seine Struktur und Organisation, also auch die für das Verarbeiten der akustischen Signale notwendigen Regionen, ist mit der Geburt jedoch noch lange nicht abgeschlossen, sondern ergibt sich erst im Laufe des Wachstums des Neugeborenen. Dabei scheint es für die unterschiedlichen Funktionsbereiche des Gehirns, z. B. für die Verarbeitung der Signale aus den fünf Sinnen, Dispositionen zu geben, die sich, sofern die jeweiligen Sinne Reizen ausgesetzt sind und die entsprechenden Hirnregionen somit verwendet werden, entwickeln. Falls ein Funktionsbereich aber wegen fehlender eingehender Signale – etwa wegen einer Hörschädigung – nicht genutzt wird, so entwickelt sich dieser nicht entsprechend seiner Disposition, sondern wird von Funktionsbereichen, die z. B. für die Verarbeitung von Signalen anderer Sinne zuständig sind, mitbenutzt.
Für die Entwicklung dieser Funktionsbereiche im Gehirn sind so genannte kritische Perioden relevant – die bis jetzt weder von ihrem Zeitraum, noch von ihrer Reihenfolge genau definiert und bestimmt sind. Leonhardt beruft sich aber auf Untersuchungen von Klinke (1995), der vermutet, dass sie zeitlich mit der ersten und zweiten Lallphase zusammenfallen, also zwischen dem 2. und 5. und dem 6. und 8. Lebensmonat einzuordnen sind.[38] Wenn innerhalb einer solchen kritischen Periode allerdings keine akustischen Reize eintreffen, verfällt die Möglichkeit der Entwicklung dieser Hirnregionen zur Wahrnehmung und Verarbeitung dieser Signale. Und wenn diese Möglichkeit einmal vertan ist, kann sie im späteren Verlauf des Lebens auch nicht wieder aufgetan werden. Durch diesen Sachverhalt wird deutlich, wie immens wichtig schon früh nach der Geburt – wenn nicht sogar schon vorher – die omnisensorielle, alle Sinne umfassende Förderung des Kleinkinds ist. Denn wenn z. B. ein Kind auf Grund seiner Hörschädigung keine akustischen Reize mehr wahrnimmt, es also wegen fehlender medizinisch-technischer und auditiv-verbaler Förderung auch nicht einmal mehr seine Hörreste zu nutzen in der Lage ist, dann könnten die zur Disposition stehenden Funktionsbereiche im Gehirn nicht entsprechend genutzt werden.
Um jedoch kein falsches Bild zu vermitteln, ist hier noch anzumerken, dass dieser Umstand keineswegs den gesamten Funktionsbereich betrifft, sondern lediglich ca. ein Viertel. Denn nach von Leonhardt angeführten Untersuchungen sind „70 – 75 % dieser Schaltstellen … genetisch programmiert. Sie entstehen unabhängig von funktioneller Belastung oder Aktivität des betreffenden neuronalen Systems, also unabhängig davon, ob allgemeine Umweltreize oder umweltspezifische Reize auf die betreffende Nervenzelle einwirken“ (2002, S. 178). Ein verspätetes Einsetzen der medizinisch-technischen und auditiv-verbalen Förderung würde also nicht zu einem einhundertprozentigen Verlust der entsprechenden Funktionsbereiche im Gehirn führen.
Und was ebenfalls kritisch anzumerken ist: Auch wenn viele Einrichtungen für Hörgeschädigte und Gehörlose und deren Mitarbeiter davon ausgehen, eine auditiv-verbale Förderung durchzuführen oder dies sogar explizit behaupten, ist dies häufig nicht der Fall:
„Auch gab es zahlreiche Schulen für Gehörlose (inzwischen fast überall zu Schulen für Hörgeschädigte umstrukturiert), die angaben, hörgerichtet zu arbeiten. Deren Vorgehensweisen waren jedoch keineswegs mit den von AVI (Auditory-Verbal-International) festgelegten Grundprinzipien und den methodischen Grundsätzen eines auditiv-verbalen Arbeitens identisch“ (Leonhardt 2002, S. 82).
Sie scheinen sich statt dessen vielmehr an Vorschlägen und Prinzipien der lautsprachorientierten Methode auszurichten, was allerdings die oben genannten Nachteile zur Folge haben kann. Um die Förderung des gehörlosen Kindes jedoch noch stärker an seinen natürlichen Voraussetzungen zu orientieren, versuchen manche Pädagogen einen ganz anderen Weg zu gehen.
2.2.4.3 Bilinguale Förderung
Erste Ansätze zum Einsatz von Gebärden – noch nicht von der Gebärdensprache – in der Förderung gehörloser Kinder wurden bereits ab Ende der 1970er Jahre in Hamburg von Prillwitz, Wisch und Wudtke gemacht.[39] So beschreibt Wisch etwa ein Modellprojekt und dessen wissenschaftliche Betreuung.[40] Anschließend kommt er nach einer Beschreibung der Rahmenbedingungen für die Zweisprachigkeit Gehörloser in Erziehung und Bildung für die gesamte Gehörlosenpädagogik letztendlich zu dem Schluss:
„ Wie können wir die zweisprachige Erziehung Gehörloser in Gebärdensprache U N D Lautsprache sinnvoll und unseren pädagogischen Zielen entsprechend effektiv gestalten? Die Zeit eines kategorischen pauschalen Ablehnens der Gebärdensprache in Erziehung und Bildung Gehörloser muß endlich genauso vorbei sein wie der unfruchtbare antithetische Gegensatz: Lautsprache o d e r Gebärdensprache“ (1990, S. 245, Hervorhebung im Original).
Diese Forderung wurde lange Zeit sehr kritisch betrachtet, der „Methodenstreit“ setzte sich auch hier fort. Denn es wurde immer wieder argumentiert, dass eine Förderung in bzw. mit Gebärdensprache oder gar der bloße Kontakt der gehörlosen Kinder negative, wenn nicht gar katastrophale, Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Hörwahrnehmung und die Entwicklung der Lautsprache habe. In Folge dessen ist die Realisierung bilingualer Ansätze auch heute noch nicht an allen Schulen und Einrichtungen für Hörgeschädigte durchgeführt. Diese Aussage ist jedoch durch keinerlei Studien belegbar.[41] Auch deswegen häuften sich im Laufe der Zeit die Modellprojekte zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache (auch) im Unterricht und nehmen inzwischen teilweise nicht mehr nur den Status eines Modellversuchs ein.[42] Bevor jedoch beispielhaft die Situation an Förderzentren für Schüler mit dem Schwerpunkt Hören in Bayern beschrieben wird, werden noch einige grundlegende Aussagen zur bilingualen Förderung getroffen.
Bei einem bilingualen Spracherwerb kann nach dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung zwischen drei Formen unterschieden werden: Simultaner Erstspracherwerb, sukzessiver früher und sukzessiver später Zweitspracherwerb.[43] Der simultane Erstspracherwerb findet statt, wenn beide Sprachen gleichzeitig von Geburt an, bzw. bis zum 4. Lebensjahr im natürlichen Umfeld des Kindes verwendet werden. Bei dem sukzessiv frühen Zweitspracherwerb wird die „zweite Sprache … zeitlich versetzt, im Alter zwischen 5 und 10 Jahren erwor-ben“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 14) und beim sukzessiv späten ab dem 10. Lebensjahr. Vertreter des bilingualen Ansatzes in der Förderung gehörloser Kinder gehen davon aus, dass eine unabdingbare Voraussetzung für die gelingende Entwicklung des gehörlosen Kindes zu einem psychosozial gesunden, kommunikativ kompetenten und selbstständigen Menschen eine in der Förderung und im Umgang der Eltern mit dem Kind ihm angemessene und seinen Sinnen angepasste Sprache ist. Als Muttersprache würde ein gehörloses Kind also sowohl die Lautsprache lernen als auch die Gebärdensprache – idealerweise in der Form des simultanen Erstspracherwerbs und schon ab der (frühen) Diagnose der Hörschädigung. Dies ist nur dann möglich, wenn sich die gehörlosen oder hörenden Eltern bewusst für die bilinguale und bikulturelle Erziehung entscheiden.
Allerdings ist anzumerken, dass lediglich ca. 10 % der gehörlosen Kinder auch gehörlose Eltern haben und die meisten der hörenden Eltern für die Erziehung ihres Kindes auch eine Förderung (und damit Sprache) bevorzugen, die sie selbst bereits beherrschen.[44] Teilweise wird die Entscheidung aber nach einigen Monaten oder Jahren revidiert, da „… der Lautspracherwerb nicht befriedigend verlaufen ist und deshalb die Gebärdensprache als frühe Zweitsprache (etwa ab dem Kindergarten, in der SVE) angeboten wird“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 16). Spätestens jetzt sollte von den erziehenden und unterrichtenden Personen in Elternhaus und Schule die Gebärdensprache verwendet und in letzterer Institution sogar direkt Gegenstand des Unterrichts sein.
Im Unterschied zum sukzessiv bilingualen Erwerb einer zweiten Lautsprache ist im Fall gehörloser Kinder mit einem zeitversetzten Zweitspracherwerb der Gebärdensprache davon auszugehen, dass
„hier die Lautsprache keine hinreichende Stützfunktion übernehmen (wird) wie allgemein für den frühen Zweitspracherwerb belegt. Die leichter zugängliche Gebärdensprache wird meist rascher erworben. Gleichzeitig erhält sie dadurch eine Stützfunktion für den Erwerb der Lautsprache und zugunsten der Persönlichkeitsentwicklung. Sie wird zur Basissprache.“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 16).
Kommen wir nun nach einigen allgemeinen und vorbereitenden Erklärungen über bilinguale Förderung zu ihrer konkreten Durchführung.
Beispielhaft für die Möglichkeiten und die Art der Durchführung wird hier kurz die Lage an Einrichtungen für Hörgeschädigte in Bayern skizziert. Hänel stellt fest, dass seit dem Schuljahr 1999/2000 „Förderzentren mit dem Schwerpunkt Hören in der Grund- und Hauptschulstufe für bilingualen Unterricht in Laut- und Gebärdensprache geöffnet“ sind (2005, S. 238). Seit einigen Jahren gibt es dafür auch spezielle Lehrpläne, so z. B. seit 2003 einen für die Grundschulstufe innerhalb dieser Förderzentren, welcher nun kurz geschildert wird.[45] Hier wird die Schülerschaft nicht mehr wie früher nach dem Kriterium Hörvermögen in schwerhörige und gehörlose Klassen bzw. Gruppen unterteilt, sondern entsprechend der von Kaul vorgeschlagenen und hier bereits beschriebenen Sprachorientierung (2006, S. 60). Es wird dabei nach insgesamt fünf so genannten Sprachlerngruppen differenziert:[46]
1. Hörgerichtete, geöffnete Sprachlerngruppe (SpLG I)
2. Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe (SpLG II)
3. Hörsehgerichtete Sprachlerngruppe mit manuellen Hilfen (SpLG III)
4. Bilinguale Sprachlerngruppe (SpLG IV)
5. Sprachlerngruppe für Schülerinnen und Schüler mit zentral-auditiven Verarbeitungsstörungen (SpLG V)[47]
Diese Sprachlerngruppen sollen aber keinesfalls als voneinander streng abgegrenzte Gruppen mit einer dauerhaften Einteilung verstanden werden: „Eine wichtige Voraussetzung … ist, Durchlässigkeit zwischen den Sprachlerngruppen zu sichern sowie Berührungsängste und Vorurteile gegenüber der Gebärdensprache abzubauen.“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 7). Entsprechend der Abstufungen nehmen die Lautsprache unterstützenden Hilfen bei der zweiten und dritten Sprachlerngruppe zu, bis in der vierten Sprachlerngruppe schließlich tatsächlich bilingual unterrichtet wird, was idealerweise in der Hauptschulstufe bzw. der Realschule fortgesetzt wird. Die Durchführung des bilingualen Unterrichts in Bayern orientiert sich dabei an dem Hamburger Schulmodell, übernimmt es aber nicht 1:1.[48] D. h., es wird „im Rahmen des gesamten grundlegenden Unterrichts bilingual, und damit in Doppelbesetzung mit einer hörenden Lehrkraft und einer gehörlosen Fachkraft, unterrichtet“ (Hänel 2003a, S. 203). Dies entspricht dem Prinzip: eine Sprache – eine Person, die beide jeweils Muttersprachler sind. Für die Doppelbesetzung werden zwei Gründe angeführt:
„um die Sprachentrennung im Bewusstsein zu erleichtern und den unumgänglichen Prozess von Vermischung und Entflechtung zu beschleunigen,
um im gleichberechtigten Miteinander der beiden muttersprachlichen Lehrpersonen, von denen jede die Sprache der anderen achtet und weitgehend beherrscht, ein Integrationsmodell vor den Augen der Kinder zu etablieren“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 30).
Zwei spezifische Merkmale des bilingualen Unterrichts sind dabei von Bedeutung. Zum Einen der ständige, aufeinander abgestimmte Wechsel der Sprachen und der Bezugspersonen, der in jedem Unterrichtsfach stattfindet.[49] Dabei kann unterschieden werden, ob sich die Schüler noch in der Anfangsphase einer bilingualen Förderung (im Unterricht) befinden oder ob bereits ihre Frühförderung in Gebärdensprache durchgeführt wurde bzw. etwas allgemeiner gesagt, ob sie im Kindergarten bereits in der Gebärdensprache gefördert wurden. Außerdem kann der Wechsel auch noch in Abhängigkeit des unterrichteten Faches spezifiziert werden, so dass etwa im Sachunterricht der Wechsel der verwendeten Sprache anders abläuft als im Mathematikunterricht.
Zum Anderen ist ein wichtiges Merkmal des bilingualen Unterrichts das kontrastive Vorgehen in Bezug auf die Grammatik der deutschen Lautsprache und der Deutschen Gebärdensprache. Dies kann speziell in dem Unterrichtsfach „Deutsche Gebärdensprache“ durchgeführt werden. Der Wechsel „ist kein durchgängiges Prinzip, sondern bietet sich immer dann an, wenn eine Gegenüberstellung geltender Regeln aus den beiden unterschiedlichen Sprachsystemen erhellend und hilfreich sein kann. Die Einsicht in die Unterschiedlichkeit der Regelsysteme dient ihrer Entflechtung“ (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 40). Wo dieses Vergleichen und Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden besonders gut möglich ist, wird dies im Lehrplan gesondert hervorgehoben. Dabei wird der Unterricht im Fach „Deutsche Gebärdensprache“ in mehrere Lernbereiche gegliedert, die jeweils mehrere Teilbereiche als Lernziele haben. „Die vier Lernbereiche stehen in enger Beziehung zueinander und werden im Unterricht miteinander verknüpft“ (Hänel 2003a, S. 203):
Lernbereich 1: Handeln, gebärden und Gespräche führen
Lernbereich 2: Gebärdensprachkompetenz erwerben
Lernbereich 3: Gebärdensprache begegnen
Lernbereich 4: Gebärdenzeichen erwerben
Diese Vierteilung setzt sich in den Lehrplänen für die Hauptschulstufe und die Realschule fort, auch wenn es hier leichte inhaltliche Abweichungen zu der Einteilung der Grundschulstufe gibt.
Diese Ausführungen zur bilingualen Förderung zeigen, dass inzwischen auch Mitarbeiter in Einrichtungen für Hörgeschädigte und die für strukturelle Veränderungen verantwortlichen Stellen der Meinung sind, dass eine dem jeweiligen Kind angepasste Förderung auch in Bezug auf die Art der verwendeten Sprache wichtig ist. Denn es gibt trotz aller medizinisch-technischen Fortschritte Kinder, die ihre Hörreste nicht ausreichend zum Erlernen der Lautsprache verwenden können.[50] Diesen Kindern darf die Möglichkeit der Bildung jedoch nicht verwehrt werden, sondern soll ihnen auf für sie mögliche Wege, der bilingualen Förderung, gewährleistet werden.[51]
[...]
[1]Eine kurze Anmerkung zur Formulierung: Wenn im Folgenden die maskuline Form eines Wortes verwendet wird, ist damit immer auch die feminine Form gemeint. Es soll dadurch niemand ausgegrenzt werden. Dieser Schreibstil wurde rein aus Gründen der Einfachheit und Leserlichkeit des Textes gewählt.
[2]Vgl. hierzu Ahrbeck et al. 2006; Benkmann 1989; Hansen et al. 1991; Havers 1981; Holtz, Kretschmann 1989; Myschker 2005; Schlottke et al. 2005; Seitz 1981.
[3]Auch wenn im Verlauf dieser Arbeit die Begriffe Erziehung und Bildung zumeist synonym verwendet werden, ist zu beachten, dass es große Bedeutungsunterschiede gibt, die nicht nur für die Pädagogik, sondern auch für die Sonderpädagogik äußerst wichtig sind. Sehr ausführlich und tiefgründig geht Moser auf die Frage nach der Bildung in der Sonderpädagogik ein (vgl. 2003).
[4]Vgl. im Folgenden Stein 2006; Schad, Stein 2005.
[5]Vgl. Stein 2006, S. 26, Tabelle 1.
[6] Vgl. im Folgenden Bach 1989, S. 4–8.
[7] Vgl. Schad, Stein 2005, S. 421–422.
[8] Dieser Aspekt wird im Laufe der vorliegenden Arbeit immer wieder auftauchen.
[9] Vgl. hierzu Bach 1989, S. 9–11.
[10] Zu den folgenden Ausführungen vgl. Schad, Stein 2005, S. 425–427; Stein 2006, S. 30–32; Myschker 2005, S. 81–129; Bach 1989; Benkmann 1989.
[11]Vgl. Kap. 3.2.
[12]Vgl. im Folgenden Fengler 1990; Leonhardt 2002; Kaul 2006.
[13]Für die Verhaltensgestörtenpädagogik als einer pädagogischen Disziplin gilt selbstverständlich das Gleiche.
[14] Vgl. Große 2003, S. 17.
[15] Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grenze „Abschluss des Spracherwerbs“ keineswegs so leicht zu bestimmen ist, wie es zunächst den Anschein macht. Schließlich verändern sich nicht nur Art und Umfang des aktiven und passiven Wortschatzes im Verlauf des ganzen Lebens, sondern auch Sprechweise und noch vieles mehr. Ein banales Beispiel hierfür ist die Veränderung der von einem selbst gesprochenen Sprache und des Dialekts, nachdem man in ein anderes Gebiet umgezogen ist oder in einer anderen Stadt einige Tage zu Besuch war.
[16]Wobei die Überprüfung genau dieser Aussage über die Auswirkungen der Gehörlosigkeit u. A. auf die emotional-soziale Entwicklung ist das Anliegen dieser Arbeit.
[17] Etwa die folgenden: Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS), Zentral auditive Wahrnehmungsstörung (ZAWS), Zentral auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (ZAVWS), Zentrale Hörwahrnehmungsstörung, Auditive Verarbeitungsstörung, Zentrale Fehlhörigkeit, Zentrale Hörstörung, Rezeptive Hörstörung.
[18]Vgl. Kap. 4.3.
[19] Häufig aber leider auch von solchen Personen, die beruflich mit gehörlosen Menschen zu tun haben.
[20]Hier sei an die sogenannte „Psychologie der Gehörlosen“ erinnert, die häufig im Bereich der Gehörlosen- und Hörgeschädigtenpädagogik gelehrt wurde und wird. Vgl. dazu auch Kap. 3.
[21] Allerdings ist anzumerken, dass der Begriff „spätschwerhörig“ fälschlicherweise als das genaue Hörvermögen angebend verstanden werden kann und somit auch keine eindeutige Bedeutung transportiert.
[22]Die Hinwendung zur ressourcenorientierten Sicht und die Einbeziehung interpersoneller bzw. interaktioneller Orientierungen wird dem Leser im Verlauf dieser Arbeit wiederholt begegnen.
[23] Zu den Hintergründen der Berechnung vgl. Deutscher Schwerhörigenbund e. V. 2007.
[24] Vgl. Krüger 1991, S. 26.
[25] Leonhardt merkt allerdings an, dass weder Krüger noch Wiesotzki angeben, ob sich ihre Zahlen auf „die alten Bundesländer oder die gesamte BRD beziehen“ 2002, S. 63.
[26] Vgl. Kaul 2006, S. 56.
[27]Vgl. Tabelle 8 in Leonhardt 2002, S. 66.
[28] Vgl. Leonhardt 2002, S. 55; Kaul 2006, S. 60.
[29] Vgl. hierzu Leonhardt 2002, S. 55–60 und zur Vertiefung die von ihr angegebenen Quellen.
[30]In einer anderen Variante der Einteilung der Ursachen wird die Unterscheidung vererbt oder nicht vererbt aus der angeführten Dreiteilung heraus genommen und ihr übergeordnet. Hier würde zunächst gefragt werden, ob die Ursache hereditär ist oder nicht. Erst falls sie es nicht sein sollte, würde die Differenzierung prä-, peri- oder postnatal eine Rolle spielen.
[31]Vgl. Leonhardt 2002, S. 126–149; Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosen-Seelsorge (DAFEG) 1999; Eisenberg 2001; Laszig 2004; Günther 1997. Und zur Thematik der CI-Versorgung bei mehrfachbehinderten Kindern vgl. Lehnhardt 1998; Bertram 1998.
[32] Vgl. Leonhardt 2002, S. 130.
[33] Vgl. Hildmann 2004a; Leonhardt 2002, S. 174.
[34] Auf die Auswirkungen und möglichen Risiken des Neugeborenenhörscreenings wird in Kap. 4.2.1 näher eingegangen.
[35]Vgl. Hollweg 1999, S. 53–55; Leonhardt 2002, S. 82-84, 161-172.
[36] Vgl. Schmid-Giovannini 2004, S. 237.
[37] Vgl. für die folgenden Ausführungen Leonhardt 2002, S. 171–185, 2002.
[38]Vgl. Leonhardt 2002, S. 177–179; Klinke 2004.
[39]Vgl. dazu auch die folgenden Werke, die zum Teil die Vorgehensweise der Förderung beschreiben, aber ebenso die Ergebnisse und sich daraus ableitende Forderungen schildern Prillwitz, Wudtke 1988; Prillwitz et al. 1990; Prillwitz et al. 1991b, Prillwitz et al. 1991a. Und auf Untersuchungen aus dem amerikanischen Sprachraum basierend, allerdings ein vergleichbares Modell vorschlagend vgl. Johnson et al. 1990.
[40]Vgl. Wisch 1990, S. 219–234.
[41] Vgl. Kap. 5.1 zu den kindzentrierten Möglichkeiten.
[42] Vgl. hierzu stellvertretend in chronologischer Reihenfolge Günther, Staab 1999; Kaul et al. 1999; Hänel 2003a, Hänel 2003b}Hänel 2005; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005.
[43] Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 14–15.
[44]Sie treffen diese Entscheidung nicht zuletzt auch auf Grund der erhaltenen Beratung von HNO-Ärzten und Mitarbeitern der Pädoaudiologischen Beratungsstellen.
[45]Gültig seit dem 1.8.2003 den Lehrplan für bayerische Grundschulstufen des Förderzentrums für Hörgeschädigte, seit dem 1.8.2004 den Lehrplan für die bayerische Hauptschulstufe des Förderzentrums für den Förderschwerpunkt Hören und seit dem 1.8.2005 den Lehrplan für den Förderschwerpunkt Hören in Realschulen, Fachoberschulen und Gymnasien in Bayern (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2003, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2005). Zum Gültigkeitsdatum des Lehrplans für die Grundschulstufe gibt es jedoch widersprüchliche Daten. Auf der Internetseite zum Lehrplan für die Grundschulstufe steht als Gültigkeitsdatum der 18.3.2003 (http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=4&QNav=4&TNav=1&INav=0&Fach=&Fach2=79&LpSta=6&STyp=13&Lp=741). Das oben angeführte Datum ist dagegen dem offiziellen Lehrplanverzeichnis des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München aus dem Jahr 2007 entnommen (http://www.isb.bayern.de/imperia/md/content/isb/lehrplanverzeichnis_2007.pdf, S. 33). Da das zweitgenannte Datum nicht zu den Gültigkeitszeitpunkten der beiden anderen Lehrpläne passt, scheint es aber nicht zu stimmen.
[46] Vgl. hierzu und für die folgenden Ausführungen: Hänel 2003a; Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005.
[47] Schüler mit dieser Art der Hörschädigung können entweder in dieser separaten Sprachlerngruppe gefördert werden oder – je nach Notwendigkeit und Möglichkeit – einer der anderen Gruppen zugeordnet werden.
[48]Zur genaueren Beschreibung dieses und einer Reihe weiterer Modelle vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 16–21 bzw. speziell zum Hamburger Modell Günther, Staab 1999; Günther 2004.
[49] Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2005, S. 37–39.
[50]Vgl. Voit 1999.
[51] Vgl. Kap. 5.1.1.
- Arbeit zitieren
- Frank Alibegovic (Autor:in), 2008, Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94140
Kostenlos Autor werden
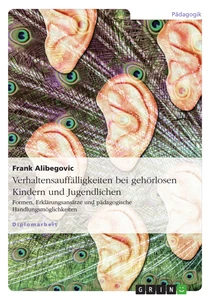
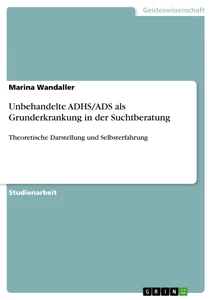




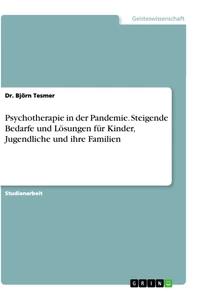















Kommentare