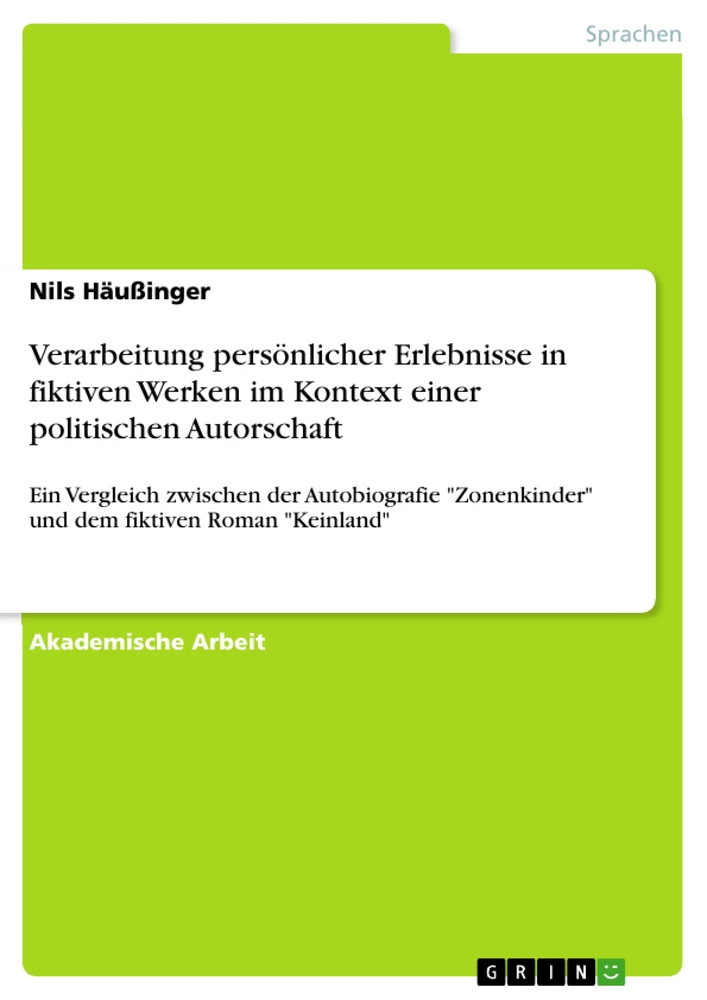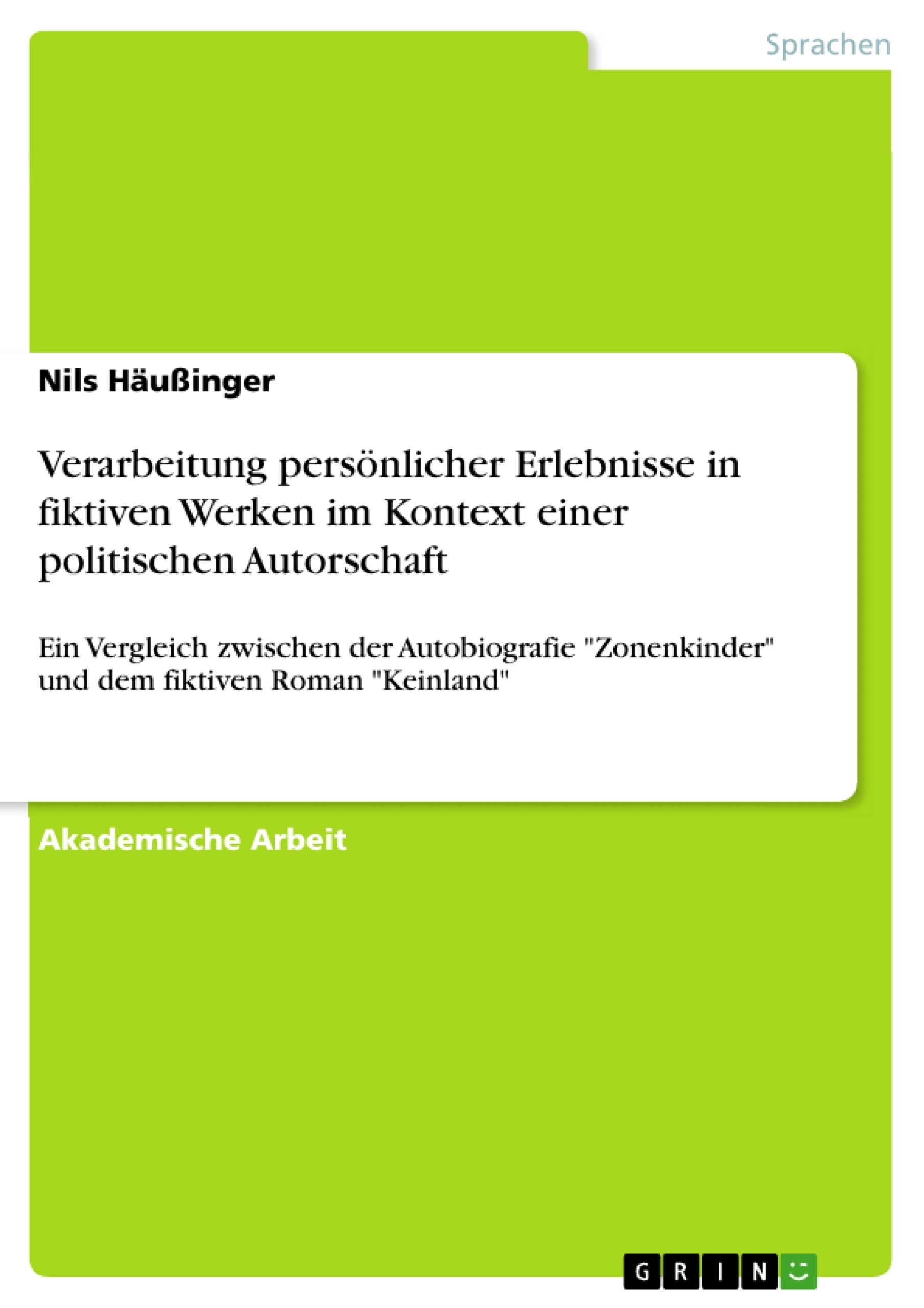Müssen sich Autoren politisch bekennen? Sind es denn wieder Zeiten wie jene der Nachkriegszeit, als inmitten der gesellschaftlichen Umwälzungen die Gruppe 47 mit Autoren wie Günter Grass und Heinrich Böll zu jenen Debattenträgern avancierten? Können, sollen und wollen Autoren auch im 21. Jahrhundert noch eine solche gesellschaftliche Rolle spielen? Müssen sich Autoren politisch bekennen?
Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit behandelt, in der die politische Autorschaft der ostdeutschen Journalistin und Autorin Jana Hensel, als auch das Einbinden ihrer Geschichte und ihrer Ansichten in fiktiven Werken betrachtet und analysiert wird. Zunächst wird die theoretische Grundlage anhand des Autorschaftsbegriffs von Pierre Bourdieu näher erläutert. Daraufhin wird die Person Jana Hensel als auch ihr Autorschaftskonzept in Bezug auf Bourdieu kurz vorgestellt und die Auswahl der Bücher "Keinland" und "Zonenkinder" legitimiert. Danach folgt eine Argumentation verschiedener Themenbereiche, die die These stützen soll, dass Jana Hensel als politisch engagierte Autorin auch ihre eigene Vita und eigene politische Werte in fiktive Werke einfließen lässt. Diese These wird unter Berücksichtigung von Pierre Bourdieus Autorschaftsbegriff nun erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz eines politischen Engagements junger Autorinnen und Autoren
- Bourdieus Autorschaftskonzept als theoretisches Fundament
- Vergleich der Bücher unter Berücksichtigung des Autorschaftsbegriffs
- Analyse des Autorschaftsbegriffs für Jana Hensel
- Vorstellung und Begründung der Bücher
- Argumentativer Vergleich beider Bücher
- Veränderung der Lebensbedingungen nach der Wende
- Thematik Kindheit und Jugend
- Entstehende Generationenkonflikte in „Ostfamilien“
- Umgang mit dem System DDR
- Abschließendes Fazit und Überprüfung der These
- Aktuelles politisches Engagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Autorschaft der ostdeutschen Journalistin und Autorin Jana Hensel und analysiert, wie ihre Geschichte und ihre Ansichten in fiktiven Werken verarbeitet werden. Im Zentrum steht die Frage, ob und wie Jana Hensel als politisch engagierte Autorin ihre eigene Vita und eigene politische Werte in fiktive Werke einfließen lässt.
- Politische Autorschaft im Kontext des Autorschaftsbegriffs von Pierre Bourdieu
- Verarbeitung persönlicher Erlebnisse in fiktiven Werken
- Einbezug der eigenen Biografie und politischer Ansichten in literarische Texte
- Der Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wende auf die ostdeutsche Literatur
- Generationenkonflikte in „Ostfamilien“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Relevanz des politischen Engagements von jungen Autorinnen und Autoren in der heutigen Zeit dar. Es wird auf die Rolle von Schriftstellern in gesellschaftlichen Debatten eingegangen und die Frage nach dem Stellenwert der politischen Autorschaft im 21. Jahrhundert aufgeworfen.
Kapitel zwei führt das Autorschaftskonzept von Pierre Bourdieu als theoretisches Fundament der Arbeit ein. Es werden die zentralen Elemente von Bourdieus Feldtheorie, die drei Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) und die beiden Hierarchisierungsprinzipien im literarischen Feld (heteronomes und autonomes Prinzip) erläutert.
Im dritten Kapitel wird der Autorschaftsbegriff für Jana Hensel im Kontext von Bourdieus Theorie analysiert. Die Bücher „Keinland“ und „Zonenkinder“ werden vorgestellt und ihre Relevanz für die Untersuchung des Autorschaftsbegriffs begründet.
Im vierten Kapitel folgt ein argumentativer Vergleich der beiden Bücher. Es werden verschiedene Themenbereiche betrachtet, die belegen, dass Jana Hensel ihre eigene Vita und eigene politische Werte in ihre fiktiven Werke einfließen lässt. Dabei wird die Frage nach der Veränderung der Lebensbedingungen nach der Wende, der Thematik Kindheit und Jugend, der Entstehung von Generationenkonflikten in „Ostfamilien“ sowie dem Umgang mit dem System DDR diskutiert.
Schlüsselwörter
Politische Autorschaft, Jana Hensel, Pierre Bourdieu, Feldtheorie, Kapitalformen, Autorschaftsbegriff, Lebensbedingungen nach der Wende, Kindheit und Jugend, Generationenkonflikte, Ostdeutschland, DDR.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet politische Autorschaft bei Jana Hensel?
Es beschreibt ihr Engagement als Autorin, die ihre eigene ostdeutsche Vita und politische Werte gezielt in ihre fiktiven und journalistischen Werke einfließen lässt.
Was besagt Bourdieus Autorschaftskonzept?
Es analysiert das literarische Feld anhand von Kapitalformen (ökonomisch, kulturell, sozial) und untersucht, wie Autoren sich darin positionieren.
Worum geht es in den Büchern „Zonenkinder“ und „Keinland“?
Beide Werke thematisieren die veränderten Lebensbedingungen nach der Wende, Generationenkonflikte in „Ostfamilien“ und den Umgang mit dem System DDR.
Müssen sich Autoren im 21. Jahrhundert politisch bekennen?
Die Arbeit diskutiert, ob Autoren heute wieder eine ähnliche gesellschaftliche Rolle als Debattenträger einnehmen sollten wie Grass oder Böll in der Nachkriegszeit.
Wie werden persönliche Erlebnisse in fiktive Werke eingebunden?
Jana Hensel nutzt ihre Geschichte über Kindheit und Jugend in der DDR, um universelle Themen des Umbruchs und der Identität literarisch zu verarbeiten.
- Arbeit zitieren
- Nils Häußinger (Autor:in), 2020, Verarbeitung persönlicher Erlebnisse in fiktiven Werken im Kontext einer politischen Autorschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000016