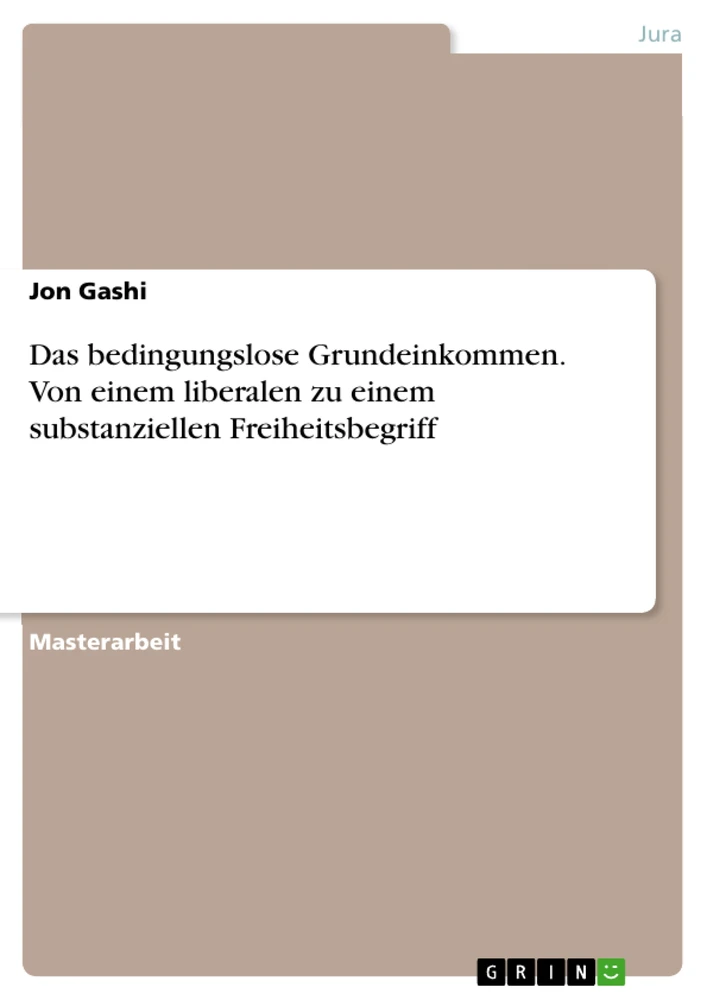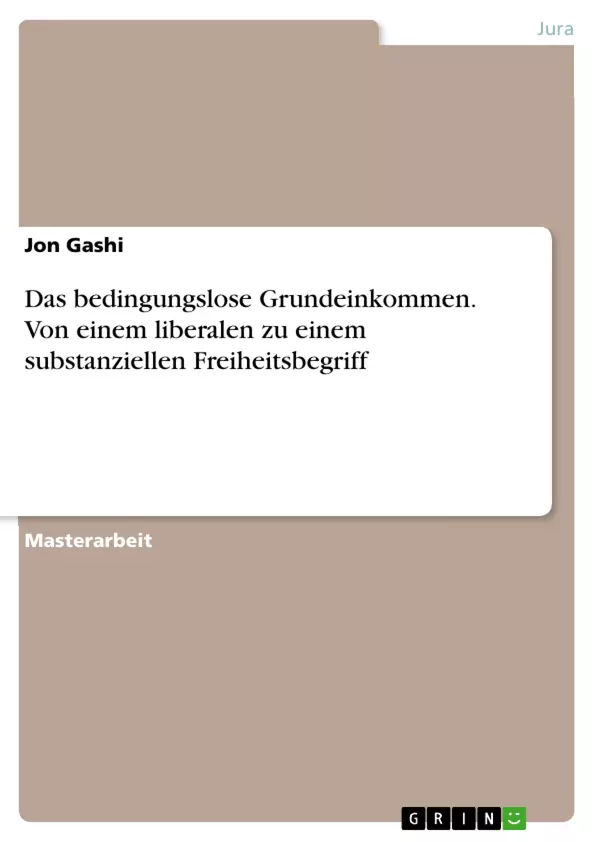Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass der vorherrschende liberale Freiheitsbegriff nicht ausreichend bestimmt ist und angesichts zeitgenössischer struktureller Probleme an seine Grenzen stößt. Dem liberalen Freiheitsbegriff soll ein weitergreifender substanzieller Freiheitsbegriff gegenübergestellt werden, der geeignet ist, den Menschen in einer hoch entwickelten Gesellschaft in zeitgemäßer Weise zu schützen. Als konkreter Lösungsvorschlag zur Verwirklichung einer substanziellen Freiheit soll das bedingungslose Grundeinkommen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- 1. Hinführung
- 2. Ziel
- 3. Aufbau
- B. Der liberale Freiheitsbegriff
- 1. John Locke
- 1.1. Eigentumstheorie
- 1.2. Staatstheorie
- 1.3. Freiheitsbegriff bei Locke
- 2. Robert Nozick
- 2.1. Anspruchstheorie der Verteilungsgerechtigkeit
- 2.2. Freiheitsbegriff bei Nozick
- 3. Isaiah Berlin
- 3.1. Negative Freiheit
- 3.2. Positive Freiheit
- 3.3. Der Konflikt zwischen den beiden Freiheitsbegriffen
- 4. Wirtschaftsliberalismus
- 5. Der liberale Freiheitsbegriff
- C. Grenzen des liberalen Freiheitsbegriffs
- 1. Das Problem der ökonomischen Macht
- 2. Das Problem der Rechtfertigung von Privateigentum
- 3. Das Problem der existenziellen Bedürfnisse
- 4. Einkommen und Arbeit
- 4.1. Armut
- 4.2. Arbeitslosigkeit
- 4.3. Freiheit im Wohlfahrtsstaat
- 4.4. Prekarisierung der Arbeit
- 5. Der substanzielle Freiheitsbegriff
- D. Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE)
- 1. Zentrale Wesensmerkmale
- 2. Die Erde gehört allen
- 2.1. Das Prinzip der Ressourcengleichheit
- 2.2. BGE als geeignetes Instrument
- 2.3. Freiheit für alle
- 3. Effizienteres Mittel gegen Armut
- 3.1. Wirksamkeit
- 3.2. Kosten
- 3.3. Psychische Belastung
- 4. Effizienteres Mittel gegen Arbeitslosigkeit
- 4.1. Arbeitsverteilung
- 4.2. Wegfall der Arbeitslosigkeitsfalle
- 4.3. Arbeitsbegriff
- 5. Verbesserung der Arbeitsbedingungen
- 5.1. Mehr Verhandlungsmacht für Arbeitnehmer
- 5.2. Umverteilung von Macht
- 6. Fazit: Das BGE
- E. Schlussfazit
- 1. Ergebnisse
- 2. Weiterführende Gedanken des Autors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Konzepte des bedingungslosen Grundeinkommens und des substantiellen Freiheitsbegriffs. Ziel ist es, die Grenzen des liberalen Freiheitsbegriffs aufzuzeigen und die Möglichkeit eines substanziellen Freiheitsbegriffs im Kontext des bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen. Die Arbeit beleuchtet, inwieweit das BGE als Instrument zur Überwindung der bestehende Ungleichheit und der Zwangslage der Arbeit dienen kann.
- Der liberale Freiheitsbegriff und seine Grenzen
- Der substanzielle Freiheitsbegriff als Alternative
- Das bedingungslose Grundeinkommen als Mittel zur Realisierung von Freiheit
- Die Auswirkungen des BGE auf Armut und Arbeitslosigkeit
- Die Bedeutung des BGE für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik und die Zielsetzung der Masterarbeit vor. Kapitel B analysiert den liberalen Freiheitsbegriff anhand der Theorien von John Locke, Robert Nozick und Isaiah Berlin sowie im Kontext des Wirtschaftsliberalismus. Kapitel C beleuchtet die Grenzen des liberalen Freiheitsbegriffs im Hinblick auf ökonomische Macht, Rechtfertigung von Privateigentum und existenziell bedingte Freiheit, wobei die Problematik der Armut, Arbeitslosigkeit, Freiheit im Wohlfahrtsstaat und die Prekarisierung der Arbeit im Detail betrachtet werden. Kapitel D widmet sich dem bedingungslosen Grundeinkommen und untersucht seine zentralen Wesensmerkmale, die Ressourcengleichheit, die Freiheit für alle, seine Wirksamkeit und Kosten sowie seine potentiellen Effekte auf die Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des bedingungslosen Grundeinkommens, des liberalen und substantiellen Freiheitsbegriffs, der sozialen Gerechtigkeit und der Gestaltung der Arbeitswelt im Kontext von Armut, Arbeitslosigkeit und Prekarisierung.
- Quote paper
- Jon Gashi (Author), 2019, Das bedingungslose Grundeinkommen. Von einem liberalen zu einem substanziellen Freiheitsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000047