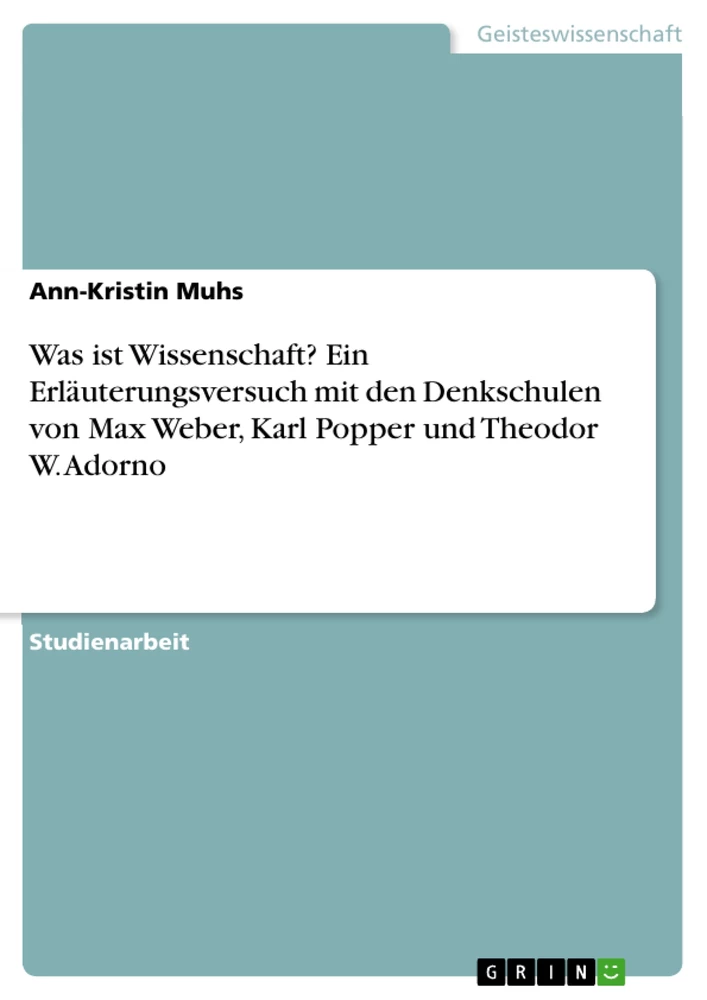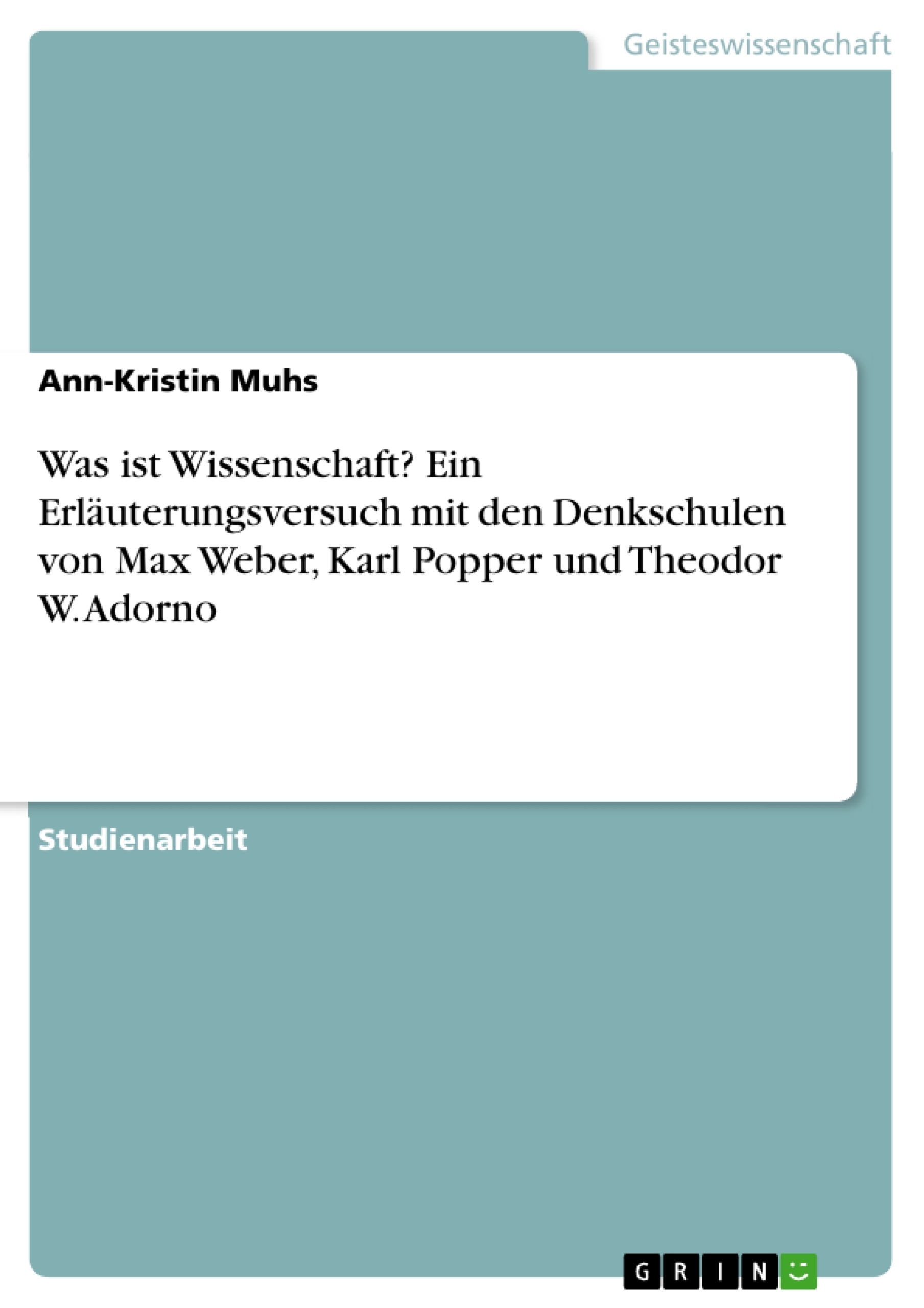Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, was Wissenschaft überhaupt ist, mit Hinblick darauf, wie Wissen definiert wird.
Die Geschichte der Wissenschaft ist eine sehr interessante Reise durch die menschliche Historie und reicht Tausende von Jahren zurück. Jedoch war die Wissenschaft von damals anders, als wir sie heute vielleicht kennen: So war die Wissenschaft damals im alten Mesopotamien sehr eng mit der Religion verbunden, Priester sind dort die Wissenschaftler gewesen.
In der griechischen Antike war die Wissenschaft jedoch sehr eng mit der Philosophie verknüpft. Aus dieser Epoche stammen viele Gelehrte (z. B. Archimedes und Pythagoras), die wir heute noch kennen und deren Theorien Basis für weiteres wissenschaftliches Arbeiten sind. Sie erforschten damals in Institutionen gemeinsam und gaben ihr Wissen weiter, indem sie es an diesen Institutionen lehrten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung - Einführung in das Thema
- Definition und Ziele der Wissenschaft
- Was ist Wissen?
- Wissenschaft als geregeltes Erkenntnissystem
- Systematik der Wissenschaft
- Verschiedene Denkschulen der Wissenschaft
- Max Weber und der Werturteilsstreit
- Karl Popper und der Falsifikationismus
- Theodor W. Adorno und der Positivismusstreit
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, was Wissenschaft eigentlich ist. Sie untersucht die Definition von Wissen und betrachtet die Wissenschaft als ein methodisch geregeltes Erkenntnissystem. Die Arbeit beleuchtet die Systematik der Wissenschaft und analysiert exemplarisch die Wissenschaftstheorien von Max Weber, Karl Popper und Theodor W. Adorno, um ein tieferes Verständnis des wissenschaftlichen Prozesses zu erlangen.
- Definition von Wissen und seine Rolle in der Wissenschaft
- Wissenschaft als methodisch geregeltes Erkenntnissystem
- Die Systematik der wissenschaftlichen Forschung
- Die Wissenschaftstheorien von Max Weber, Karl Popper und Theodor W. Adorno
- Die Bedeutung von verschiedenen Denkschulen in der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Wissenschaft ein und beleuchtet die historische Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens von der Antike bis zur Renaissance. Die Arbeit stellt fest, dass die Definition von Wissenschaft komplex ist und verschiedene Interpretationen existieren.
Kapitel 2 widmet sich der Definition und den Zielen der Wissenschaft. Es untersucht die Frage, was Wissen bedeutet und wie es sich von Glauben unterscheidet. Der Abschnitt erörtert die Wissenschaft als ein methodisch geregeltes Erkenntnissystem und erläutert die Bedeutung von Gütekriterien für die wissenschaftliche Forschung.
Kapitel 3 betrachtet verschiedene Denkschulen der Wissenschaft und stellt die Theorien von Max Weber, Karl Popper und Theodor W. Adorno vor. Weber behandelt den Werturteilsstreit, Popper den Falsifikationismus und Adorno den Positivismusstreit. Diese Denkschulen illustrieren die verschiedenen Ansätze und Debatten, die innerhalb der Wissenschaft bestehen.
Schlüsselwörter
Wissenschaft, Wissen, Erkenntnissystem, Methode, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, Denkschulen, Werturteilsstreit, Falsifikationismus, Positivismusstreit, Max Weber, Karl Popper, Theodor W. Adorno, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert Wissenschaft laut dieser Arbeit?
Wissenschaft wird als ein methodisch geregeltes Erkenntnissystem beschrieben, das Wissen systematisch generiert und überprüft.
Was ist Karl Poppers Falsifikationismus?
Die Theorie, dass wissenschaftliche Hypothesen nie endgültig bewiesen, sondern nur durch Gegenbeweise widerlegt (falsifiziert) werden können.
Worum ging es im Werturteilsstreit bei Max Weber?
Um die Frage, ob Wissenschaftler in ihrer Forschung persönliche Werte und politische Meinungen äußern dürfen oder objektiv bleiben müssen.
Was war der Positivismusstreit?
Eine Debatte zwischen Adorno und Popper über die Methoden der Sozialwissenschaften und die Rolle der Gesellschaftskritik.
Was unterscheidet Wissen von Glauben?
Wissenschaftliches Wissen basiert auf überprüfbaren Methoden, Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) und logischer Systematik.
- Quote paper
- Ann-Kristin Muhs (Author), 2019, Was ist Wissenschaft? Ein Erläuterungsversuch mit den Denkschulen von Max Weber, Karl Popper und Theodor W. Adorno, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000220