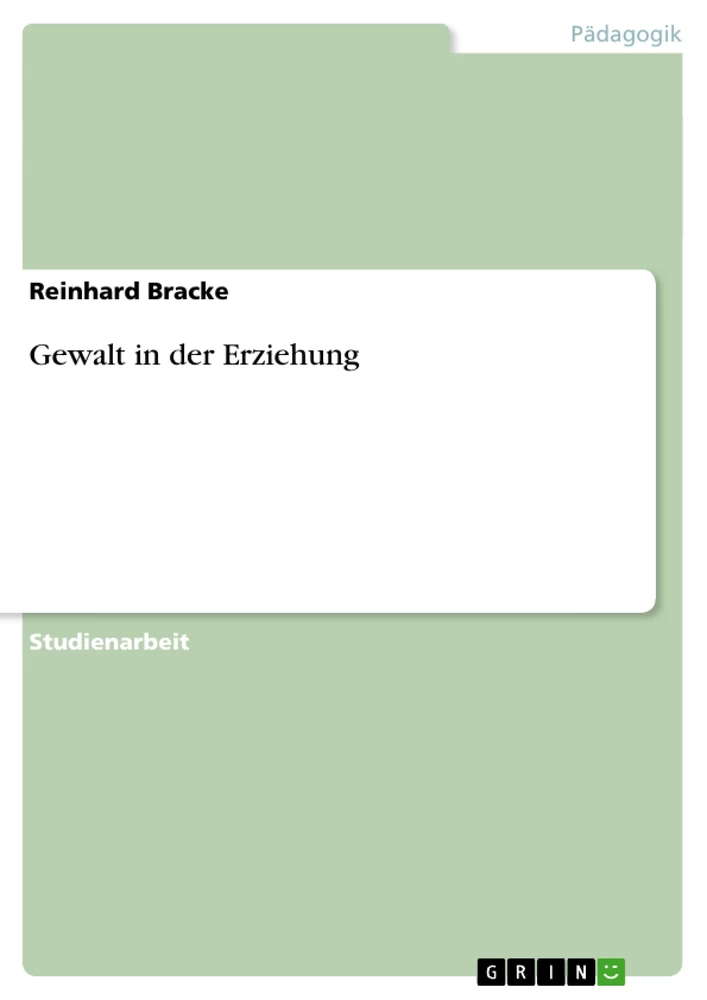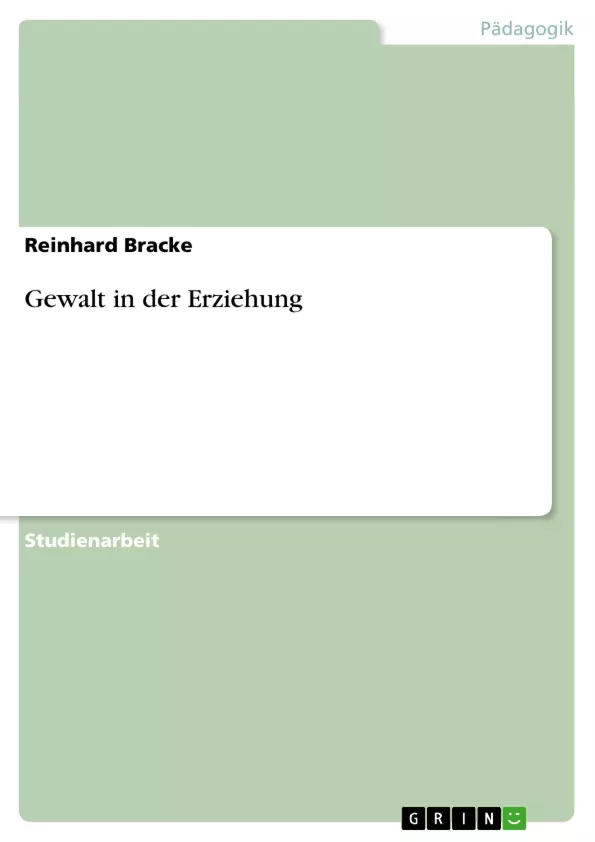Für unsere Studienarbeit haben wir uns folgende Aufgaben gestellt: Wir wollen uns zunächst allgemein über das Thema Gewalt äußern, bevor wir etwas konkreter auf Gewalt in der Erzie-hung eingehen. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit Gewalt in unserer Gesellschaft. Wir versuchen Ursachen, Gründe, deren Folgen, sowie deren Interventionsformen aufzuführen, sowohl im politischen, wie auch im sozialpädagogischen Sinne. Bei unserer Arbeit stützen wir uns auf verschiedene Literatur- und Internettrecherchen, Statistiken und unsere eigenen Erfahrungen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
1. Gewalt, eine Begriffserklärung
1.1. Gewalt in der Geschichte
2. Gewalt in der Erziehung
2.1. Die Medien, heimliche Miterzieher
3. Sozialpädagogische Interventionen
4. Prävention auf politischer Ebene
Literaturliste
EINLEITUNG
Für unsere Studienarbeit haben wir uns folgende Aufgaben gestellt: Wir wollen uns zunächst allgemein über das Thema Gewalt äußern, bevor wir etwas konkreter auf Gewalt in der Erziehung eingehen. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit Gewalt in unserer Gesellschaft. Wir versuchen Ursachen, Gründe, deren Folgen, sowie deren Interventionsformen aufzuführen, sowohl im politischen, wie auch im sozialpädagogischen Sinne. Bei unserer Arbeit stützen wir uns auf verschiedene Literatur- und Internettrecherchen, Statistiken und unsere eigenen Erfahrungen.
1. Gewalt, eine Begriffserklärung
Wenn einem Menschen gegen seinen Willen ein Verhalten oder Handeln aufgezwungen wird, sprechen wir von Gewalt. Es gibt unterschiedliche Formen der Gewalt:
- Physische Gewalt (Schläge, Tritte, körperliche Verletzungen, Frakturen, Hämatome etc. )
- Psychische Gewalt (Erniedrigungen, Demütigungen, Beleidigungen)
- Sexueller Missbrauch (Beteiligung an sexuellen Handlungen, zu der Kinder aufgrund ihres mangelnden Entwicklungsstandes kein Einverständnis geben können, körperliche wie auch seelische Schädigung)
Gewalt kann bis zu völliger psychischer (Depressionen, Neurosen) und physischer (Tod) Zerstörung führen.
1.1. Gewalt in der Geschichte
Gewalt gibt es seit Beginn der Menschheit. Sie diente dazu, zu überleben, sich Respekt und Achtung zu verschaffen, zu Ruhm und Reichtum zu gelangen und auch zur Unterhaltung. Schon in der Urgesellschaft kämpften die Menschen um ihre Daseinsberechtigung. In Zeiten wo Hunger und Klimaeinflüsse das Leben erschwerten, wurden Gewalttätigkeiten zum Überleben eingesetzt. Wie im Tierreich überlebte der Stärkere (Natürliche Auslese). In der Sklavenhaltergesellschaft wurden Gladiatorenkämpfe zu Belustigung und Unterhaltung eingesetzt. Zahlreiche Kriege der letzten Jahrhunderte zeugen von enormer Gewaltbereitschaft zur Befriedigung persönlicher und gesellschaftlicher Bedürfnisse. Folterkammern im Mittelalter, Hexenverbrennung, Inquisition sind weitere Beispiele. Mit der Entwicklung der Menschheit vollzog sich ein ständiger Werte- und Normenwandel in Bezug auf Gewalt.
Gegenseitiges Töten, Rivalenkämpfe waren lange Zeit ganz normal. Kein Mann wurde als gewalttätig bezeichnet, der einen Konkurrenten schlug, Frauen vergewaltigte und bei der Erziehung von Kindern Prügel einsetzte.
Straften Lehrer „unwillige“ oder „unartige“ Kinder, beschwerte sich kein Mensch über dieses Verhalten. Im Gegenteil: es galt die Meinung, ein ungehorsames Kind oder eine widerspenstige Frau hatten diese Strafe verdient. Sie waren die Schuldigen. Kein Gesetz verbot dieses Verhalten.
Aus der Zeit des Nationalsozialismus wissen wir von Gewalt und Verfolgung von „Andersdenkenden“. Euthanasie, Antisemitismus und Konzentrationslager sind Begriffe, die wohl kaum jemandem fremd sind.
Im Laufe der Entwicklung der Menschheit vollzogen und vollziehen sich viele Prozesse, die die Moralvorstellungen verändern. Gewalt war immer da, nur eben in anderer Form.
Anhand des „Dreiecks“ lässt sich dieser Wertewandel auch gut erklären:
- Werte/Normen; Von der Frühzeit bis heute hat sich ein deutlicher Wertewandel vollzogen, der sich nicht nur in den Ausdrucksformen der Gewalt widerspiegelt. Die Aufklärung, das wachsende Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse, der Wegfall der Klassenunterschiede führten zu einem wachsenden Bewusstsein der Menschen im Hinblick auf Moral und Ethik.
- Soziale Kontrolle/Sanktionen; Ausgehend von einer zunehmenden Ächtung der Gesellschaft gegenüber Gewaltherrschern, schloss sich der Staat mit angepassten Gesetzen dem veränderten Bewusstsein der Menschen an. Er erließ Gesetze, die z.B. die Willkür von Großgrundbesitzern einschränkte und den Bauern Freiheiten gewährte, von denen sie vorher nie zu träumen gewagt hätten.
- Abweichendes Verhalten; Schon bald danach setzte sich ein verändertes Bewusstsein durch, das das frühere Verhalten von Gewaltherrschern als völlig unverständlich und unverhältnismäßig erscheinen ließ.
Im Zuge der Demokratisierung entstanden auf politischer Ebene immer neue Gesetze, die Gewalt verboten oder begangene Gewalttätigkeiten sanktionierten und bestraften. Auch die Art des Strafens unterzog sich einem Wandel.
In unserer heutigen Zeit wird keinem Lügner mehr die Zunge herausgeschnitten, keinem Dieb mehr die Hand abgehackt, ein Andersdenkender wird nicht mehr auf den Marktplatz verbrannt und Juden kommen nicht mehr in die Gaskammer. Die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung verachtet Gewalt, findet sie abscheulich. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet sie sogar in strengster Form. (Art. I)
Und trotzdem, es gibt sie. Etwas verdeckter, auf einem anderen Niveau und vielleicht gesellschaftsfähiger. Wenn heute z.B. jemand einen Kollegen mobbt, hält man ihn womöglich noch für besonders schlau.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Gewalt in der Erziehung definiert?
Gewalt liegt vor, wenn einem Menschen gegen seinen Willen ein Verhalten aufgezwungen wird. In der Erziehung umfasst dies physische, psychische und sexuelle Gewaltformen.
Wie hat sich das Verständnis von Gewalt historisch gewandelt?
Früher galt Gewalt in der Erziehung oft als legitim („Züchtigungsrecht“). Durch Aufklärung und Demokratisierung hat sich ein Wertewandel hin zur Ächtung von Gewalt vollzogen.
Was sind psychische Formen der Gewalt?
Dazu zählen Erniedrigungen, Demütigungen und Beleidigungen, die zu schweren seelischen Schäden wie Depressionen oder Neurosen führen können.
Welche Rolle spielen Medien als „heimliche Miterzieher“?
Medien können Gewalt verharmlosen oder als Konfliktlösungsmuster darstellen, was das Erziehungsverhalten und die kindliche Entwicklung beeinflusst.
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es auf politischer Ebene?
Der Staat erlässt Gesetze zum Schutz von Kindern (z.B. Recht auf gewaltfreie Erziehung) und fördert Sanktionen gegen abweichendes, gewalttätiges Verhalten.
- Quote paper
- Reinhard Bracke (Author), 2003, Gewalt in der Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10009