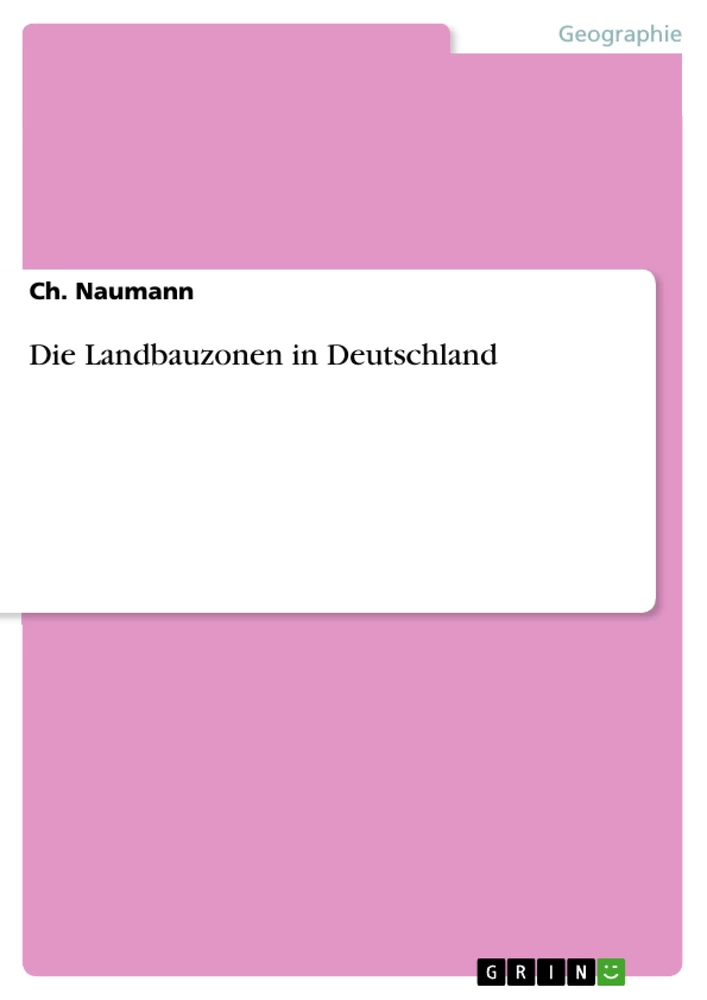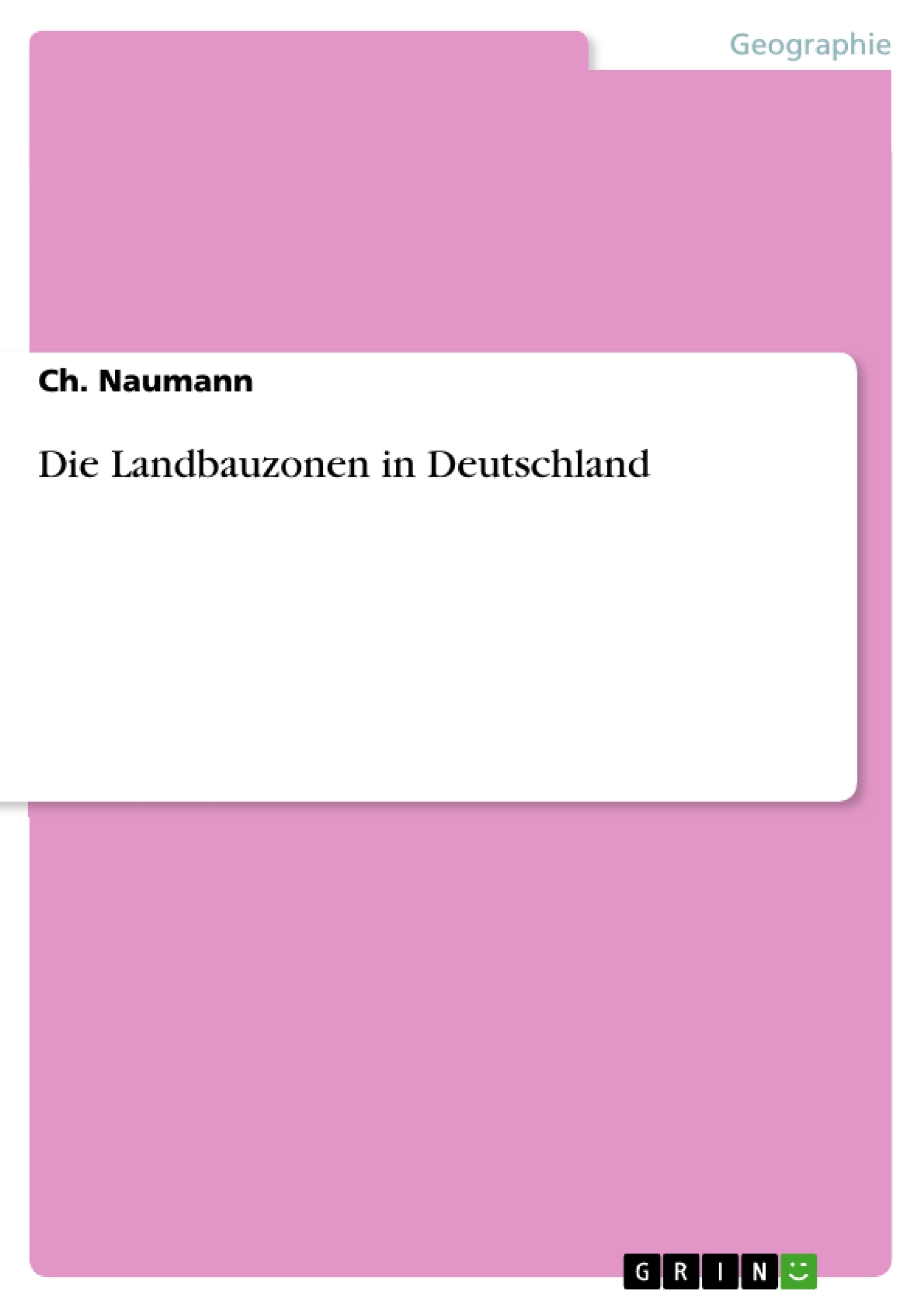# Landbauzonen sind nicht statisch, sondern permanent Veränderungen ausgesetzt
# Infolge der Vereinigung West- und Ost-Deutschlands im Jahre 1990, kam es vor allem im östlichen Teil zu einer massiven Änderung der Agrarstruktur. Die in der ehemaligen DDR herrschenden sozialistischen Strukturen (LPG) wurden infolge des nun neuen politischen Systems (Folge: Privatisierung) verdrängt bzw. aufgelöst. In Bezug auf die damaligen großräumigen Nutzflächen hieß dies, dass eine Aufteilung der Flächen - in welcher Form auch immer - stattfand (Eckart 1998: 379) und somit auch teilweise Änderungen bzgl. der Nutzpflanzen festzustellen war.
# Hinzu kamen die politischen Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Union, die v. a. der Überproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse entgegenwirken sollten.
Unter anderem subventioniert die EU den Anbau bestimmter Nutzpflanzen· viele Landwirte verlangern ihre Produktion, um den maximalen Profit zu erlangen.
# Neben diesen politischen Aspekten entscheiden natürlich primär geographische Faktoren (Klima, Böden, Relief) über die Art der Landnutzung und somit über das Gesicht der Landbauzonen.
# Landbauzonen sind auch abhängig vom Markt (Nachfrage).
# Anbau bestimmter Kulturpflanzen auch traditionsbedingt.
Inhalt
1. Einführung
2. Natürliche Gegebenheiten in Deutschland
2.1 Klima
2.2 Böden
2.3 Relief
3. Landbauzonen in Deutschland
3.1 Getreidebau
3.2 Hackfrüchte
3.3 Futterbau
3.4 Sonderkulturen
4. Schluss
5. Literaturverzeichnis
1. Einführung
- Landbauzonen sind nicht statisch, sondern permanent Veränderungen ausgesetzt
- Infolge der Vereinigung West- und Ost-Deutschlands im Jahre 1990, kam es vor allem im östlichen Teil zu einer massiven Änderung der Agrarstruktur. Die in der ehemaligen DDR herrschenden sozialistischen Strukturen (LPG) wurden infolge des nun neuen politischen Systems (Folge: Privatisierung) verdrängt bzw. aufgelöst. In Bezug auf die damaligen großräumigen Nutzflächen hieß dies, dass eine Aufteilung der Flächen - in welcher Form auch immer - stattfand (ECKART 1998: 379) und somit auch teilweise Änderungen bzgl. der Nutzpflanzen festzustellen war.
- Hinzu kamen die politischen Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Union, die v. a. der Überproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse entgegenwirken sollten. Unter anderem subventioniert die EU den Anbau bestimmter Nutzpflanzenà viele Landwirte verlangern ihre Produktion, um den maximalen Profit zu erlangen.
- Neben diesen politischen Aspekten entscheiden natürlich primär geographische Faktoren (Klima, Böden, Relief) über die Art der Landnutzung und somit über das Gesicht der Landbauzonen.
- Landbauzonen sind auch abhängig vom Markt (Nachfrage).
- Anbau bestimmter Kulturpflanzen auch traditionsbedingt.
2. Natürliche Gegebenheiten in Deutschland
- stellen den eigentlichen Rahmen dar, der die Position bestimmter Anbaugebiete bestimmt
- geographische Lage Deutschlands zwischen 47° und 55° N, Nähe zum Atlantik und aufgrund geomorphologischer Verhältnisse findet man hier - auf die gesamte Fläche betrachtet - mittlere bis günstige landwirtschaftliche Bedingungen vor. Regional gesehen können diese dennoch beträchtlich von einander abweichen (TIETZE ET AL. 1990: 548)
2.1 Klima
- großräumig bestimmt das Klima wesentlich den Anbau von Agrarprodukten (trotz technischer und biologischer Fortschritt ist dies der wichtigste Faktor) § v. a. aber die Witterung, die den jahreszeitlichen Rhythmus des Wettergeschehens beinhaltet, besitzt eine wesentliche Rolle bei dem Anbau von Ackerpflanzen. Die Witterung in Deutschland ist durch große Unbeständigkeit geprägt, da man einen häufigen Wechsel von Großwetterlagen beobachten kann (HAUSDORFER 1974: 39). Dies beinhaltet, dass Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse sich nicht nur regional, sondern auch auf die Jahre bezogen erheblich unterscheiden können; so ist es nicht verwunderlich, wenn man nach einem Jahr mit hohen Ertragszahlen Missernten vorfindet (HENKEL 1995: 83).
- Zur optimalen Landnutzung gehört deswegen auch die permanente Wetterbeobachtung, ein Restrisiko ist trotzdem nicht auszuschließen. § großräumige Lage in Deutschland hinsichtlich Temp. und NS: zw. 7 und 9°C, NS im Durchschnitt bei 750 mm pro Jahr und relativ gleichverteilt über das Jahr. (TIETZE ET AL.: 548)àrelativ günstige Anbaubedingungen
- weitere Charakteristika:
- mittellange Vegetationsperiode von ca. 4 - 5 Monaten
- mittellange Sonnenscheindauer von 1400 - 1800 Stunden pro Jahr (Deutschland), (Vergleich: N-Afrika: 3000 Std., Island: 1000 Std.)
- Niederschläge über das Jahr verteilt relativ ausgeglichen, ausreichende
Feuchtigkeit, dabei Gleichverteilung der wichtige Faktor für die Landwirtschaft., nicht absolute Menge
(HOFMEISTER U. ROTHER 1985: 9)
- Beispiele für Anbaugrenzen: Wärmemangelgrenze WeinbauàAhrtal Wärmemangelgrenze KörnermaisàRhein-Main (FUCHS 1988: 188)
2.2 Böden
- Boden=Standort und Nährstoffträger der Vegatation. Bodenqualität abhängig von Humusgehalt des Oberbodens, Mineralgehalt (abh. von Ausgangsgestein), Bodenflora und -fauna sowie guter Durchlüftung und Durchwässerung (HENKEL 1995: 84)
- Bodenqualität in D. sehr wechselhaft
- größere Flächen mit fruchtbaren Böden nicht vorhanden
- charakteristisch in Deutschland die Mittelgebirge mit mittelmäßigen Böden, hier Problem, dass z.T. Hanglageàerschwerte Bearbeitung und v. a. Bodenerosion § gute Anbaugebiete in Deutschland: Jungmarschgebiete an der schleswig- holsteinischen Westküste, Lößböden in Ostwestfalen oder z. B. im Wetteraugebiet
- hoher Anteil des Ackerlandes dort zu finden, wo hohe Bodenertragszahlen (Löß- und Schwarzerdegebiete), z. B. Jülich-Zülpicher oder Soester Bördengebiet
- Bodenansprüche von Kulturpflanzen unterschiedlich, z.B. gedeiht Weizen am besten auf milden Lehmböden, Kartoffel auf leicht sandige Böden
- Beeinflussung der Böden: Düngung, Bodenbearbeitung, Milioration (kulturtechnische Maßnahme zur agrarwirtschaftl. Bodenverbesserung, z.B. durch Trockenlegung, Ent- oder Bewässerung) (FUCHS 1988: 189)
2.3 Relief
- Einteilung Deutschlands in Tiefland, Mittelgebirge, Alpen.
- vorwiegend durch Mittelgebirge geprägt
- landwirtschaftliche Nutzung zusätzlich durch Höhe begrenzt
- wesentliche Kriterien des Reliefs sind Hangneigung, Höhenunterschiede, Tal- Hang, Kessellage, Exposition zur Sonne, Windschutz.
- große Ebenen am besten für Landwirtschaft geeignet (N. u. S.-Deutschland)
- mit steigendem Gefälle Schwierigkeiten bei Bearbeitungàzeit- und kostenintensiv; aber v. a. Bodenerosion
- das reliefbedingte Geländeklima kann Verkürzung der Vegetationszeit hervorrufen, aber auch Begünstigungen wie z. B. den Weinbau in den Tälern dt. Mittelgebirge
- Wichtig: Alle Faktoren betrachten, da die Kombination für Pflanzenwachstum ausschlaggebend.
3. Landbauzonen in Deutschland
- Allgemein: Um die Vielfalt der Nutzung besser klassifizieren zu können, werden die Kulturarten zu größeren Gruppen zusammengefaßt:
- Getreidebau: Alle Getreidearten, einschl. Mähdruschblattfrüchte (Raps,
Druschleguminosen, Körnermais)
- Hackfruchtbau: Kartoffeln, Zuckerrüben, Futterhackfrüchte (Futterrüben),
Feldgemüse, Tabak
- Futterbau: Feldrauhfutter (Klee, Luzerne, Silomais), Dauergrünland (Wiesen, Weiden)
- Sonderkulturen: Baum- und Strauchkulturen (Obst, Beeren, Wein, Hopfen), Heil- und Gewürzpflanzen (SICK 1993: 113)
3.1 Getreidebau
- dient der Ernährung von Menschen und Tieren
- dominierend entlang dem Nordrand der Mittelgebirge, günstige Boden (Löß/Lehm)- und Klimabedingungen, aber auch an vielen anderen Standorten (i.d.R. als Gemischtbetriebe)
3.2 Hackfrüchte
- Kulturpflanzen, bei denen das Hacken oder eine entsprechende maschinelle Bodenbearbeitung eine wesentliche Maßnahme zur Erlangung guter Erträge ist. § Vorkommen: Rheinische Bucht, Rhein-Main-Gebiet, Würzburger Becken, Uelzen- Hildesheim-Braunschweig, Regensburg-Straubinger Gäulandschaft (i. d. R. als Gemischtbetrieb)
3.3 Futterbau
- Anbau von Kulturpflanzen zur Tiernährung.
- vorwiegend in Alpen, Alpenvorland, in den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Marschen (Grünlandgebiete)
- in den Alpen, da hier hohe Niederschläge, nährstoffarme Böden, Durchschnittstemp. relativ geringàAckerbau hier nur bedingt möglichdeswegen hier überwiegend Viehhaltung; hier oftmals sehr kleine Betriebe, sind stärker auf Milchviehhaltung angewiesen und damit auf Winterfuttergewinnung (àWiesen) § im Norden: Küstenlage, Nieselregen, Nebelà fördert Weidewuchs, erschwert Heugewinnung
- Mittelgebirgslagen: hier ebenfalls rel. Feucht, rel. kurze Vegetationszeit, Hanglagen lassen Ackerbau (Maschineneinsatz) nur in bestimmten Maße zu
3.4 Sonderkulturen
- Gruppe von Früchten, die mit großer Sorgfalt und hohem Arbeitseinsatz kultiviert werden müssen, relativ kapitalintensiv. Neben physisch-geogr. Faktoren (rel. gute klimat. Bedingungen) spielen auch Vererbungsverhältnisse (Realteilung) (àdamit Rentabilität gegeben ist) sowie Anbautradition eine große Rolle (Wein) § Beispiele:
Oftmals im SW-Deutschland, aber auch punktuell in Gesamtdeutschland
- Kaiserstuhl und Mosel (Weinbau)
- Pinneburger Geest (Baumschulen)
- die Hallertau und der Raum Tettnang (Hopfenanbau)
- Insel Reichenau (Gemüseanbau)
- Raum Bodensee, Rhein-Main-Neckar-Gebiet (Obst)
- Niederelbe (Obst)
- Rheintal (Spargel, Tabak)
(ANDRAE 1973: 61 ff.; BALDENHOFER 1999: 184, 199, 168, 361)
4. Schluss
- Anbauverhalten hat sich z. T. geändert, aufgrund unterschiedlicher Nachfrage, aber auch aufgrund der EU-Bestimmungen (Subventionen).
- Trend dahin, dass zunehmend größere Flächen bearbeitet werden, wg. Rückgang der Agrarbeschäftigten oder aus Rentabilitätsgründen.
- Flächenstillegungen (EU): Entgegenwirken der Überschüsse/Entgegenwirken der Bodendegradierung, v. a. im Osten Deutschlands der Fall
- Kurzzusammenfassung der wichtigsten Agrarprodukte und Vorkommen in Deutschland:
- Getreide: sehr hohe Anteile im Westen Deutschlands
- Kartoffeln: Ostdeutschland
- Zuckerrüben: höchste Anteile in Bördengebieten, Rhein-Main-Neckar-Gebiet
- Rinder- und Schweinehaltung: N. - und S.- Deutschland
(ECKART, WOLLKOPF ET AL. 1994: 199)
5. Literaturverzeichnis
ANDRAE, B. 1973: Strukturen deutscher Agrarlandschaft: Landbaugebiete und
Fruchtfolgesysteme in der Bundesrepublik Deutschland (=Forschungen zur deutschen Landeskunde, 199). Bonn.
BALDENHOFER, K. 1999: Lexikon des Agrarraums. Gotha, Stuttgart.
ECKART, K. 1998: Agrargeographie Deutschlands: Agrarraum und Agrarwirtschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert. Gotha, Stuttgart.
ECKART, K., H.-F. WOLLKOPF ET AL. 1994: Landwirtschaft in Deutschland:
Veränderungen der regionalen Agrarstruktur in Deutschland zwischen 1960 und 1992 (=Beiträge zur regionalen Geographie, 36). Leipzig. FUCHS, G. 1988: Die Bundesrepublik Deutschland. 4. Auflage. Stuttgart. HAUSDORFER, H. (Hrsg.) 1974: Die Agrarwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. München.
HENKEL, G. 1995: Der ländliche Raum: Gegenwart und Wandlung seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland. 2. Auflage. Stuttgart.
HOFMEISTER, B. U. K. ROTHER 1985: Mittlere Breiten - Geographisches Seminar zonal. Braunschweig.
SICK, W. 1993: Geographisches Seminar - Agrargeographie. 2. Auflage. Braunschweig.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Landbauzonen und welche Faktoren beeinflussen sie laut diesem Text?
Landbauzonen sind Gebiete mit spezifischer landwirtschaftlicher Nutzung. Laut dem Text werden sie durch politische Maßnahmen (z.B. EU-Subventionen), geographische Faktoren (Klima, Böden, Relief), Marktnachfrage und Traditionen beeinflusst.
Welche natürlichen Gegebenheiten in Deutschland sind für die Landwirtschaft relevant?
Die wichtigsten natürlichen Gegebenheiten sind Klima, Böden und Relief. Das Klima bestimmt großräumig den Anbau, die Böden liefern den Standort und Nährstoffe, und das Relief beeinflusst die Bearbeitung und das Mikroklima.
Wie wird das Klima in Deutschland für die Landwirtschaft charakterisiert?
Das Klima ist durch eine mittellange Vegetationsperiode (4-5 Monate), mittellange Sonnenscheindauer (1400-1800 Stunden pro Jahr) und relativ gleichmäßige Niederschläge (ca. 750 mm pro Jahr) gekennzeichnet. Die Witterung ist jedoch unbeständig mit häufigem Wechsel der Großwetterlagen.
Welche Bodentypen sind für die Landwirtschaft in Deutschland wichtig?
Fruchtbare Böden wie Jungmarschgebiete, Lößböden und Schwarzerdegebiete sind besonders wichtig. Die Bodenqualität variiert jedoch stark, und viele Mittelgebirge haben nur mittelmäßige Böden mit Erosionsgefahr.
Wie beeinflusst das Relief die Landwirtschaft in Deutschland?
Große Ebenen sind am besten geeignet, während steigendes Gefälle die Bearbeitung erschwert und die Bodenerosion fördert. Das reliefbedingte Geländeklima kann die Vegetationszeit verkürzen oder begünstigen (z.B. Weinbau in Tälern).
Welche Hauptgruppen von Kulturarten (Landbauzonen) werden unterschieden?
Es werden vier Hauptgruppen unterschieden: Getreidebau, Hackfruchtbau, Futterbau und Sonderkulturen.
Wo liegen die Schwerpunkte des Getreidebaus in Deutschland?
Der Getreidebau dominiert entlang des Nordrands der Mittelgebirge aufgrund günstiger Boden- und Klimabedingungen.
Wo liegen die Schwerpunkte des Hackfruchtbaus in Deutschland?
Hackfrüchte werden vor allem in der Rheinischen Bucht, im Rhein-Main-Gebiet, im Würzburger Becken und anderen Regionen angebaut.
Wo liegen die Schwerpunkte des Futterbaus in Deutschland?
Der Futterbau konzentriert sich auf die Alpen, das Alpenvorland, die Hochlagen der Mittelgebirge und die Marschen (Grünlandgebiete).
Welche Beispiele für Sonderkulturen werden im Text genannt?
Beispiele sind Weinbau am Kaiserstuhl und an der Mosel, Baumschulen in der Pinneberger Geest, Hopfenanbau in der Hallertau und im Raum Tettnang, Gemüseanbau auf der Insel Reichenau sowie Obstbau am Bodensee und im Rhein-Main-Neckar-Gebiet.
Welche Veränderungen in der Landwirtschaft werden im Schlussteil des Textes erwähnt?
Es werden veränderte Anbauverhalten aufgrund von Nachfrage und EU-Bestimmungen (Subventionen), eine Zunahme der bearbeiteten Flächen aufgrund von Rückgang der Agrarbeschäftigten oder Rentabilitätsgründen sowie Flächenstillegungen zur Eindämmung von Überschüssen und Bodendegradierung erwähnt.
Wo findet man die wichtigsten Agrarprodukte in Deutschland?
Getreide findet man vor allem im Westen Deutschlands, Kartoffeln in Ostdeutschland, Zuckerrüben in Bördengebieten und im Rhein-Main-Neckar-Gebiet, Rinder- und Schweinehaltung in Nord- und Süddeutschland.
- Arbeit zitieren
- Ch. Naumann (Autor:in), 2001, Die Landbauzonen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100092