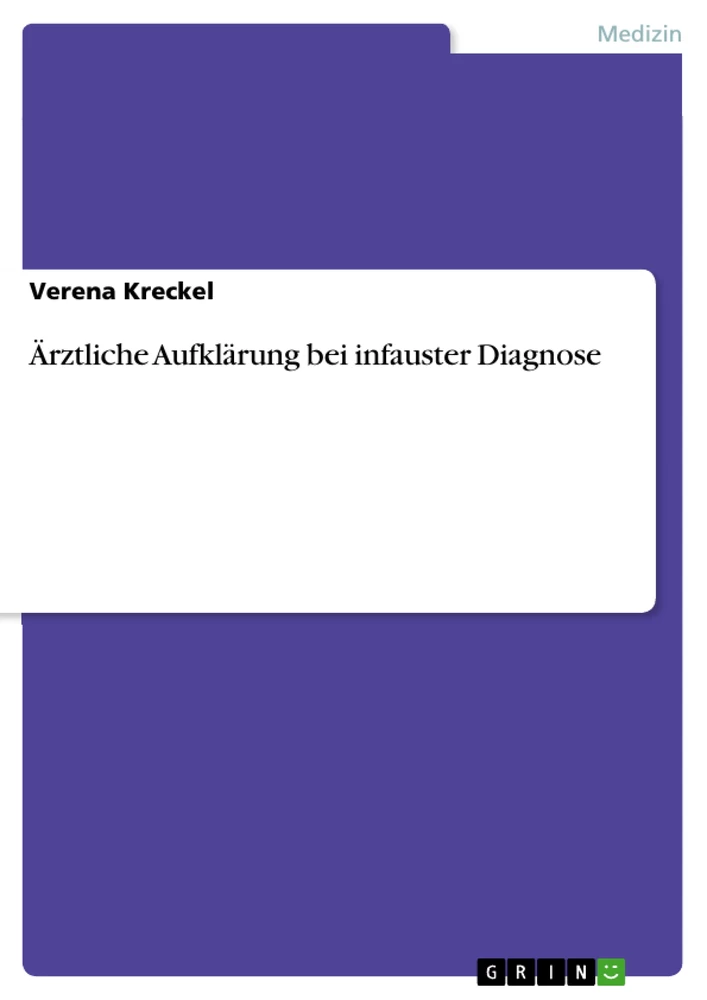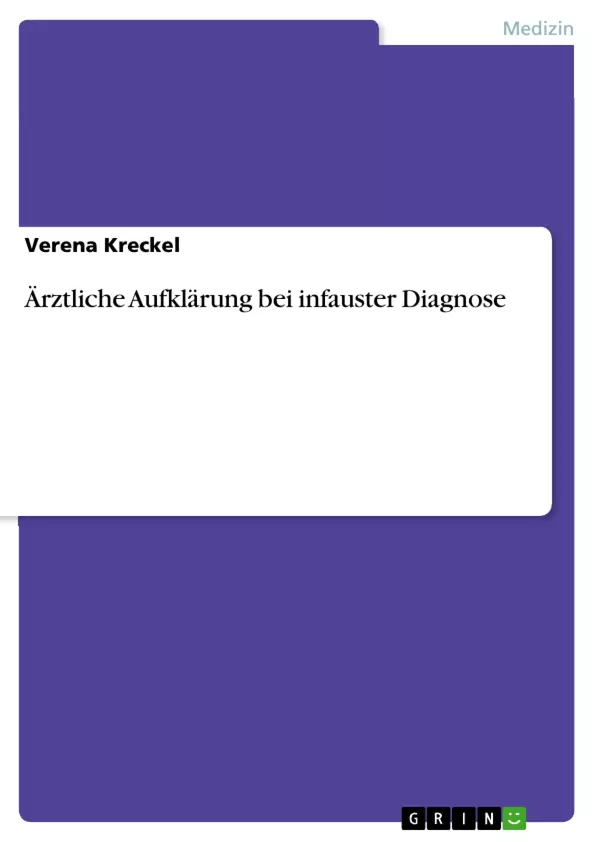Ärztliche Aufklärung bei infauster Diagnose
Problematik des Vermittelns schlechter Nachrichten
Problem
- Wissenschaftl. Reduktion: Gefühle in der Medizin nicht bedacht u. systematisch ausgeschaltet (biomechanische Medizin)
- Fachliche Kompetenz für kommunikative Arbeit beim Arzt unreflektiert vorausgesetzt
- Oft noch als „ärztliche Kunst“ aus dem Bereich des Lehr- u. Lernbaren ausgegrenzt
„ Ideologie der Ablehnung jeglicher Aufklärung “
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Patienten orientieren sich in ihrer veränderten Lebenssituation am gesamten Verhalten ihrer Bezugsperson - sie sind gegenüber allen Äußerungen, willkürlich gesteuerten u. unwillkürlichen, in höchstem Maße sensibilisiert.
Je mehr die Ärzte offene Kommunikation meiden, desto stärker fühlen die Patienten sich verunsichert und beachten bzw. „überinterpretieren“ indirekte Zeichen.
Gleichzeitig wird es auch für die Ärzte schwieriger, den Umgang des Patienten mit seiner Erkrankung zu beurteilen: Der Kranke wird seinerseits Mitteilungen zurückhalten, da er auf die ärztliche Schutz- und Abwehrhaltungen Rücksicht nimmt.
Offene Kommunikation - aber wie?
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Manual „Ärztliche Gesprächsführung + Mitteilung schwerwiegender Diagnosen“
Sterbephasen (nach E. Kübler-Ross)
Die Phasen können individuell in ihrer Reihenfolge variieren, wiederkehren, unterschiedlich lang sein oder auch gar nicht durchlaufen werden.
Phase 1: Nicht-Wahrhabenwollen und Isolierung
- Pat. leugnet, fordert neue Untersuchungen
- Schutzbehauptungen („Es ist ein Irrtum unterlaufen“, „Verwechslung geschehen“)
- Später: Pat. imponiert erstaunlich sachlich Motive des Patienten
- Muss leugnen, um weiter leben zu können (kann die Wahrheit noch nicht ertragen)
- Das Nicht-Wahrhabenwollen dient dem Aufbau einer inneren Verteidigung
- Isolierung (= künstl. Abtrennen der Gefühle vom gedankl. Inhalt) zur Trennung von Kenntnis der Diagnose
Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft
- Das Leugnen des Pat. sollte uneingeschränkt akzeptiert werden
- Evtl. Gespräche über den Tod anbieten, aber nur, wenn und solange der Pat. es wünscht
- Keine Vorwürfe, auch wenn der Pat. sich nicht an Verordnungen hält
Phase 2: Zorn
- „Warum gerade ich?“
- Pat. gesteht Krankheit u. Tod ein
- Niemand macht etwas richtig (Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige)
- Es entstehen Sonderwünsche, Forderungen, Streit, anspruchsvolle Haltung
Motive des Patienten
- Neid auf die Lebenden
- Angst zu sterben u. nach dem Tod vergessen zu werden
- Laut sein = „Ich lebe noch“
Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft
- Verständnis zeigen, Verärgerungen erzeugen neuen Groll
- Hinwendung u. Aufmerksamkeit vermittelt das Gefühl des Beachtetwerdens u. beruhigt den Pat., Zorn nicht persönlich nehmen
Phase 3: Verhandeln
- Tod wird als unvermeidbar erkannt
- Evtl. Handel mit Gott, um einen bestimmten Tag, um Schmerzfreiheit für eine gewisse Zeit, um Teilnahme an Ereignissen; Pat. bietet dafür z.B. Wohlverhalten, Therapieteilnahme
Motive des Patienten
- Hauptwunsch: Verlängerung der Lebensspanne Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft
- „Handel“ ermöglichen!
Phase 4: Depression
- Pat. kann nicht mehr leugnen (Krankheitsverlauf) · Gefühl des schrecklichen Verlustes
Motive des Patienten
- Pat. trauert um bereits verlorenen Lebensqualität u./od. um den bevorstehenden Verlust, z.B. von Familie, des Partners, des Lebens
- Pat. zieht Bilanz seines Lebens
Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft
- Still dabeisein, Trauer zulassen
- Anerkennung der Trauerarbeit des Pat. (Zustimmung)
- Hilfe bei der Bewältigung noch zu erledigender Dinge z.B. Testament, letzter Aufenthalt zu Hause
Phase 5: Zustimmung
- Pat. in ruhiger Erwartung, müde, oft schwach, wenig gesprächig, oft nur Gesten Motive des Patienten
- Emotionen sind ausgesprochen, Trauer, Wut, Neid liegen hinter ihm · Keine Resignation, sondern der Pat. nimmt sein Los an Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft
- Pat. in Ruhe, aber nicht allein lassen
- Gefühl vermitteln nicht vergessen zu werden, ohne hektische Betriebsamkeit
- Diese Phase ist nur mögl., wenn geholfen wurde, die anderen Phasen zu überwinden
Zielvorstellungen für die Betreuung Schwer- bzw. Totkranker
Rehabilitation = Maximum von Lebensqualität entsprechend den Bedürfnissen des Kranken u. seiner Persönlichkeit
1. Somatische Behandlung
- Ziel der kausalen Therapie
- Weitgehende Erhaltung bzw. Wiederherstellung aller Körperfunktionen u. des Wohlbefindens
- Sicherstellung entsprechender Befriedungsmöglichkeiten
- Optimale Schmerzbehandlung
2. Emotionales Gleichgewicht
- Stabile auf Kontinuität angelegte Arzt-Patient-Beziehung fi Grundgefühl von Sicherheit
- Verständnis durch Empathie u. Fachkompetenz fi Angst mindern, Depressionen auffangen od. in Trauerarbeit umwandeln
3. Selbstkonzept
- Optimale Therapie u. Beziehungsangebote
- Zufriedenheit mit dem eigenen Körperbild (Perücke bei Chemotherapie...)
- Partnerschaft mit dem Arzt, ausreichende Information fi autonomes Handeln, Strukturieren der momentanen Lebenssituation u. der Zukunft, Aufrechterhaltung der Eigenverantwortung für die Beziehungen in Familie u. Beruf
- Aktive Gestaltungsmöglichkeiten des Pat.
4. Soziale Beziehungen
- Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung
Kranke fürchten den sozialen Tod mehr als den physischen!
5. Ich-Funktion des Patienten
- Unterstützung, dass sie auf einem möglichst reifen, erwachsenen Niveau zu operieren vermögen
- Offene Information (Orientierungsbedürfnis) fi Ich-Autonomie gefördert, Integrität der Person
Ziel: Entwicklung eines festen Arbeitsbündnisses mit möglichst weitgehend informierten Pat. als Partnern in der Behandlung ihrer Erkrankung
Quellen:
- „Psychosoziale Kompetenz in der ärztlichen Primärversorgung“, Helmich u.a. - Springer 1991
- „Ärztliche Aufklärung bei infauster Diagnose“, H.P. Rosemeier- psychomed 6, 76-81 (1994)
- „Medizinische Psychologie und Soziologie“, Lang, Faller - Springer 1998
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptproblem bei der ärztlichen Aufklärung bei infauster Diagnose?
Das Hauptproblem liegt in der Vernachlässigung der Gefühle und der kommunikativen Kompetenz des Arztes. Die biomedizinische Medizin reduziert den Patienten oft auf rein physische Aspekte, während die Fähigkeit, schlechte Nachrichten zu vermitteln, unreflektiert vorausgesetzt oder als reine "ärztliche Kunst" betrachtet wird.
Warum ist offene Kommunikation so wichtig?
Patienten sind in ihrer veränderten Lebenssituation sehr sensibel für das Verhalten ihrer Bezugspersonen. Je mehr Ärzte offene Kommunikation meiden, desto stärker fühlen sich Patienten verunsichert und interpretieren indirekte Zeichen. Dies erschwert auch die Beurteilung des Patientenverhaltens für die Ärzte.
Welche Sterbephasen gibt es laut E. Kübler-Ross?
Laut E. Kübler-Ross gibt es fünf Sterbephasen: Nicht-Wahrhabenwollen und Isolierung, Zorn, Verhandeln, Depression und Zustimmung. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Phasen individuell variieren, wiederkehren, unterschiedlich lang sein oder auch gar nicht durchlaufen werden können.
Wie sollte der Arzt bzw. die Pflegekraft auf die Phase des Nicht-Wahrhabenwollens reagieren?
Das Leugnen des Patienten sollte uneingeschränkt akzeptiert werden. Gespräche über den Tod sollten nur angeboten werden, wenn und solange der Patient es wünscht. Es sollten keine Vorwürfe gemacht werden, auch wenn der Patient sich nicht an Verordnungen hält.
Wie sollte man mit dem Zorn des Patienten umgehen?
Es ist wichtig, Verständnis zu zeigen, da Verärgerungen neuen Groll erzeugen können. Hinwendung und Aufmerksamkeit vermitteln das Gefühl des Beachtetwerdens und beruhigen den Patienten. Der Zorn sollte nicht persönlich genommen werden.
Was ist das Ziel des Verhandelns in der Sterbephase?
Das Hauptziel des Patienten beim Verhandeln ist die Verlängerung der Lebensspanne. Dem Patienten sollte dieser "Handel" ermöglicht werden.
Wie sollte die Reaktion des Arztes bzw. der Pflegekraft in der Depressionsphase aussehen?
In der Depressionsphase ist es wichtig, still dazusein und die Trauer zuzulassen. Die Trauerarbeit des Patienten sollte anerkannt werden. Hilfe bei der Bewältigung noch zu erledigender Dinge, wie z.B. Testament oder letzter Aufenthalt zu Hause, sollte angeboten werden.
Was bedeutet die Zustimmungsphase?
In der Zustimmungsphase befindet sich der Patient in ruhiger Erwartung, ist müde, oft schwach und wenig gesprächig. Emotionen wie Trauer, Wut und Neid liegen hinter ihm. Der Patient nimmt sein Los an. Es ist wichtig, den Patienten in Ruhe zu lassen, aber nicht allein.
Was sind die Zielvorstellungen für die Betreuung Schwer- bzw. Totkranker?
Die Zielvorstellungen umfassen die Rehabilitation, also das Maximum von Lebensqualität entsprechend den Bedürfnissen des Kranken und seiner Persönlichkeit. Dazu gehören somatische Behandlung, emotionales Gleichgewicht, ein positives Selbstkonzept, die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und die Unterstützung der Ich-Funktion des Patienten.
Warum ist die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen so wichtig?
Kranke fürchten oft den sozialen Tod mehr als den physischen Tod. Daher ist die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der sozialen Beziehungen ein wichtiger Aspekt der Betreuung.
- Arbeit zitieren
- Verena Kreckel (Autor:in), 2000, Ärztliche Aufklärung bei infauster Diagnose, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100101