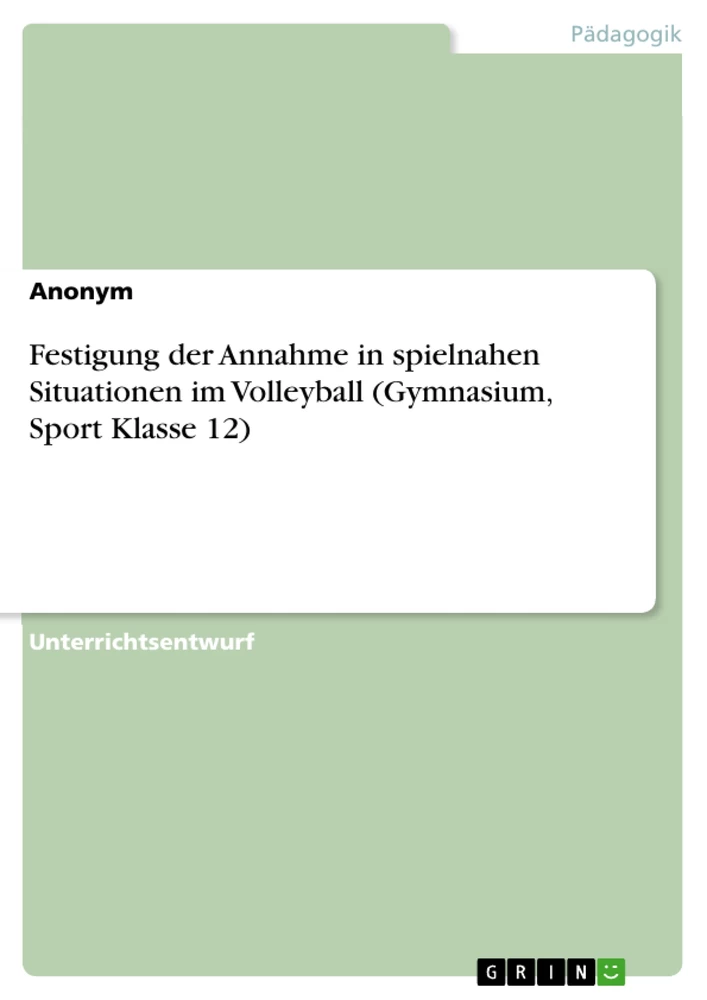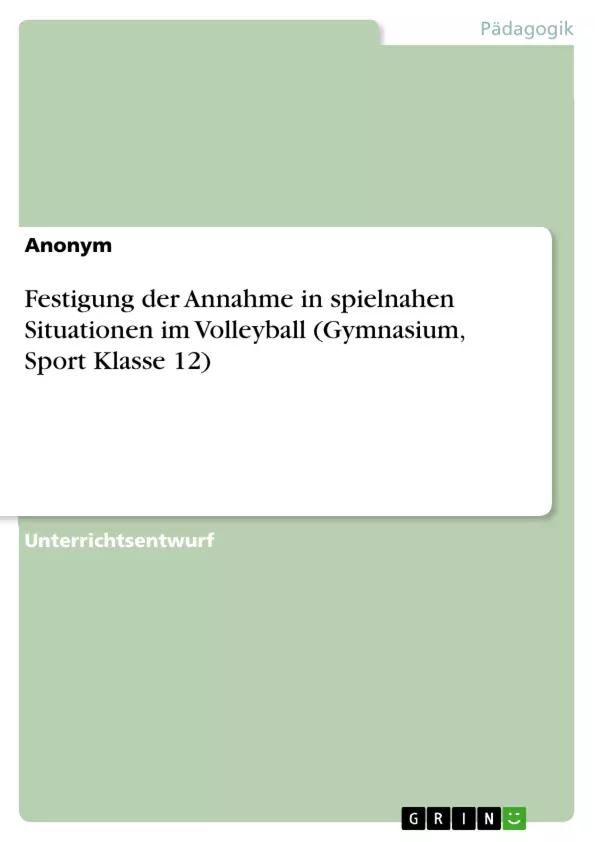Ziel dieses Unterrichtsentwurfes ist, dass die Schüler/innen ihre Spielfähigkeit im Volleyball verbessern, indem sie die Annahme (im Bagger) in spielnahen Situationen festigen. Teil des Entwurfes sind die Lernziele, Unterrichtsvoraussetzungen, didaktische Überlegungen, Methodik und ein Verlaufsplan.
Bei der Lehrkraft handelt es sich um eine Praktikantin, die im Rahmen ihres Vertiefenden Praktikums im Bachelor bereits fünf Schulstunden in diesem Kurs hospitiert hat und nun selbst eine Stunde abhält. Die Leistungsbereitschaft ist im Allgemeinen eher mittelmäßig ausgeprägt, generell sind die Schüler/innen jedoch kooperationsoffen.
Die Lerngruppe umfasst 9 Mädchen und 12 Jungen im Alter von 17-19 Jahren, die bereits in den vorausgehenden Stunden in die wichtigsten Grundtechniken des Volleyballspiels (Pritschen, Baggern) eingeführt worden sind. Im positionsgebundenen Spiel 2:2 wurde die Möglichkeit gegeben, diese Fertigkeiten zu festigen. Dennoch besteht eine starke Leistungsheterogenität: Während zwei der Schülerinnen im Verein aktiv sind, ist das Leistungsniveau im Kurs teilweise sehr niedrig. Bei einigen Schüler/innen bestehen immer noch große Defizite bei den Grundtechniken.
Inhaltsverzeichnis
- Lernziele
- Übergeordnetes Lernziel
- Teillernziele
- Motorische Ziele
- Kognitive Ziele
- Sozial-affektive Ziele
- Unterrichtsvoraussetzungen
- Eigene Tätigkeit des Lehrers
- Bild und Stand des Kurses
- Besondere Voraussetzungen
- Fachwissenschaftliche Bemerkungen
- Didaktische Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsplanung ist die Festigung der Annahmetechnik im Volleyball in spielnahen Situationen. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Spielfähigkeit der Schüler/innen durch die Verknüpfung motorischer, kognitiver und sozial-affektiver Lernziele. Die Stunde soll den Übergang vom positionsgebundenen zum situationsorientierten Spiel ermöglichen.
- Festigung der Annahmetechnik im Volleyball
- Übergang vom positionsgebundenen zum situationsorientierten Spiel
- Vermittlung taktischer Grundregeln des Volleyballspiels
- Förderung von Kooperation und Fairness
- Verbesserung der individuellen und gruppentaktischen Handlungskompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Lernziele: Dieses Kapitel definiert das übergeordnete Lernziel – die Verbesserung der Spielfähigkeit durch Festigung der Annahme – und unterteilt es in motorische, kognitive und sozial-affektive Teillernziele. Die motorischen Ziele konzentrieren sich auf die Verbesserung der Technik, während die kognitiven Ziele das Verständnis taktischer Regeln und der Spielidee betreffen. Die sozial-affektiven Ziele betonen Kooperation und Fairness.
Unterrichtsvoraussetzungen: Hier wird der Kontext der Stunde beschrieben, inklusive der Erfahrungsstufe der Lehrkraft (Praktikantin), der Zusammensetzung und des Leistungsniveaus der Lerngruppe (Leistungsheterogenität), sowie die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten (Doppelstunde, Hallenteil). Die Heterogenität in den Fertigkeiten der Schüler wird hervorgehoben, mit einigen Schülern, die bereits Vereinserfahrung haben und anderen, die noch große Defizite aufweisen.
Fachwissenschaftliche Bemerkungen: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Regeln und taktischen Aspekte des Volleyballs, insbesondere den Unterschied zwischen positionsgebundenem und situationsorientiertem Spiel. Es wird die Bedeutung der "Dreikontaktregel" und die Spielidee (Punkte erzielen und verhindern) herausgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des situationsorientierten Zweierblocks und der damit verbundenen Entscheidungsfindung der Spieler.
Didaktische Überlegungen: Dieser Abschnitt begründet die Wahl des Volleyballs im Rahmen des Lehrplans und betont die Bedeutung der individuellen und gruppentaktischen Handlungskompetenz. Die didaktischen Überlegungen beziehen sich auf die Erweiterung der Spielerfahrungen durch die Einführung des situationsorientierten Spiels, um Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit zu fördern. Der Bezug auf Brettschneider (1975) unterstreicht die Bedeutung der Spielfähigkeit als komplexes Konstrukt aus motorischen, kognitiven und sozial-affektiven Komponenten.
Schlüsselwörter
Volleyball, Annahmetechnik, Spielfähigkeit, positionsgebundenes Spiel, situationsorientiertes Spiel, Taktik, Kooperation, Fairness, Handlungskompetenz, Leistungsheterogenität, Dreikontaktregel.
Volleyball Unterrichtsplanung: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Unterrichtsplanung?
Diese Unterrichtsplanung für Volleyball umfasst ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Lernzielen (übergeordnet und unterteilt in motorische, kognitive und sozial-affektive Ziele), Unterrichtsvoraussetzungen (Lehrererfahrung, Schülerniveau, räumliche Gegebenheiten), fachwissenschaftliche Bemerkungen zum Volleyball (Regeln, Taktik, situationsorientiertes Spiel) und didaktische Überlegungen zur Gestaltung der Stunde. Zusätzlich werden die Zielsetzung, die Themenschwerpunkte und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel dargestellt. Schlüsselbegriffe runden die Planung ab.
Welche Lernziele werden in dieser Stunde verfolgt?
Das übergeordnete Lernziel ist die Verbesserung der Spielfähigkeit durch Festigung der Annahmetechnik im Volleyball. Die Teillernziele umfassen die Verbesserung der Annahmetechnik (motorisch), das Verständnis taktischer Regeln und der Spielidee (kognitiv), sowie die Förderung von Kooperation und Fairness (sozial-affektiv). Der Fokus liegt auf dem Übergang vom positionsgebundenen zum situationsorientierten Spiel.
Welche Voraussetzungen werden für den Unterricht benötigt?
Die Planung berücksichtigt die Heterogenität der Lerngruppe, mit Schülern unterschiedlicher Vorkenntnisse (einschließlich Schüler mit Vereinserfahrung). Die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten (Doppelstunde, Hallenteil) werden ebenfalls berücksichtigt. Die Lehrerfahrung (hier: Praktikantin) wird als Kontextinformation angegeben.
Welche fachwissenschaftlichen Aspekte werden behandelt?
Die Planung erläutert grundlegende Regeln und taktische Aspekte des Volleyballs, insbesondere den Unterschied zwischen positionsgebundenem und situationsorientiertem Spiel. Die "Dreikontaktregel" und die Spielidee (Punkte erzielen und verhindern) werden hervorgehoben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des situationsorientierten Zweierblocks und der damit verbundenen Entscheidungsfindung der Spieler.
Welche didaktischen Überlegungen liegen der Planung zugrunde?
Die didaktischen Überlegungen begründen die Wahl des Themas im Rahmen des Lehrplans und betonen die Bedeutung der individuellen und gruppentaktischen Handlungskompetenz. Die Einführung des situationsorientierten Spiels soll Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeit fördern. Der Bezug auf Brettschneider (1975) unterstreicht die Bedeutung der Spielfähigkeit als komplexes Konstrukt aus motorischen, kognitiven und sozial-affektiven Komponenten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Unterrichtsplanung?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Volleyball, Annahmetechnik, Spielfähigkeit, positionsgebundenes Spiel, situationsorientiertes Spiel, Taktik, Kooperation, Fairness, Handlungskompetenz, Leistungsheterogenität, Dreikontaktregel.
Worum geht es im Wesentlichen in dieser Unterrichtsplanung?
Diese Unterrichtsplanung beschreibt detailliert eine Volleyballstunde, die darauf abzielt, die Annahmetechnik zu verbessern und den Übergang vom positionsgebundenen zum situationsorientierten Spiel zu ermöglichen. Sie berücksichtigt dabei sowohl motorische, kognitive als auch sozial-affektive Lernziele und die Heterogenität der Lerngruppe.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Festigung der Annahme in spielnahen Situationen im Volleyball (Gymnasium, Sport Klasse 12), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001308