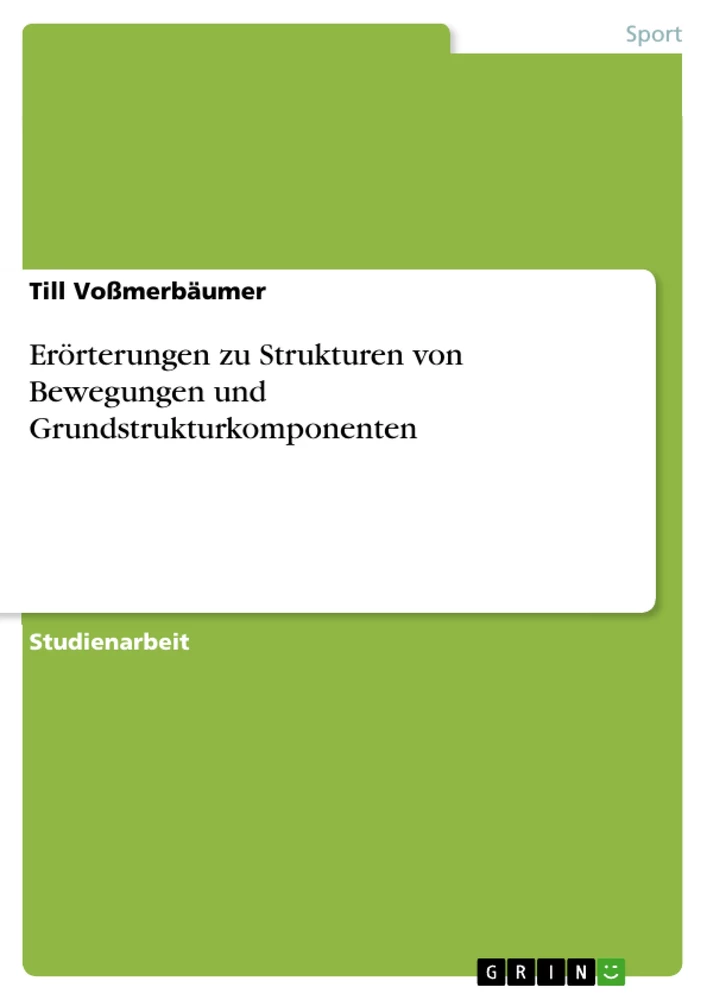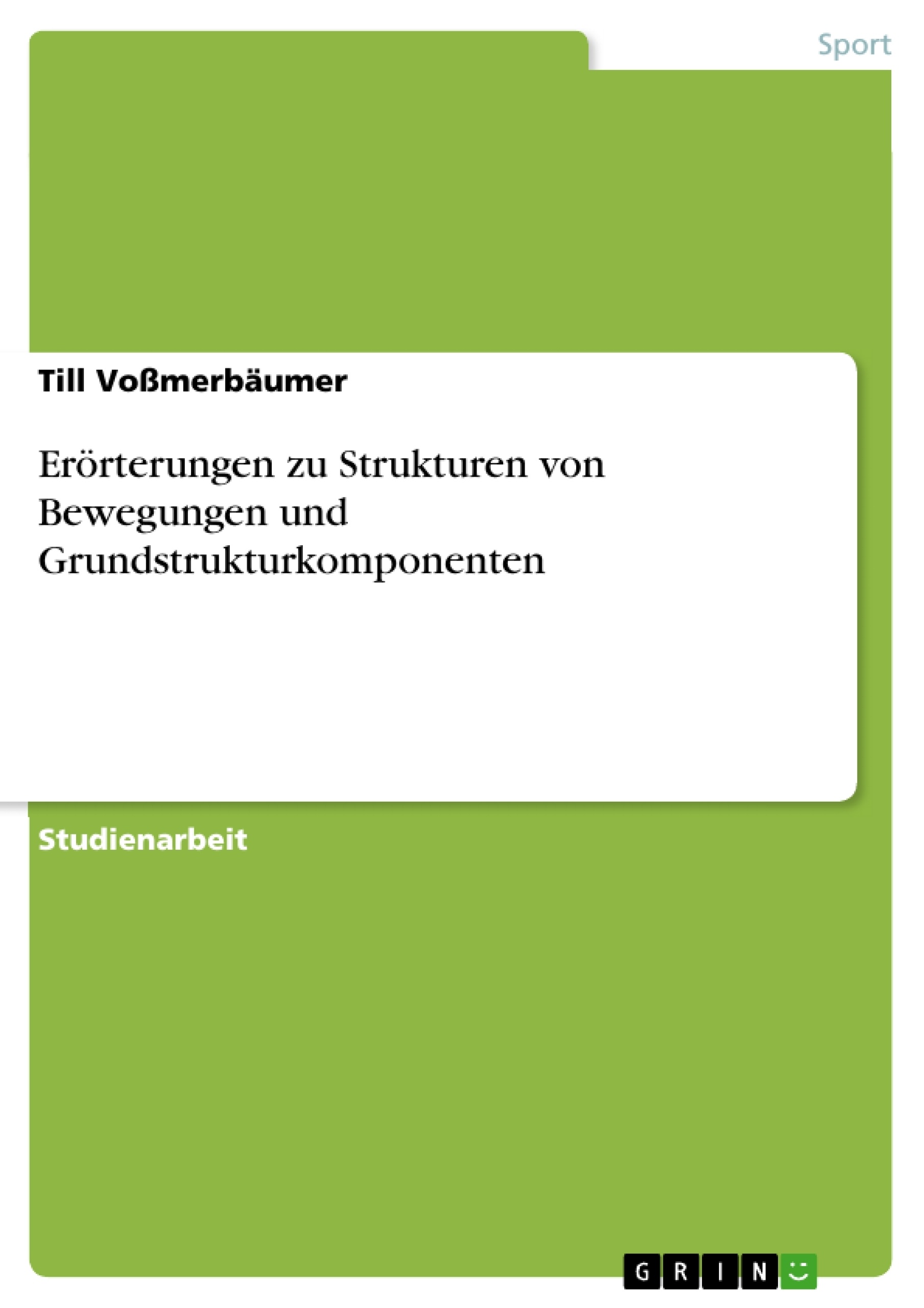Inhalt:
1 Struktur von Bewegungen und deren Analyse
1.1 Funktionsanalyse
1.2 Grundstrukturkomponenten
2 Allgemeine Strukturmerkmale von Bewegungshandlungen
2.1 Anlass: Antrieb bzw. Motivation
2.2 (eigene) Voraussetzungen: Koordination und Kondition
2.3 Orientierung und Erkenntnis
3 Literaturverzeichnis
1 Struktur von Bewegungen und deren Analyse
Zum strukturieren von Bewegungen griff man lange auf die sogenannte
„klassische Phasengliederung“ zurück, also das Einteilen einer Bewegung in zwei (Vorbereitung und Hauptphase) bzw. drei Phasen (Vorbereitung, Haupt- und Endphase). Aus dem Wissen heraus, das diese Gliederung in vielen Fällen zu wenig differenziert ist und daher eine Phase häufig sehr viele komplexe Elemente enthält suchte man nach neuen Möglichkeiten, Bewegungen zu strukturieren.
Ein Ansatz hierbei war die vierphasige Gliederung mit nun einleitender und überleitender Funktionsphase, der Haupt - Funktionsphase sowie der aussteuernden Funktionsphase, der allerdings das eigentliche Problem, nämliche ohne Kenntnis der eigentlichen Bewegung, eine Anzahl von Funktionsphasen festzulegen, nur verlagert.
1.1 Funktionsanalyse
Ein weiterer Ansatz zur Strukturierung von Bewegungen ist die allgemeine Gliederung in funktionelle Bestandteile, sogenannte Funktionsphasen. Diese Gliederung ist nahezu beliebig zu verfeinern und wird auf diese Weise eher einer spezifischen Bewegung gerecht, die Funktion einer Phase ist nicht schon, wie bei der klassischen- oder Vier - Phasen – Gliederung, festgelegt.1
Eine Funktionsphase kennzeichnet sich dadurch, daß die in dieser Phase ausgeführten Aktionen alle eine gemeinsame Funktion, entweder für das Ausüben der Bewegung oder in Bezug auf Ablauf oder Regel der Bewegungsausführung haben. Im Allgemeinen lassen die einzelnen Funktionsphasen zeitlich exakt abgrenzen.
Zur Funktionsanalyse sind zwei verschiedene Ansätze denkbar, sie kann induktiv, also von einer tatsächlichen Bewegung ausgehend stattfinden oder deduktiv, also von Regeln und dem Bewegungsziel ausgehend, gleichsam virtuell, stattfinden. Hierbei ist es möglich, zu völlig neuen, bisher nicht gedachten Bewegungsabläufen zu gelangen. Es werden hier allein ausgehend von den Vorgaben die aus Regeln und Bewegungsziel bekannt sind Teilziele erarbeitet, die erreicht werden müssen, um die Bewegungsaufgabe als Ganzes zu erfüllen,
diese Teilziele bringen möglicherweise neue Bedingungen mit sich, bis aus den Einzelnen schließlich eine Abfolge von Funktionsphasen wird, aus der sich eine Bewegung denken und kreieren läßt.
Ganz anders läuft die induktive Funktionsanalyse ab. Hierbei geht man von einer Tatsächlichen Bewegung aus, gliedert diese in Aktionen und faßt diese dann gegebenenfalls nach den Funktionen die in der jeweiligen Phase erfüllt werden zusammen. Auch bei der induktiven Funktionsanalyse ist es möglich, daß man auf Aktionen stößt, die nicht funktionell zu begründen sind oder gar „kontra – funktionell“ sind, diese sind dann überflüssig und können konsequenterweise weggelassen werden.
Ein Beispiel: Der „Grab“ – Start2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In diesem Beispiel habe ich den „Grab“ – Start in 5 Funktionsphasen unterteilt, ihn also induktiv analysiert. Einzig die erste Phase ist insofern nicht ganz definitionsgerecht, als sie mehrere Funktionen beinhaltet.
In Phase [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] bringt sich der Schwimmer / die Schwimmerin3zum Einen in eine regelgerechte Startposition auf dem Block, zum Anderen nimmt er eine „vorgespannte“ Haltung ein, die ihm die Möglichkeit zu einem kraftvollen Abspringen gibt, ohne dass er zuvor noch eine Ausholbewegung vollziehen muss. Außerdem erhält er durch das Umgreifen der Vorderkante des Blocks die
Möglichkeit, dem gesamten Körper einen vorwärtsgerichteten Drehimpuls [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] um die Körperquerachse zu geben. Dieser Drehimpuls wirkt während der Flugphase weiter und ermöglicht so zum Einen den möglichst weiten Sprung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], da der Schwimmer, physikalisch günstig, nach vorne oben abspringen kann und zum Anderen ein Eintauchen an einer Stelle , da der Drehimpuls im Flug weiter wirkt [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] und so den Oberkörper nach unten und die Beine nach oben bringt. Der Aufbau von Geschwindigkeit in Phase [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] erfolgt durch ein Strecken in allen Gelenken und ein schwungvolles Vorbringen der Arme bis zur „140° -Position“ um anschließend den gesamten Körper gespannt zu halten [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], was das Wirken der Impulse auf den Körper als Ganzes ermöglicht und der Körper somit in dieser Phase nicht mehr als in sich bewegliches System angesehen werden muss. Auch das Vorbringen der Arme erzeugt natürlich einen Drehimpuls. Dieser ist eindeutig gegen den in [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] beabsichtigten gerichtet. Aufgrund der hier aber bereits gestreckten Körperhaltung und des daraus resultierenden deutlich größeren Drehwiderstandes bzw. Trägheitsmomentes sollte dieser aber geringer sein als der in [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] erzeugte, so dass ein weiterhin vorwärtsgerichteter Drehimpuls um die Körperquerachse oder eine Parallele resultiert.
[...]
1 Kompletter Absatz nach Göhner 1992 Seite 124 - 134
2 In diesem Beispiel werde ich aus gegebenem Anlass auch die Zusammenhänge von Drehmoment, Drehimpuls und Trägheitsmoment erläutern. Vergl. auch Kassat, 1993 S. 92 - 117
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Inhalt:"?
Der Text befasst sich mit der Struktur von Bewegungen und deren Analyse, insbesondere unter Berücksichtigung der Funktionsanalyse. Es werden allgemeine Strukturmerkmale von Bewegungshandlungen, wie Anlass/Motivation, Voraussetzungen (Koordination und Kondition) sowie Orientierung und Erkenntnis, behandelt.
Was ist die Funktionsanalyse von Bewegungen?
Die Funktionsanalyse ist ein Ansatz zur Strukturierung von Bewegungen, bei dem diese in funktionelle Bestandteile, sogenannte Funktionsphasen, gegliedert werden. Jede Funktionsphase kennzeichnet sich dadurch, dass die darin ausgeführten Aktionen eine gemeinsame Funktion haben, entweder für die Ausübung der Bewegung oder in Bezug auf Ablauf oder Regel der Bewegungsausführung.
Welche Ansätze gibt es zur Funktionsanalyse?
Es gibt zwei verschiedene Ansätze zur Funktionsanalyse: induktiv und deduktiv. Die induktive Analyse geht von einer tatsächlichen Bewegung aus, während die deduktive Analyse von Regeln und dem Bewegungsziel ausgeht.
Was ist der Unterschied zwischen induktiver und deduktiver Funktionsanalyse?
Bei der induktiven Funktionsanalyse wird eine tatsächliche Bewegung in Aktionen gegliedert und diese dann nach den Funktionen zusammengefasst, die in der jeweiligen Phase erfüllt werden. Bei der deduktiven Funktionsanalyse werden, ausgehend von Regeln und Bewegungsziel, Teilziele erarbeitet, die erreicht werden müssen, um die Bewegungsaufgabe als Ganzes zu erfüllen.
Was wird am Beispiel des "Grab"-Starts erläutert?
Am Beispiel des "Grab"-Starts wird die induktive Funktionsanalyse veranschaulicht. Der Start wird in fünf Funktionsphasen unterteilt, wobei die Funktionen der einzelnen Phasen erläutert werden. Insbesondere werden die Zusammenhänge von Drehmoment, Drehimpuls und Trägheitsmoment angesprochen.
Was sind Grundstrukturkomponenten?
Der Text erwähnt Grundstrukturkomponenten, nennt diese aber nicht explizit. Dies bezieht sich wahrscheinlich auf die einzelnen Aktionen und Elemente innerhalb einer Bewegung, die für die Ausführung und das Erreichen des Bewegungsziels notwendig sind.
Welche Bedeutung haben Koordination und Kondition im Kontext von Bewegungshandlungen?
Koordination und Kondition werden als wichtige Voraussetzungen für die Ausführung von Bewegungshandlungen genannt. Sie beeinflussen die Qualität, Effektivität und Sicherheit der Bewegungsausführung.
- Quote paper
- Till Voßmerbäumer (Author), 2000, Erörterungen zu Strukturen von Bewegungen und Grundstrukturkomponenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100160