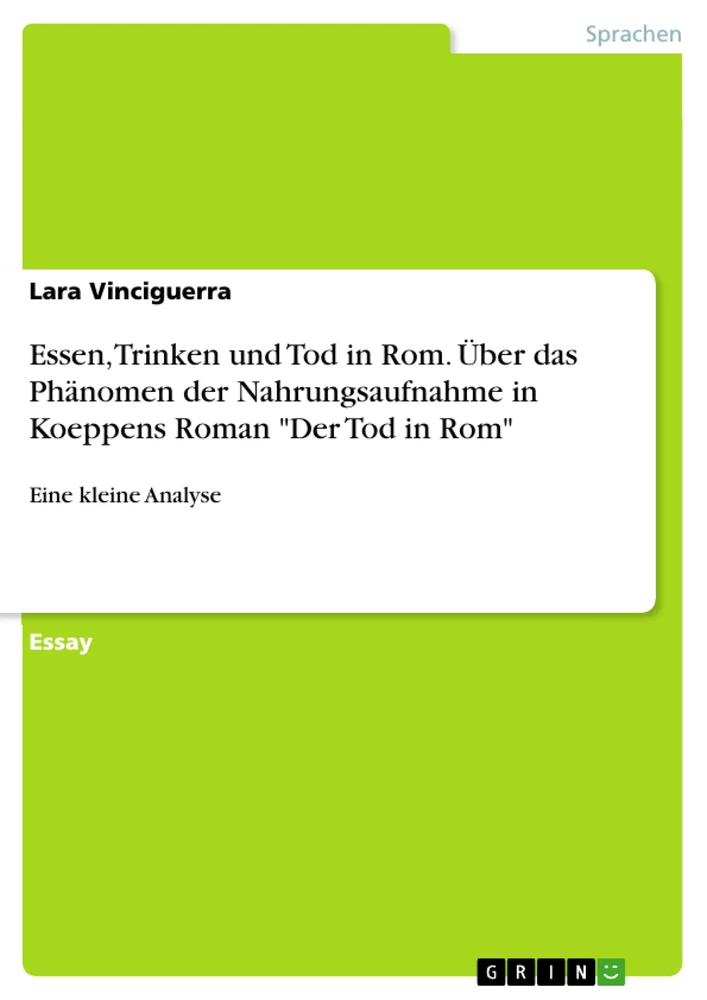Beinahe leitmotivisch eingesetzte, intertextuelle Bausteine, Querverweise und Metaphern bilden das literarische Fundament von Wolfgang Koeppens Trilogie des Scheiterns Scheiterns. In jedem Roman formal und inhaltlich anders eingebunden und verwendet, knüpft Koeppen aus dieser Montage Technik den roten Faden, der die drei Werke mit einander verbindet.
Seien es literarisch-kulturelle Verweise oder aber wiederkehrende, semantisch aufgeladene Motive beispielsweise in Gestalt von Tieren, Gegenständen oder Verhaltensweisen von Charakteren.
Im dritten und letzten Roman der Reihe, "Der Tod in Rom", ist eines dieser Elemente zweifelsohne die Nahrungsaufnahme, das Essen und das Trinken der Figuren.
Der vorliegende Text setzt sich anhand einzelner ausgewählter Beispiele mit den variierenden Darstellungen des Akts der Nahrungszufuhr verschiedener Charaktere auseinander - wann nimmt wer etwas wie und warum zu sich - denn es wird schnell deutlich, dass Nahrung, und der Umgang mit Nahrungsmitteln überhaupt, eine gesonderte Rolle im Roman spielen.
Welche Rolle das ist, soll im Folgenden erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Essen, Trinken und Tod in Rom – über das Phänomen der Nahrungsaufnahme in Koeppens Roman Der Tod in Rom. Eine kleine Analyse.
- Warum das Motiv „Essen und Trinken“?
- Essen und Trinken als Symbol für Figurenbeziehungen
- Essen und Trinken als Ausdruck von Sinnlichkeit und Existenz
- Judejahn und Kürenbergs: Ein Kontrast
- Essen und Trinken als Spiegelung der Charaktere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Rolle von Essen und Trinken in Wolfgang Koeppens Roman „Der Tod in Rom“. Ziel ist es, die vielfältigen Bedeutungen und Funktionen dieses Motivs zu beleuchten, um so ein tieferes Verständnis für die Charaktere und die Zeitgeschichte zu erlangen.
- Nahrungsaufnahme als Symbol für Freiheit und Unfreiheit in der Nachkriegszeit
- Essen und Trinken als Ausdruck von Figurenbeziehungen und sozialer Interaktion
- Die Rolle von Essen und Trinken in der Darstellung von Sinnlichkeit und Existenz
- Kontrastierende Essgewohnheiten und ihre Bedeutung für die Charakterisierung der Figuren
- Essen und Trinken als Spiegelbild der Archetypen der Kriegs- und Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Einleitung, die das Motiv "Essen und Trinken" im Kontext der Trilogie des Scheiterns von Wolfgang Koeppen einführt und die zentrale Rolle der Nahrungsaufnahme in "Der Tod in Rom" hervorhebt.
- Im zweiten Kapitel wird die Frage nach der Bedeutung des Motivs "Essen und Trinken" gestellt. Der Autor argumentiert, dass Essen in der Nachkriegszeit ein Symbol für Freiheit darstellte, aber gleichzeitig die Figuren des Romans in ihren Handlungen und Entscheidungen unfrei erscheinen lassen.
- Das dritte Kapitel untersucht die Funktion von Essen und Trinken als Symbol für Figurenbeziehungen. Der Autor analysiert zwei Textstellen im Roman: ein Zusammentreffen Siegfrieds mit einem Fremden in einer Schänke und die erste Begegnung zwischen Adolf und Siegfried im Hotelzimmer. Beide Szenen verdeutlichen, wie Nahrungsaufnahme die Interaktion zwischen den Figuren beeinflusst.
- Das vierte Kapitel beleuchtet die Ebene der Sinnlichkeit und Existenz, die durch das Motiv "Essen und Trinken" aufgezeigt wird. Der Autor stellt die Essgewohnheiten von Judejahn und Kürenbergs gegenüber und zeigt, wie diese ihre Charaktere und Lebensentwürfe widerspiegeln.
- Abschließend stellt der Autor fest, dass das Essverhalten der Figuren ihre Charaktere und die Archetypen der Kriegs- und Nachkriegszeit widerspiegelt. Er identifiziert verschiedene Charaktertypen, die durch ihre Art zu essen und trinken deutlich werden: Schuldige, Opportunisten, Orientierungslose und Leidende.
Schlüsselwörter
Der Tod in Rom, Wolfgang Koeppen, Nahrungsaufnahme, Esskultur, Nachkriegszeit, Freiheit, Unfreiheit, Figurenbeziehungen, Sinnlichkeit, Existenz, Archetypen, Kriegs- und Nachkriegszeit, Judejahn, Kürenbergs, Siegfried, Adolf.
- Arbeit zitieren
- Lara Vinciguerra (Autor:in), 2021, Essen, Trinken und Tod in Rom. Über das Phänomen der Nahrungsaufnahme in Koeppens Roman "Der Tod in Rom", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001930