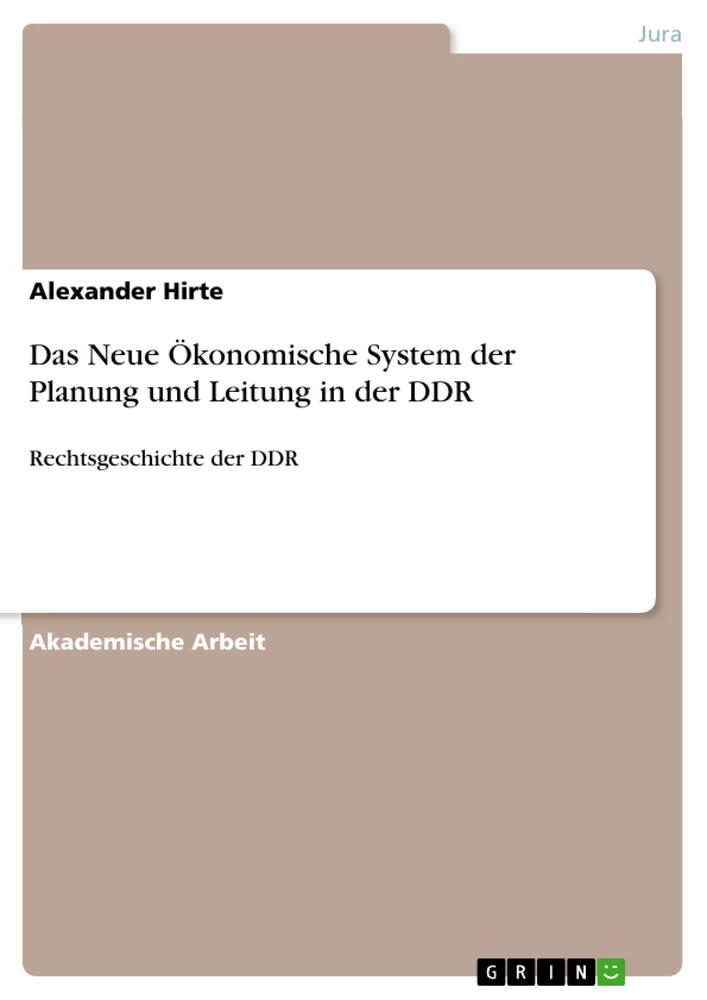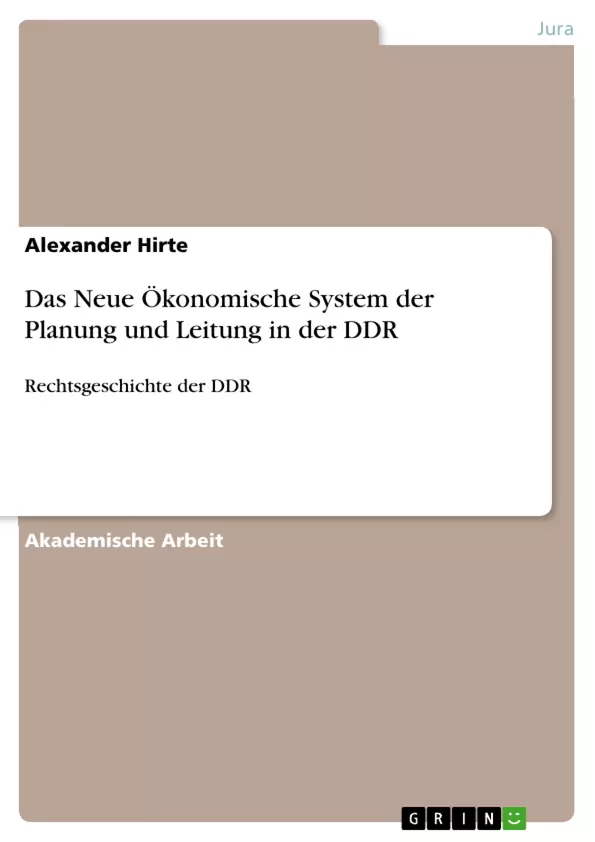Bei dem Neuen Ökonomischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft (NÖS oder NÖSPL) handelt es sich um eine Wirtschaftsreform Anfang der 1960er Jahre in der DDR, die durch die vorangegangene schwierige Wirtschaftslage und das Streben der Bevölkerung nach dem West-Niveau ausgelöst worden war und die sich auf alle Wirtschaftszweige der DDR erstreckte. Dabei sollte das bis dato geltende alte Planungssystem abgelöst und durch ein neues Anreizsystem ersetzt werden. Im Mittelpunkt standen die Einführung eines neuen Anreizsystems für die Beschäftigten, die Überarbeitung der Planaufstellung und die Reformierung der Preisbildung auf dem DDR-Markt.
Um die zeitgeschichtlichen Ereignisse verstehen und richtig einordnen zu können, behandelt diese Arbeit zunächst bewusst etwas ausführlicher die Ausgangssituation der DDR, da in dieser der Ursprung für das neue Ökonomische System liegt. Hierbei wird auch immer wieder ein Blick auf die parallele Entwicklung in der Bundesrepublik geworfen. Im Anschluss wird die Idee und theoretische Funktionsweise des neuen Ökonomischen Systems beschrieben. Aus der Einführung der damaligen Reform resultierte eine Masse an Maßnahmen für sämtliche Bereiche der DDR-Wirtschaft. Diese Arbeit beleuchtet daher nur beispielhaft einige wesentliche zentrale Säulen der Änderungen im Planungssystem der DDR. Dabei soll auch die Diskrepanz zwischen theoretischen Überlegungen und der Funktionsfähigkeit in der Praxis zur Geltung kommen. Diese Arbeit wirft zudem einen Blick auf den jeweiligen politischen Rückhalt der SED-Führung in der Bevölkerung und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Zuletzt sollen auch einige entscheidende politische Eckpunkte sowie das Scheitern des neuen Ökonomischen Systems erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. FORSCHUNGSSTAND-
- B. EINLEITUNG
- C. WIRTSCHAFTLICHE UND POLITISCHE AUSGANSSITUATION
- I. Die Nachkriegszeit in Ost und West
- II. Ein unfairer Neustart: Die 50er Jahre in Ost und West
- D. DAS NEUE ÖKONOMISCHE SYSTEM DER PLANUNG UND LEITUNG UND DAS RECHT-
- I. Reformentschluss und Diskussion um Evsej Liberman
- 1. Ziele des NÖS: Ziele und Inhalte der Reform
- II. System der ökonomischen Hebel
- 1. Ökonomische Hebel in der Praxis-
- 2. Effekte bei den Beschäftigten
- III. Industriepreisreform-
- IV. Änderungen im Planungssysstem der DDR-
- I. Reformentschluss und Diskussion um Evsej Liberman
- E. REZENTRALISIERUNG UND REFORMENDE
- F. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Einführung des Neuen Ökonomischen Systems (NÖS) der Planung und Leitung in der DDR in den 1960er Jahren und dessen Auswirkungen auf das DDR-Recht. Er analysiert die wirtschaftlichen und politischen Ausgangssituationen, die zur Einführung des NÖS führten, sowie die Ziele und Inhalte der Reform selbst. Der Text beleuchtet außerdem die Auswirkungen des NÖS auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft, wie z. B. die Rolle von ökonomischen Hebeln, die Industriepreisreform und die Änderungen im Planungssystem. Darüber hinaus werden die Reformen und Änderungen im Planungssystem der DDR im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes analysiert.
- Das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung (NÖS) in der DDR
- Die Rolle des Rechts im NÖS
- Die wirtschaftlichen und politischen Ausgangssituationen der DDR
- Die Auswirkungen des NÖS auf die Wirtschaft und die Gesellschaft
- Die Reformbewegungen und Veränderungen im Planungssystem der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
- A. FORSCHUNGSSTAND-: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema NÖS in der DDR und den Einfluss des Rechts auf dessen Umsetzung.
- B. EINLEITUNG: Dieser Abschnitt führt in das Thema ein und legt die zentralen Fragestellungen des Textes dar.
- C. WIRTSCHAFTLICHE UND POLITISCHE AUSGANSSITUATION: Dieser Abschnitt beschreibt die wirtschaftliche und politische Situation der DDR vor der Einführung des NÖS, mit besonderem Fokus auf die Nachkriegszeit und die 1950er Jahre.
- D. DAS NEUE ÖKONOMISCHE SYSTEM DER PLANUNG UND LEITUNG UND DAS RECHT-: Dieser Abschnitt analysiert die Einführung des NÖS, seine Ziele und Inhalte, sowie die Rolle des Rechts in seiner Umsetzung. Er beleuchtet die Diskussion um Evsej Liberman und seine Reformen, die Bedeutung von ökonomischen Hebeln, die Industriepreisreform und die Veränderungen im Planungssystem der DDR.
- E. REZENTRALISIERUNG UND REFORMENDE: Dieser Abschnitt untersucht die Weiterentwicklung des NÖS und die Reformen, die im Laufe der Zeit durchgeführt wurden.
Schlüsselwörter
Das Neue Ökonomische System (NÖS), Planung und Leitung, DDR-Recht, Wirtschaftsreform, Industriepreisreform, ökonomische Hebel, Reformen, Rezentrierung, Planwirtschaft, sozialistische Wirtschaft, politische und wirtschaftliche Entwicklung der DDR.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Neue Ökonomische System (NÖS) in der DDR?
Das NÖS war eine Wirtschaftsreform der 1960er Jahre in der DDR, die versuchte, die starre Planwirtschaft durch Leistungsanreize und mehr Eigenverantwortung der Betriebe effizienter zu gestalten.
Welche Ziele verfolgte die Reform?
Hauptziele waren die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Anpassung an das westliche Wirtschaftsniveau, eine Reform der Preisbildung und die Einführung materieller Anreize für Beschäftigte.
Was versteht man unter „ökonomischen Hebeln“?
Ökonomische Hebel waren Instrumente wie Gewinn, Preise und Prämien, die Betriebe und Arbeiter dazu motivieren sollten, effizienter zu produzieren und die Planvorgaben qualitativ besser zu erfüllen.
Warum war eine Industriepreisreform notwendig?
Die Preise in der DDR waren oft staatlich subventioniert und spiegelten nicht die tatsächlichen Produktionskosten wider. Die Reform sollte realistische Preise schaffen, um die Wirtschaftlichkeit messbar zu machen.
Wer war Evsej Liberman?
Liberman war ein sowjetischer Ökonom, dessen Theorien über die Bedeutung von Gewinn und Eigenverantwortung in sozialistischen Volkswirtschaften die theoretische Grundlage für das NÖS bildeten.
Woran scheiterte das NÖS schließlich?
Das System scheiterte an der Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, dem politischen Widerstand innerhalb der SED-Führung gegen zu viel Marktwirtschaft und der schließlich erfolgten Rezentralisierung unter Erich Honecker.
- Citation du texte
- Alexander Hirte (Auteur), 2018, Das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002022