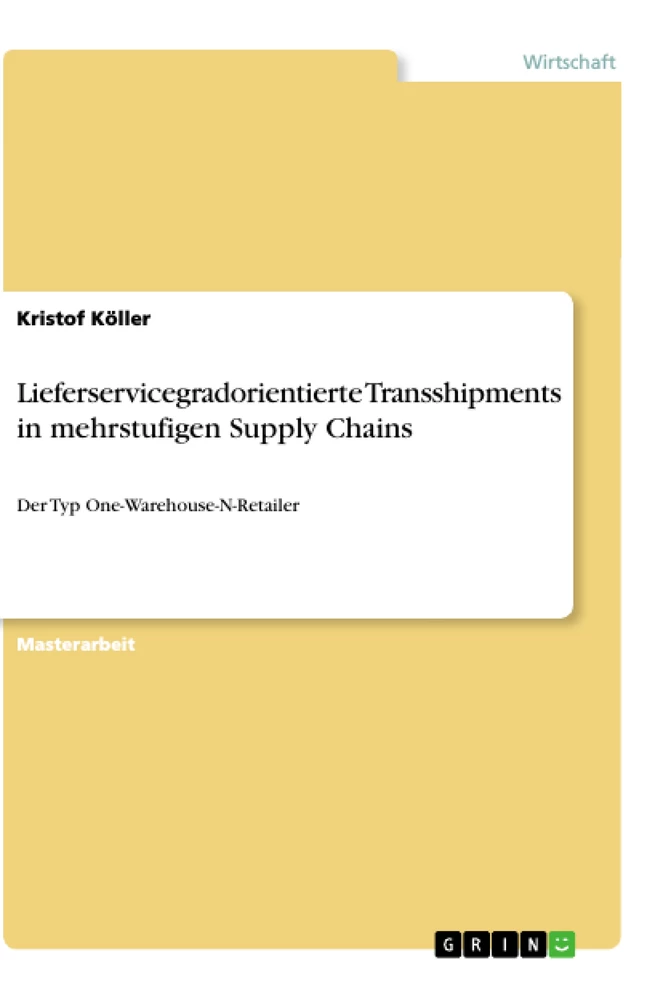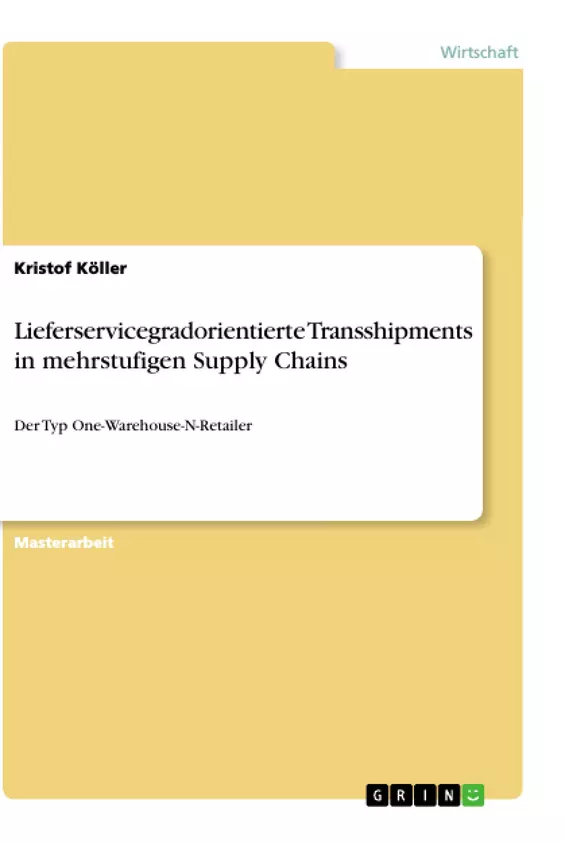Was ist zu tun, um mit möglichst niedrigen Beständen eine hohe Lieferbereitschaft sicherzustellen? Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit nach. Als effektive Maßnahme zur Beseitigung von Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage hat sich das Bestandspooling mittels Lateral Transshipments erwiesen. Hierbei fassen die Unternehmen einer Wertschöpfungsstufe ihre Bestände virtuell zusammen. Sofern sich ein Unternehmen einem (drohenden) Fehlbestand gegenübersieht, helfen ihm seine Partner mit Ausgleichslieferungen (Transshipments). Deren Vorteilhaftigkeit liegt darin begründet, dass die
Transshipment-Kosten i.d.R. deutlich niedriger ausfallen als jene Kosten, die mit einem Fehlbestand oder einer Notlieferung des Lieferanten einhergehen würden.
Da die Standorte nicht weit voneinander entfernt sind, ist die Transshipment-Lieferzeit wesentlich kürzer als die reguläre Wiederbeschaffungszeit. Transshipments ermöglichen so die Reduzierung der systemweiten Lagerbestände und Kosten bei Aufrechterhaltung des angestrebten Servicegrades. Das zweite Kapitel hat die Grundlagen des Supply Chain Management zum Gegenstand. Das Kapitel drei widmet sich der Bestandsallokation im dynamischen Umfeld. Einführend steht der Zielkonflikt des Bestandsmanagements im Blickpunkt. Anschließend wird das One-Warehouse-N-Retailer-Problem thematisiert.
Das Kapitel vier befasst sich mit dem TBS-Modell von Diks/de Kok, in dem ein divergierendes 2-Echelon-System mit Proactive Transshipments betrachtet wird. Im Kapitel fünf wird das Modell von Tagaras mit Emergency Transshipment untersucht. Im Fokus steht die Ausgestaltung der Transshipment-Politik. Zudem wird eine umfangreiche numerische Untersuchung durchgeführt. Diese bringt verlässliche Informationen über die Vorteilhaftigkeit von Transshipments hervor und zeigt auf, welche Struktur Pooling Groups vorweisen sollten, um effektiv zu arbeiten. Eine Möglichkeit der Implementierung von Transshipments wird im Kapitel sechs vorgestellt. Der in Maxima geschriebene Quellcode simuliert ein Ein-Perioden-Modell, das wiederholt durchlaufen wird. Das Kapitel sieben fasst schließlich die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen des Supply Chain Management
- 2.1 Begriffsverständnis
- 2.2 Ziele und Aufgaben
- 3 Bestandsallokation im dynamischen Umfeld
- 3.1 Zielkonflikt des Bestandsmanagements
- 3.2 Das One-Warehouse-N-Retailer-Problem
- 3.3 Effiziente Bestandshaltung mittels Transshipments
- 3.3.1 Idee und Einordnung
- 3.3.2 Literaturübersicht
- 3.3.3 Möglichkeiten der Klassifizierung
- 3.3.3.1 Modellierung von Transshipments
- 3.3.3.2 Ausgestaltung des Distributionssystems
- 3.3.3.3 Merkmale der Lagerüberwachung und Bestellpolitiken
- 4 Das TBS-Modell von Diks/de Kok
- 4.1 Annahmen und Modellstruktur
- 4.2 Darstellung des Materialflusses
- 4.2.1 Rationing policy des Zentrallagers
- 4.2.2 Rebalancing policy der Regionallager
- 4.3 Bestimmung der Kontrollparameter
- 4.3.1 Minimierung der erwarteten Transshipment-Menge
- 4.3.2 Einhaltung der Servicegrad-Restriktion
- 4.3.3 Minimierung der erwarteten Lagerhaltungskosten
- 4.4 Erweiterungen des Basismodells
- 4.4.1 N-echelon-Systeme
- 4.4.2 Einführung eines Rebalancing-Levels
- 4.5 Numerische Erkenntnisse
- 5 Das Tagaras-Modell
- 5.1 Annahmen und Kostenfunktion
- 5.2 Transshipment-Politiken
- 5.3 Numerische Untersuchungen
- 5.3.1 Vorgehen und Parameter-Struktur
- 5.3.2 Bedeutung der Transshipment-Politik
- 5.3.3 Sensitivitätsanalyse
- 5.3.4 Vorteile des Pooling
- 5.3.5 Kosten des Vorhaltens mehrerer Lager
- 5.4 Heuristische Vereinfachung
- 6 Implementierung eines Transshipment-Modells in Maxima
- 6.1 Entstehung und Wesen von Maxima
- 6.2 Vorbemerkungen zur Implementierung
- 6.3 Erläuterung des Quellcodes
- 7 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Anhang 1: Quellcode der Implementierung
- Anhang 2: Ausgabe des Quellcodes für 10 Perioden
- Anhang 3: Mögliche Erweiterung des Quellcodes
- Analyse der Auswirkungen von Transshipments auf den Lieferservicegrad
- Modellierung und Optimierung von Transshipment-Strategien
- Bewertung verschiedener Transshipment-Modelle hinsichtlich Kosten und Servicegrad
- Implementierung eines Transshipment-Modells in Maxima
- Untersuchung von Sensitivitäten und Optimierungspotenzialen
- Kapitel 1: Einleitung Diese Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und stellt den Hintergrund sowie die Relevanz der Untersuchung von Transshipments in Supply Chains dar.
- Kapitel 2: Grundlagen des Supply Chain Management Dieses Kapitel vermittelt die grundlegenden Konzepte des Supply Chain Managements, beleuchtet die verschiedenen Ziele und Aufgaben sowie die Bedeutung von effizienter Bestandsallokation.
- Kapitel 3: Bestandsallokation im dynamischen Umfeld In diesem Kapitel wird der Zielkonflikt des Bestandsmanagements behandelt. Dabei wird das One-Warehouse-N-Retailer-Problem als relevantes Szenario für die Untersuchung von Transshipments eingeführt.
- Kapitel 4: Das TBS-Modell von Diks/de Kok Dieses Kapitel widmet sich dem TBS-Modell von Diks/de Kok, einem bekannten Modell für die Analyse von Transshipments. Es werden die Annahmen des Modells, die Struktur, die Darstellung des Materialflusses und die Bestimmung der Kontrollparameter behandelt.
- Kapitel 5: Das Tagaras-Modell Das Tagaras-Modell wird in diesem Kapitel ausführlich analysiert. Es werden die Annahmen, die Kostenfunktion, verschiedene Transshipment-Politiken und die Ergebnisse numerischer Untersuchungen vorgestellt.
- Kapitel 6: Implementierung eines Transshipment-Modells in Maxima In diesem Kapitel wird die Implementierung eines Transshipment-Modells in Maxima beschrieben. Es werden die Entstehung und Funktionsweise von Maxima sowie die wichtigsten Aspekte der Implementierung erläutert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Optimierung von Lieferketten im Kontext von Transshipments. Das Hauptziel ist es, die effiziente Allokation von Beständen in dynamischen Umgebungen zu untersuchen und dabei insbesondere auf die Auswirkungen von Transshipments auf den Lieferservicegrad zu fokussieren. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle und untersucht deren Auswirkungen auf die Kosten und den Servicegrad in einem mehrstufigen Supply Chain-System vom Typ One-Warehouse-N-Retailer.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Supply Chain Management, Transshipments, Bestandsallokation, Lieferservicegrad, One-Warehouse-N-Retailer-Problem, TBS-Modell, Tagaras-Modell, Maxima, Modellierung, Optimierung, Kosten, Servicegrad, Sensitivitätsanalyse
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Lateral Transshipments“?
Es handelt sich um Ausgleichslieferungen zwischen Unternehmen derselben Wertschöpfungsstufe, um Fehlbestände an einem Standort durch Überschüsse an einem anderen auszugleichen.
Welchen Vorteil bietet Bestandspooling?
Es ermöglicht die Reduzierung systemweiter Lagerbestände und Kosten, während gleichzeitig ein hoher Lieferservicegrad aufrechterhalten wird.
Was ist der Unterschied zwischen proaktiven und Emergency Transshipments?
Proaktive Transshipments erfolgen zur präventiven Bestandsverteilung (z.B. TBS-Modell), während Emergency Transshipments erst bei drohendem oder eingetretenem Fehlbestand ausgelöst werden.
Was ist das One-Warehouse-N-Retailer-Problem?
Ein klassisches Supply-Chain-Szenario, bei dem ein zentrales Lager mehrere regionale Einzelhändler beliefert und die optimale Bestandsallokation berechnet werden muss.
Welche Rolle spielt die Software Maxima in dieser Arbeit?
In Maxima wurde ein Quellcode implementiert, der ein Ein-Perioden-Modell für Transshipments simuliert, um die theoretischen Modelle numerisch zu prüfen.
Warum sind Transshipment-Kosten meist niedriger als Notlieferungskosten?
Da die Standorte innerhalb einer Stufe oft geografisch nah beieinander liegen, sind die Transportwege kürzer und die Reaktionszeiten schneller als bei einer Nachbestellung beim Lieferanten.
- Citation du texte
- Kristof Köller (Auteur), 2012, Lieferservicegradorientierte Transshipments in mehrstufigen Supply Chains, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002166