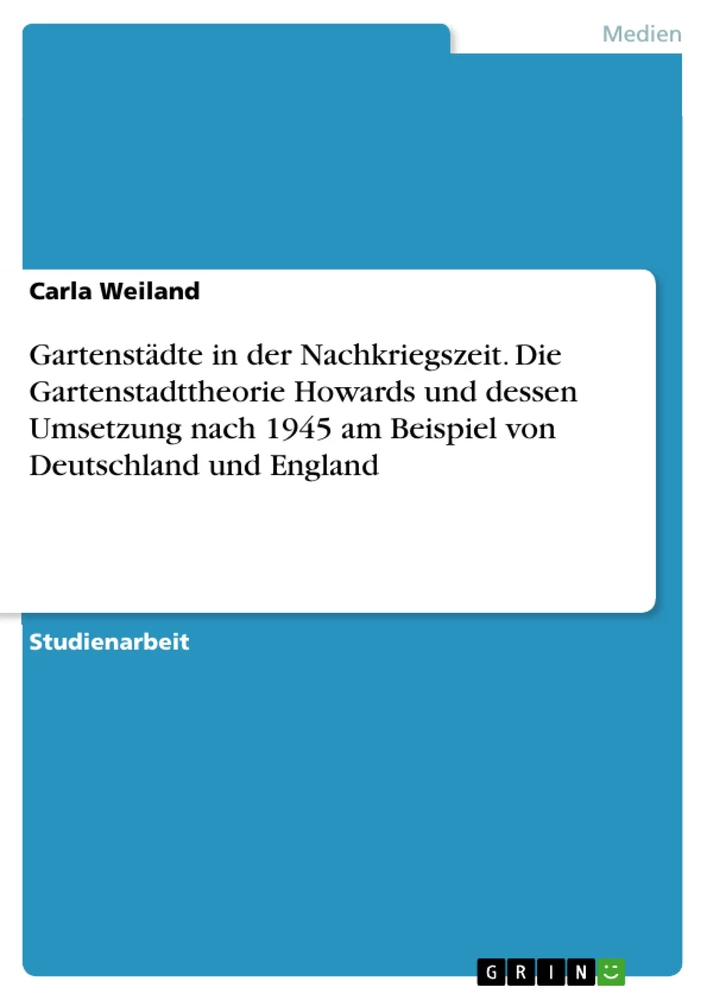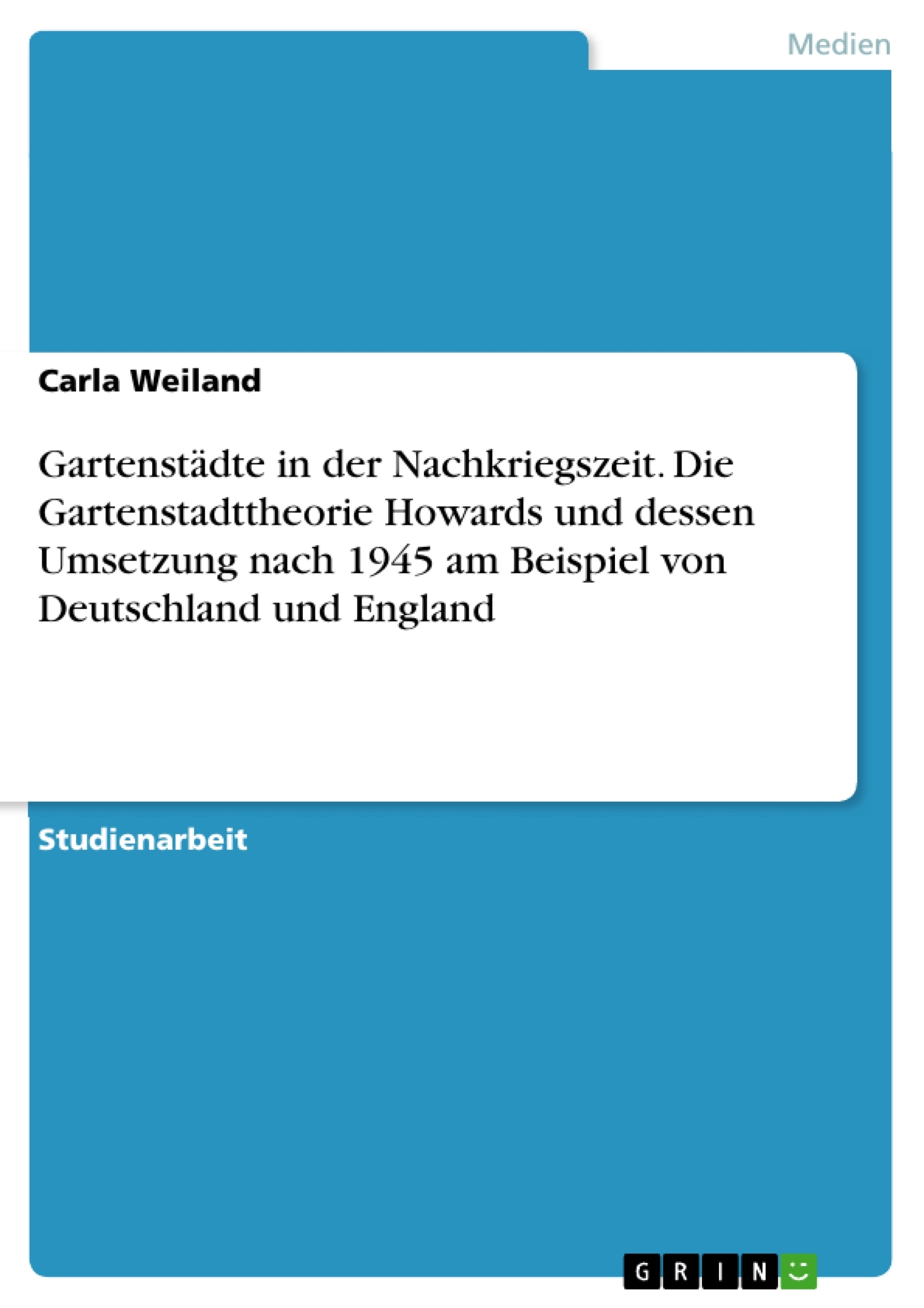In der folgenden Arbeit soll untersucht werden, inwieweit das ursprüngliche Konzept Howards nach dem Krieg umgesetzt wurde. Für die Analyse werden 2 Gartenstädte Deutschlands, die Gartenstädte Hamburg Farmsen und Bremen Vahr, sowie die englische New Town Harlow durchleuchtet und mit den Leitideen des Gartenstadt Vaters verglichen.
Der englische Stadtplaner Ebenezer Howard entwickelte damals die Idee der Gartenstadt. Durch eine vollkommen neue Herangehensweise an die Planung wollte er ein Modell schaffen, welches nachhaltig zu einer Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung Englands führen sollte. Das Konzept soll die positiven Aspekte der Stadt und des Landes verbinden. Themen wie Funktionstrennung, eine strukturierte Stadteinteilung mit differenzierten öffentlichen Freiräumen und einer autarken öffentlichen und sozialen Infrastruktur und Versorgung spielten eine übergeordnete Rolle und sollten das Leben der Bewohner auf Dauer positiv beeinflussen. Genau dieses Modell, welches bereits im 19. Jahrhundert zu einem regelrechten Bauboom führte, sollte nun zu neuem Leben erweckt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Stunde Null
- Gartenstädte in Deutschland
- Neue Heimat
- Gartenstadt Hamburg Farmsen
- Organisation und Durchsetzung
- Städtebauliche Struktur
- Mobilität
- Soziale Ausgewogenheit
- Gartenstadt Bremen Vahr
- Organisation und Durchsetzung
- Städtebauliche Struktur
- Mobilität
- Soziale Ausgewogenheit
- In wie weit entsprechen Farmsen und Vahr der Leitidee
?
- Gartenstädte in England
- New Towns Act
- Organisation und Durchsetzung
- Städtebauliche Struktur
- Mobilität
- Soziale Ausgewogenheit
- Der Vergleich mit Howard
- New Towns Act
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung der Gartenstadttheorie von Ebenezer Howard in Deutschland und England nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie analysiert, inwiefern die Leitideen der Gartenstadt in den beiden Ländern realisiert wurden und welche spezifischen Herausforderungen und Entwicklungen in der Nachkriegszeit die Gestaltung von Gartenstädten beeinflussten.
- Die Rolle der Gartenstadt im Kontext des Wiederaufbaus nach dem Krieg
- Vergleich der Umsetzung von Howards Konzepten in Deutschland und England
- Analyse städtebaulicher Strukturen, Mobilitätskonzepte und sozialer Ausgewogenheit in ausgewählten Gartenstädten
- Kritik und Weiterentwicklung des Gartenstadtmodells im 20. Jahrhundert
- Relevanz der Gartenstadtidee für aktuelle städtebauliche Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung skizziert die historische Situation in Deutschland und England nach dem Zweiten Weltkrieg und stellt die Relevanz der Gartenstadtidee für den Wiederaufbau heraus.
- Das Kapitel über die Gartenstädte in Deutschland analysiert zwei Fallstudien: Hamburg Farmsen und Bremen Vahr. Es untersucht die Organisation, die städtebauliche Struktur, Mobilität und soziale Ausgewogenheit dieser Siedlungen und diskutiert, inwiefern sie den Leitideen der Gartenstadt entsprechen.
- Das Kapitel über die Gartenstädte in England fokussiert auf die New Town Harlow und beleuchtet die Umsetzung des New Towns Act, die städtebauliche Struktur, Mobilität und soziale Ausgewogenheit dieser Siedlung.
Schlüsselwörter
Gartenstadt, Ebenezer Howard, Nachkriegszeit, Wiederaufbau, Stadtplanung, Städtebau, Deutschland, England, Hamburg Farmsen, Bremen Vahr, Harlow, New Town Act, soziale Ausgewogenheit, Mobilität, städtebauliche Struktur, Leitideen, Theorie, Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernkonzept der Gartenstadttheorie von Ebenezer Howard?
Ebenezer Howard wollte mit der Gartenstadt die positiven Aspekte von Stadt und Land verbinden, um die Lebensumstände nachhaltig zu verbessern. Wichtige Themen waren Funktionstrennung, strukturierte Stadteinteilung und eine autarke soziale Infrastruktur.
Welche deutschen Beispiele für Gartenstädte werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Gartenstädte Hamburg Farmsen und Bremen Vahr, die im Hinblick auf ihre städtebauliche Struktur und Mobilität untersucht werden.
Welches englische Beispiel wird zum Vergleich herangezogen?
Als englisches Beispiel dient die New Town Harlow, die im Kontext des New Towns Act und der Leitideen Howards durchleuchtet wird.
Welche Rolle spielt die Nachkriegszeit für die Gartenstadtentwicklung?
Nach 1945 sollte das Modell der Gartenstadt zu neuem Leben erweckt werden, um den Herausforderungen des Wiederaufbaus und der Wohnungsnot zu begegnen.
Was wird unter "sozialer Ausgewogenheit" im Kontext dieser Arbeit verstanden?
Es wird untersucht, wie die städtebauliche Planung dazu beitragen kann, eine stabile und gemischte Bewohnerstruktur zu fördern und die Lebensqualität dauerhaft positiv zu beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Carla Weiland (Autor:in), 2020, Gartenstädte in der Nachkriegszeit. Die Gartenstadttheorie Howards und dessen Umsetzung nach 1945 am Beispiel von Deutschland und England, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002367