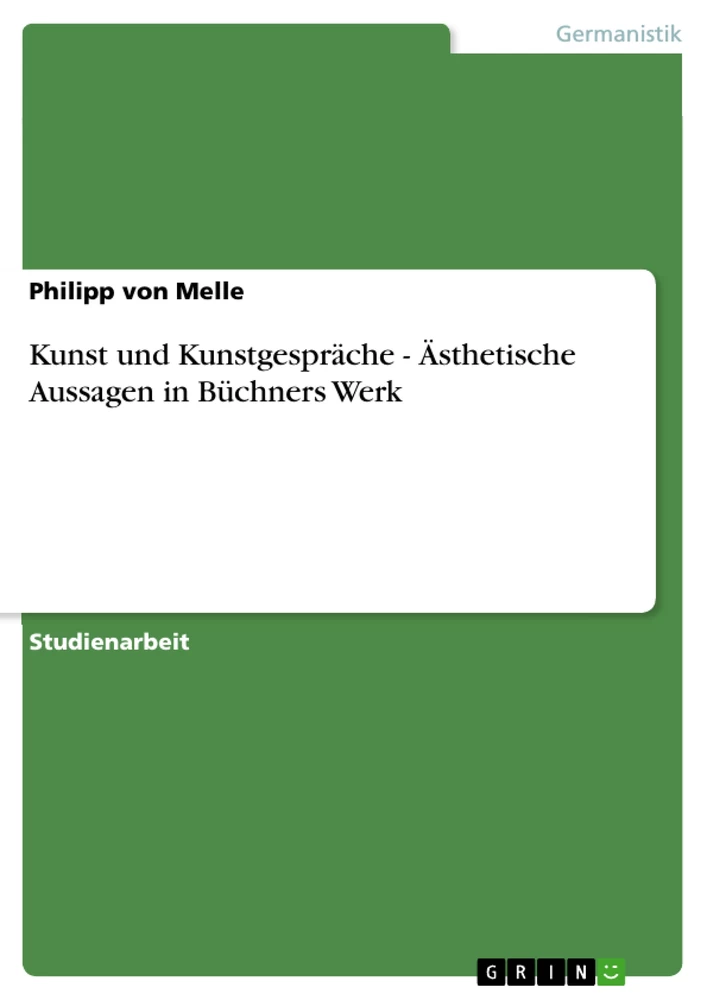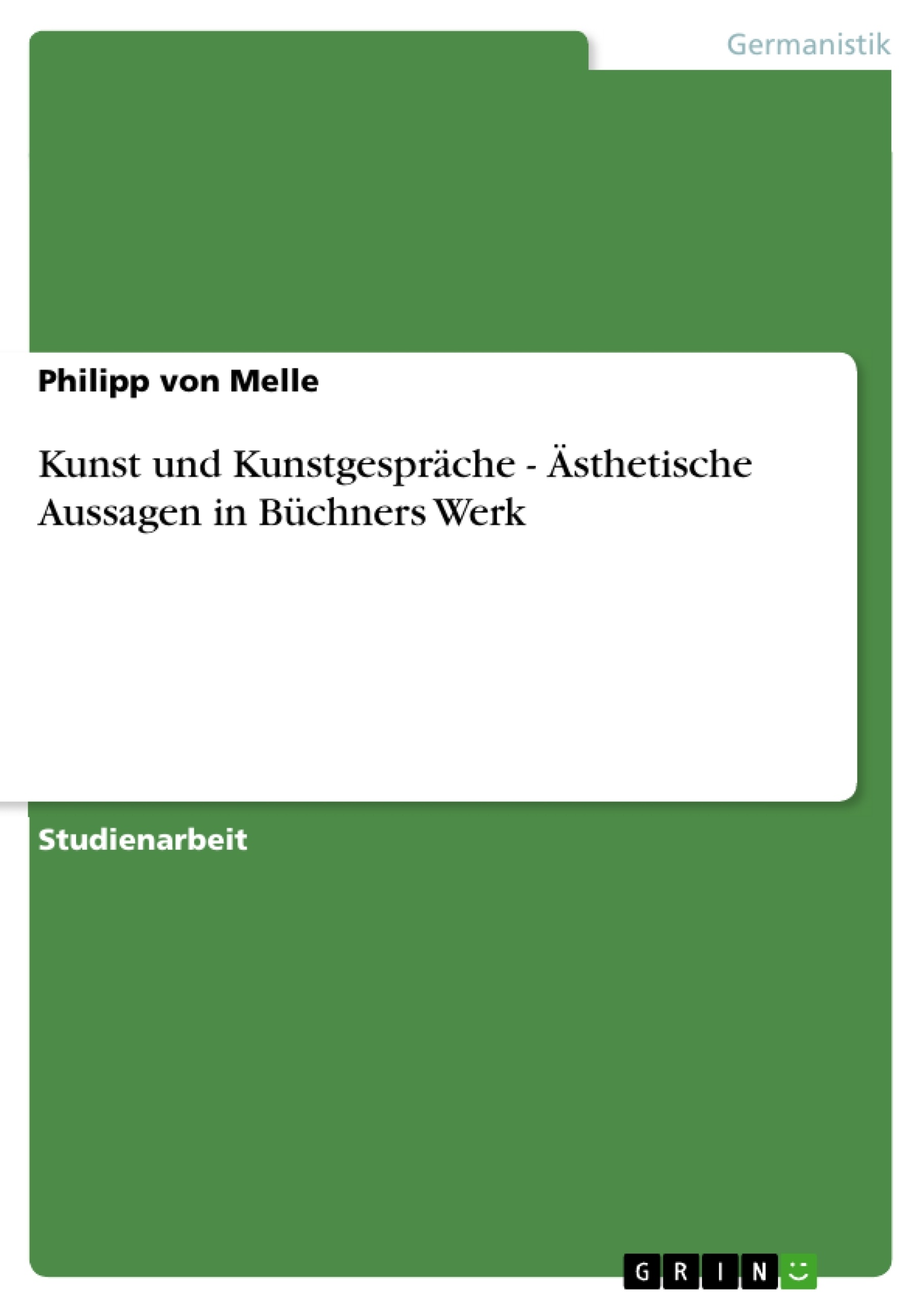Was bedeutet es, die Welt durch die Augen eines Künstlers zu sehen, dessen Realität sich in den Abgrund des Wahnsinns verschiebt? Diese tiefgründige Analyse von Georg Büchners Werken, insbesondere "Lenz" und "Dantons Tod", enthüllt die obsessive Auseinandersetzung des Autors mit der Beziehung zwischen Kunst, Wirklichkeit und der menschlichen Existenz. Tauchen Sie ein in die Welt des Dichters Lenz, dessen zerrüttete Wahrnehmung die Frage aufwirft, inwieweit Kunst eine Flucht vor oder eine Spiegelung der Realität darstellt. Erforschen Sie die romantischen Ursprünge von Büchners Kunstverständnis, seine Kritik an idealistischen Darstellungen und sein Plädoyer für eine schonungslose, authentische Wiedergabe der Natur und des menschlichen Seins. Entdecken Sie, wie Büchner in "Dantons Tod" die französische Revolution als Bühne für eine tiefere Auseinandersetzung mit Determiniertheit, Sprache und zwischenmenschlicher Entfremdung inszeniert. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung von Sprache als Ausdrucksmittel und als Barriere, die sowohl die politische als auch die persönliche Sphäre prägt. Luciles verzweifelter Ausruf "Es lebe der König" wird als ein Akt der Selbstermächtigung inmitten des Chaos gedeutet, während Dantons Unfähigkeit zur Kommunikation seine Verurteilung vorwegnimmt. Diese Arbeit untersucht, wie Büchner durch den Einsatz verschiedener Sprachmodi und die Darstellung existenzieller Konflikte eine einzigartige künstlerische Vision entwirft, die bis heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Literaturwissenschaft, deutsche Klassik, Romantik, Philosophie und die Abgründe der menschlichen Psyche interessieren. Ergründen Sie die Wurzeln von Büchners künstlerischem Schaffen und seine bahnbrechenden Einsichten in die conditio humana, die ihn zu einem der bedeutendsten Dramatiker und Denker des 19. Jahrhunderts machen. Lassen Sie sich von Büchners Sprachgewalt und seiner schonungslosen Ehrlichkeit in den Bann ziehen und entdecken Sie neue Perspektiven auf die Kunst und das Leben.
Inhalt
1. Einleitung
2. Lenz
2.1. Lenz und die Wirklichkeit
2.2. Das Kunstgespräch im Lenz
2.3. Kunst als Notwendigkeit
3. Romantische Ursprünge
3.1. Die Definition von Kunst - Büchners Antwort
4. Inszenierung eines historischen Sachverhaltes als Transfer in die Kunst
4.1. Dantons Tod
4.2. Determiniertheit in Dantons Tod
4.3. Der Dialog
4.4. Sexualität
5. Fazit
6. Literaturangaben
1. Einleitung
Georg Büchner ist nicht einmal 24 Jahre alt geworden; in seinem kurzen und bewegten Leben hat er außer den Schriften seiner Gymnasialzeit wenige Werke hinterlassen, nämlich den Hessischen Landboten, Dantons Tod, Leonce und Lena, Lenz und Woyzeck. Abgesehen vom Hessischen Landboten und von Dantons Tod haben die Texte aber keinen eindeutigen politischen Bezug; selbst in Dantons Tod findet man die Geschehnisse der Französischen Revolution als Gerüst wieder, das von Büchner zur Plattform einer anderen Handlungsebene wird, in der die Personen durch andere Faktoren als die konkret politischen beeinflußt sind. Gerade in der Inszenierung Dantons wird von einigen eine Vorstufe zum Dandyhaften des 19. Jahrhunderts gesehen; Luciles schon fast wahnsinniges „Es lebe der König“ kostet sie das Leben, läßt ihre Aussage zumindest bei Paul Celan aber als Kunst erscheinen. Die Oper „Wozzeck“ von Alban Berg, 1917 in zeitgemäßer Zwölftonmusik uraufgeführt, setzt durch andere Anordnung der Textfragmente eher sozialkritische Akzente.
Alle Werke Büchners thematisieren aber zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte. Das an sich ist wohl nichts Besonderes, ich möchte meine Beobachtungen aber darauf lenken, wie bei Büchner die Sprache und Inhalt, also die Form miteinander verwoben sind. Gerade durch bewußte Distanz zwischen den Rednern und ihren Aussagen - oder der offensichtlichen Sinnlosigkeit, dem rezitieren von Phrasen - läßt sich ein analytisches Statement seitens des Autors zum gesamten Konflikt herauslesen.
2. Lenz
Auch in der Interpretation von Büchners Lenz sind viele unterschiedliche Ansätze verfolgt worden, die auch alle bis zu einem gewissen Grade zutreffend sind. Es wurde zum Beispiel der Versuch unternommen, Lenz als eine Schizophreniestudie zu lesen; ein Vorgehen, für das man sicherlich hinreichend Belege im Text und in der Sekundärliteratur findet1. Auch legt Büchners Berufsausbildung, das Studium der Medizin, eine solche pathologische Lesensweise nahe.
Ich glaube aber nicht, daß es im Lenz um eine nachträgliche Rechtfertigung oder Erklärung von Lenzens Verhalten geht: die Kenntnis der Quellen bei Oberlin und Goethe ist gesichert, man geht aber nicht davon aus, daß Büchner wie im Falle Woyzeck, ein „Gegengutachten“ auf literarischer Ebene verfassen wollte; zu verschieden sind die beiden Texte. Büchner benutzte die tagebuchartigen Aufzeichnungen des Pfarrers Johann Friedrich Oberlin, (die unter dem Titel Der Dichter Lenz im Steintal 1839 in der Straßburger Zeitschrift Erwinia von August Stöber veröffentlicht wurden) sowie Goethes Darstellung in Dichtung und Wahrheit als Quellen für seine Erzählung.
Während Goethe sich auf eine Charakterisierung und einige Anekdoten positiver und negativer Art beschränkt, findet man in Oberlins Aufzeichnungen recht detaillierte Beobachtungen über einen Zeitraum von knapp drei Wochen, nämlich von 20. Januar bis zum 8. Februar 1778. In seiner Sprache nüchtern und sachlich, bringt Oberlin seine eigenen Lebensumstände mit in den Text, aber diese nur, um sein Verhalten Lenz gegenüber zu erklären. Eine Ursache für sein Verhalten wird aber nicht gesucht und auch nicht erwähnt; man nimmt Lenzens Auftauchen im Steintale als eine Prüfung an, der man sich aus religiösen Gründen wie christlicher Nächstenliebe einfach zu stellen hat.
Die Erfolglosigkeit in der Heilung von Lenzens Wahnsinn und die Einlieferung in ein Sanatorium in Straßburg sieht Oberlin als Niederlage, für die er sich rechtfertigen muß, kann aber leider keine endgültige Begründung abliefern:
„So oft wir reden wird von uns geurteilt, will geschweigen, wenn wir handeln. Hier schon fällt man verschiedene Urteile von uns; Die Einen sagten: wir hätten ihn gar nicht aufnehmen sollen, - die Anderen: wir hätten ihn nicht so lange behalten, - und die Dritten: wir hätten ihn noch nicht fortschicken sollen.
So wird es, denke ich, zu Straßburg auch sein. Jeder urteilt nach seinem besonderen Temperament (und anders kann er nicht) und nach der Vorstellung, die er sich von der ganzen Sache macht, die aber unmöglich getreu und richtig sein kann, [...].“ (Stoeber, MA 534).
Allein schon der Vergleich von Vorlage und Erzählung im Paralleldruck bestätigt eine andere Akzentuierung seitens Büchner als die eines Kommentars. Büchner kleidet das Gerüst der Handlung weiträumig aus, indem er etwa den Zeitraum von Lenzens Wanderung durch das Gebirge ausschmückt, oder er entwirft eine ganze Szene neu, wie etwas die des Kunstgespräches. Beide Textteile haben konstitutive Funktion in der Bedeutungsfindung der Erzählung.
„Den 20. ging Lenz durchs Gebirg.“(MA, 137) - Der Text wird mit einem Bild der Reise eröffnet. Allgemein wird die Reise in der romantischen Tradition als Reise zum Ich, also als Identitätsfindung gesehen. Aber anders als bei Werther, über dessen parallele Züge wir im Seminar schon gesprochen haben, kommt Lenz nicht an einem Ziel an. „Wie froh bin ich, daß ich weg bin!“ - Werthers Eröffnung gibt ihm zumindest einen zeitweiligen Fluchtpunkt. Schon der Ortsname Wahlheim steht für einen positives Verhältnis zum Ort der Handlung.
2.1. Lenz und die Wirklichkeit
Lenz dagegen findet im Gegensatz zu Werther keine Ruhe; schon seine Sichtweise der Dinge deutet auf einen tiefen Riß zwischen ihm und der Realität hin. Sogar der Selbstmord als Fluchtweg bleibt ihm verschlossen. Die Naturschilderung, die in Oberlins Bericht gar nicht erwähnt wird, stellt ein Bild des inneren Zustandes Lenzens dar, das alles natürlich aus Büchners Sichtweise, denn diese Textpassagen sind Büchners Entwurf.
„Müdigkeit spürte er keine, nur war ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehen konnte.“ „Es war ihm alles so klein, so nahe, so naß, er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen, er begriff nicht, daß er so viel Zeit brauchte, um von einem Abhang hinunter zu klimmen, einen fernen Punkt zu erreichen; er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können.“ (a.a.o.)
Die Infragestellung von Sachverhalten von existenzieller Klarheit deutet schon am Anfang auf eine gestörte Wirklichkeitsauffassung hin, jedenfalls nach heutigen Maßstäben. Diese Äußerungen einem konkreten Krankheitsbild wie etwa Schizophrenie aber zuzuordnen ist meines Erachtens der falsche Weg, ich halte es für einen Protest gegen die Zwänge der Realität, an denen Lenz letzenendes endgültig scheitert. Celan interpretiert den Satz auch in eine Richtung von Trennung zwischen Subjekt und den Objekten: „Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich.“ Ähnliches liest man in Leonce und Lena: „Leonce: Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren.
Valerio: Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirchturm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Man kann keine vier Pfund Kirschen essen, ohne Leibweh zu kriegen.“ (MA 163)
Im folgenden werde ich mich auf die Figur des Lenz konzentrieren, denn durch die exponierte Stellung des Kunstgesprächs und dessen Klarheit sehe ich im Lenz ein Statement zu Büchners ästhetischen Anschauungen. Die Erzählung ist zwar auf den ersten Blick aus der Perspektive eines auktorialen allwissenden Erzählers geschrieben, im Detail findet man aber Anzeichen für eine Vermischung der Perspektive des Erzählers und der Perspektive von Lenz. Die Zeichensetzung bei wörtlicher Rede ist nicht mehr eindeutig: bei Lenz fehlen die Anführungszeichen, nur bei der Rede anderer Personen werden sie benutzt. Büchner als der Autor dieses Textes spricht zumindest an einigen Stellen indirekt durch Lenz, und zwar immer da, wo es um Meinungsäußerungen geht, die auch nicht bei Oberlin oder Goethe belegt sind. Lenz als literarische Figur mutiert hier zum Sprachrohr Büchners.
Lenz wird uns als eine Person vorgestellt, die auf der Reise ist. Er durchwandert die Natur, die sich ihm auf der einen Seite als begehrenswert, auf der anderen aber als bedrohlich und kalt präsentiert. Im Kontrast zu seiner einsamen Wanderung trifft er im Dörfchen Waldbach auf Menschen; die Ankunftsszene drückt sowohl Zuflucht vor der Kälte als auch Aufnahme in menschliche Wärme aus. Die Blicke in die Fenster der Häuser, das Licht, das aus den Häusern strahlt und die Gruppierung der Personen um den Tisch im Pfarrhaus wecken Assoziationen an eine Abendmahldarstellung. Im Verlauf wird deutlich, daß es Lenz vor allem daran gelegen ist, sich von seiner Vergangenheit zu distanzieren. Soweit wie ihm das möglich ist, versucht er es zuerst auf der räumlichen Ebene durch Flucht, möchte aber auch nicht mit seiner Vergangenheit irgendwie in Verbindung gebracht werden. „>Der Name, wenn’s beliebt<... Lenz >Ha, ha, ha, ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht einige Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden?< Ja, aber belieben Sie mich nicht danach zu beurteilen.“ (MA, 138). Lenz erzählt, er wird aufgenommen und erhält ein Zimmer im Schulhaus. Doch mit der Dunkelheit und der Einsamkeit kommen Wahnvorstellungen, nur der Tag und die Gesellschaft Oberlins bewahren ihn vor Schlimmerem. Je mehr er sich in die Dorfgemeinschaft einlebt, desto ruhiger wird er. Als Oberlin ihm anbietet, eine Sonntagspredigt zu übernehmen, nutzt er diese als Gelegenheit zur Selbstdarstellung und zur exhibitionistischen Selbstbemitleidung. Seine anfänglichen Anfälle in der Nacht lassen aber mit der Zeit nach, so wie er in die dörfliche Gemeinschaft integriert wird.
2.2. Das Kunstgespräch im Lenz
Einen neuen Impuls erhält die Geschichte durch die Ankunft Kaufmanns. Genau wie die Frage Oberlins nach seiner dichterischen Vergangenheit ist Lenz die Konfrontation mit einem Bekannten nicht recht; nicht wegen der Person an sich, aber wegen der Verbindung mit seiner Herkunft.
„Lenzen war Anfangs das Zusammentreffen unangenehm, er hatte sich so ein Plätzchen zurechtgemacht, das bißchen Ruhe war ihm so kostbar und jetzt kam ihm jemand entgegen, mit dem er sprechen, reden mußte.“ (MA 144).
Und doch redet er mit Kaufmann über die Kunst.
Hier darf man annehmen, daß hinter Lenzens Ausführungen sich Büchner verbirgt. Hans Mayer attestiert Büchner seine Maximen über die Kunst, die „Aktion und Funktion des Künstlers“ nur in Briefen oder in einem Werk zu formulieren, so daß sie sich direkt in die Handlung einfügen und vom Leser gefiltert werden müssen; „niemals tiefer motiviert durch dramaturgische oder epische Überlegung“ (vgl. H. Mayer, 161). Doch was für eine Kunstauffassung kommt nun bei Büchner zutage?
2.3. Kunst als Notwendigkeit
Kunst hat im Lenz etwas willkürliches, sie ist ein Arrangement der Realität. Mittels der Kunst möchte der Künstler die Realität als solche begreifen und vor ihrem drohenden Verlust beschützen. Auch kann man zur Unterstützung die Theaterszene in Dantons Tod anführen; durch das scheinbar zusammenhanglose und absurde Anführen existenzieller Bedrohung und der Aufforderung, ins Theater zu gehen ergibt sich als notwendiger Zusammenhang die Lösung des Problems.
1. Herr: Ich versichere Sie, eine außerordentliche Entdeckung! Alle technischen Künste bekommen dadurch eine andere Physiognomie. Die Menschheit eilt mit Riesenschritten ihrer hohen Bestimmung entgegen.
2. Herr: Haben Sie das neue Stück gesehen? Ein babylonischer Turm! Ein Gewirr von Gewölben, Treppchen, Gängen und das alles so leicht und kühn in die Luft gesprengt. Man schwindelt bei jedem Tritt.
Ein bizarrer Kopf. (er bleibt verlegen stehen.)
1. Herr: Was haben Sie denn?
2. Herr: Ach nichts! Ihre Hand, Herr! Die Pfütze so! Ich danke
Ihnen. Kaum kam ich vorbei, das konnte gefährlich werden!
1. Herr: Sie fürchteten doch nicht?
2. Herr: Ja, die Erde ist eine dünne Kruste, ich meine immer, ich könnte durchfallen, wo so ein Loch ist. Man muß mit Vorsicht auftreten, man könnte durchbrechen.
Aber gehn Sie in´s Theater, ich rat´ es Ihnen. (MA 95)
Die Sprache besteht aus Zeichen, durch Zeichen und damit durch Sprache erhält die Welt ihre Gestalt in unserer Vorstellung. Die opake Masse an Eindrücken wird von uns geordnet und nach zeichentauglichen Begriffen und Bildern durchsucht; so strukturiert sich das Denken aus der Notwendigkeit heraus, die Welt zu ordnen, egal, nach welchen Kriterien. Die Welt präsentiert sich so als ein dünnes Geflecht von Repräsentationen Zeichen und Beziehungen, das sich gleichsam einer Decke über die Dinge legt und sie für uns greifbar macht. Die beiden Herren in der Theatherszene bewegen sich auch auf der (metaphorischen) Oberfläche über einem Erdinneren, das mit den Dingen an sich ausgefüllt ist. Das „neue Stück“, von dem die Rede ist, hebt sich weit ab über diese Welt, es erzeugt einen babylonischen Turm von neuen Bedeutungen und neuen Beziehungen; „Ein Gewirr von Gewölben, Treppchen, Gängen und das alles so leicht und kühn in die Luft gesprengt.“ (a.a.O.) Ganz im Gegensatz dazu die Erdoberfläche. Der kleinste Fehler in ihrer Gestalt, und sei es auch nur eine Pfütze, erinnert Büchner an die Unvollkommenheit unserer Sprache und an die Unmöglichkeit wahrer Kommunikation. Der Ausweg, oder zumindest ein Aufschub ist das Theater, weil es etwas Abstand gewinnt von der so löchrigen Oberfläche, auf der sich der normale Mensch bewegt.
Im Lenz erhält diese Ansicht einen theoretischen Überbau. Lenz und Kaufmann reden von der Kunst. Schon der erste Satz nennt das zentrale Problem in der Kunstdiskussion und auch in Lenzens Leben: das Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit. „Über Tisch war Lenz wieder guter Stimmung, man sprach von Literatur, er war auf seinem Gebiete; die idealistische Periode fing damals an, Kaufmann war ein Anhänger davon, Lenz widersprach heftig.“ (MA 144)
3. Romantische Ursprünge
Die Frage nach der Beziehung zwischen Kunst und Realität kann man ausweiten auf die Frage, in welcher Form der Mensch überhaupt Realität als solche auffassen kann. Lenzens Aussage über die Unmöglichkeit der Kunst, die Wirklichkeit im Ideal wiederzugeben formuliert feste romantische Ansichten. Beispielsweise in der englischen Romantik, die wie die deutsche durch neuplatonische Einstellungen geprägt war, kann man Shelley´s Aufsatz „ A Defence of Poetry “2 zitieren, in dem das Flüchtige, Vergängliche des dichterischen Augenblicks formuliert wird. Es muß eine beidseitige Disposition zum Schaffen vorhanden sein; treffen sich zwei solche Faktoren, ist man an einem „moment of inspiration“ angelangt. Der Dichter ist das Instrument, die „Äolusharfe“, auf der der göttliche Wind spielt. In der Natur und für den Dichter in ihrer Nachahmung erkennt der Mensch das Göttliche, welches man auch mit Lenzens Schönheitsbegriff beschreiben kann.
Genauso ist auch Lenzens Position im Kunstgespräch; die Gruppierung der Mädchen, die Lenz auf seiner vortäglichen Wanderung gesehen, sein Wunsch, diesen Augenblick festzuhalten und das Scheitern seinen Bestrebens. Nur die Erstarrung im Tod vermag Augenblicke zu konservieren. (MA 145)
Die Faszination von Kunst liegt für Lenz in ihrem Wirklichkeitsgehalt, das bloße Nachahmen von Idealen bleibt nur an der Oberfläche: „Der Dichter und Bildende ist mir der Liebste, der mir die Natur am Wirklichsten gibt, so daß ich über seinem Gebilde fühle, Alles Übrige stört mich.“ (MA 145) Diese Einstellung entspringt zum Teil zumindest einer sehr realitätsnahen Beobachtung, nämlich die der Begrenztheit menschlicher Kunstfertigkeit. Die Dichter, die die Welt bloß wiedergeben wollen seien immer noch leichter zu ertragen als die Dichter, die sie verklären wollen, sagt Lenz mit der lapidaren Feststellung, die Leute könnten auch keinen Hundsstall zeichnen; aus idealistischen Gestalten werden leider nur Holzpuppen. In der Kunst muß Leben stecken, man muß etwas schaffen, das macht ihr Wesen aus. „Alles Übrige kann man ins Feuer werfen.“ (MA144)
3.1. Die Definition von Kunst - Büchners Antwort
Bei Lenz äußert sich diese Definitionslücke nun in einer gestörten Wirklichkeitsauffassung. Dem Künstler, der sein Schaffen nicht begründen kann, fehlt eine Existenzgrundlage. Das Kunstgespräch mit Kaufmann markiert einen Wendepunkt in der Erzählung; die Erinnerung an seinen Vater und die geistige Anstrengung setzen Lenz so zu, daß er im weiteren Verlauf der Geschichte endgültig wahnsinnig wird. Der Wunsch seines Vaters nach Rückkehr sowie der Zwang sich dem Vater unterzuordnen, provozieren bei Lenz eine überaus heftige Reaktion. Der Vater, damit verbunden eine bürgerliche Existenz, erschüttert seine gerade erst wiedergefundene Ruhe aufs neue.
Gleich im Anschluß an die Abreise Oberlins kleidet sich Lenz als Büßer im Aschengewand und versucht im Nachbardorf ein gestorbenes Kind wiederzuerwecken. Er hält sich für Jesus, den Sohn Gottes und damit den Schöpfer an sich; für einen Künstler, denn das war der wirkliche Lenz ja wohl, eine ziemliche Anmaßung, die von Realitätsverlust zeugt. Die Tatsache, daß er in Friederike Brion verliebt war, ist nicht essentiell für diese Handlung, wohl aber bestätigt sie den immer noch andauernden Konflikt mit der Vergangenheit. Er versucht, die Bibel nachzustellen, sein eigenes Kunstwerk zu schaffen und versagt kläglich. Diese Einsicht kann er nicht mehr ertragen, er versucht sich umzubringen, es gelingt ihm aber aufgrund der Überwachung nicht mehr. Er wird nach Straßburg gebracht, man kümmert sich um ihn und seine Selbstmordgedanken lassen nach. So lebt er nun hin. Er (über)lebt, das Künstlerische aber in ihm ist abgestorben.
4. Inszenierung eines historischen Sachverhaltes als Transfer in die Kunst
4.1. Dantons Tod
Eine ähnliche Funktion hat auch Lucile in Dantons Tod. Sie hat im Drama keine bedeutende Rolle, bis zu ihrem letzten Auftritt. Sie, für die die Debatten der Revolutionäre bislang keine Bedeutung gehabt haben, die Camille nur wegen des Klanges seiner Stimme zuhört, greift hier in das Drama ein und macht sich selbst zum Teil der Handlung. Mit ihrem Sprechakt, und nichts anderes ist ihr Ausruf „Es lebe der König“, huldigt sie keinem „ancien régime“ (vgl. Celan, 189), ihre absurde Provokation der Patrouille aus dem sicheren Dunkel heraus läßt sie teilhaben an der Tragödie, in der sie sich nun mit verewigt. Der Dramentitel „Dantons Tod“ läßt einer anderen Deutung keinen Raum mehr. Bei Lucile ist die Sprache mehr noch als mit ihrem Inhalt mit der Person verbunden, die spricht. Lucile ist eine der wenigen Personen, die mit ihrer Sprache etwas direkt bewirken.
4.2. Determiniertheit in Dantons Tod
Aufgrund dieser Vorherbestimmtheit ist es Danton auch unmöglich, sich aus seiner Lage zu befreien, seine Unlust, eine Rede zu halten entspringt der Einsicht in den Lauf der Dinge. Er dürfte sich gar nicht verteidigen, oder das Stück müßte seinen Sinn verlieren. Die Figuren spielen eine Rolle, die sie zu erfüllen haben, mit Inkaufnahme des eigenen Untergangs. Vor diesem Hintergrund erfüllen die phrasenhaften Reden und Gespräche im Stück eine ganz andere Funktion: nicht nur demonstrieren sie die Festgefahrenheit der politischen Lage, indem sie eine wirkliche Diskussion unterbinden, die Sprache ist hier auch der bestimmende Faktor, der den Personen ihre Bedeutung gibt. Der Ausruf eines Jakobiners -„Ihre Zunge guillotiniert sie!“ (MA 77) - gewinnt hier eine konstitutive Bedeutung für das Stück. Die Unmöglichkeit wirklicher Kommunikation wirkt als Ausdruck der Determiniertheit der Handlung. Auch Danton, nach Celan nur von seinem Tod her zu verstehen, erhält seine Bedeutung auf der Guillotine. Sein Sinn erfüllt sich hier, der Name des Stückes formuliert es.
4.3. Der Dialog
Dantons Tod eröffnet sich schon mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit, andere Menschen wirklich zu kennen und mit ihnen zu kommunizieren. Danton formuliert es als die Einsamkeit des Individuums in der Gesellschaft, denn ohne gedankliche Kommunikation kann man keinen anderen Menschen kennen. Jemanden kennen heißt also, eine wahre und tiefgündige Kommunikation geführt zu haben; dazu müßte man sich aber gegenseitig „die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren“ (MA 69). Die wirkliche Kommunikation, diejenige, die ihren Empfänger auch erreicht, findet also erst im Tod statt, oder über den Tod. Schon der Titel formuliert das so, und wenn Danton und seine Genossen auf das Schafott schreiten, befinden sie sich auf einer Bühne und geben die Vorstellung ihres Lebens. Diese mag mehr oder weniger gelungen sein; das Publikum (ein makaberer Begriff bei diesem Schauspiel) ergötzt sich an den letzten Worten der zu Richtenden und führt eine Bewertung durch, die nach theaterkritischen Faktoren wie Originalität und Angemessenheit urteilt. So kann ein gutes letztes Wort seinem Urheber auch Gnade widerfahren lassen, wie im Fall des vermeintlichen Aristokraten, den sein letzter Satz davor bewahrt, an einer Laterne aufgeknüpft zu werden. An genauso oberflächlichen Zeichen orientierte sich aber auch die Masse, als sie ihn an der Laterne aufknüpfen wollte; ein Taschentuch wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden. (Dantons Tod, I, 2).
Hier hat wiederum eine sprachliche Äußerung eine direkte Konsequenz, dient aber nur dazu, das theatralische in der Revolutionsmaschinerie herauszuarbeiten. Ein Paradebeispiel für eine Person, die durch ihren Wortschatz dominiert wird, ist Simon, der Souffleur. Er ist total realitätsfern, und der Pathos seiner Zitate rutscht in diesen Situationen ins Komische ab. Er trinkt, aber der Hauptgrund für das Komische seiner Rolle ist seine Sprache. In dem Maße, wie er aus seiner Arbeit zusammenhanglose Fetzen aus Theaterstücken rezitiert, schwindet der Kontakt zur Realität. In seiner ersten Szene (Dantons Tod, I, 2) bedenkt er seine Frau mit sämtlichen Ausdrücken sittlichen Verfalls und beschuldigt sie, die Tochter in die Prostitution zu treiben, in Wahrheit aber ernährt sie damit ihre Eltern. Simons pathetischer Ton und das Unverhältnismäßige in der Wortwahl macht ihn lächerlich. Er hat keine Macht mehr über seine Sprache, die Worte in ihm haben sich schon verselbstständigt.
Auch die politischen Reden entlarven sich wiederum leicht als Farce, als Herunterleiern leerer Worthülsen. Der Diskurs unterwirft einerseits die sprechenden Subjekte, und zwar in dieser politisch brisanten Zeit mehr, als daß die sprechenden Subjekte sich den Diskurs zu eigen machen um zu kommunizieren. Auffällig ist in dieser Hinsicht auch, daß bei Dantons Tod keine inhaltlichen Argumentationen und Diskussionen vorkommen. Jeder Redner, am deutlichsten wird dieses bei den Auftritten Robespierres und in Maßen bei St. Just, präsentiert zwar Argumente, stellt sie aber nicht zur Diskussion, wie auf der Bühne. Die politischen Gruppierungen erscheinen als selbstdefinierte Organe, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gegner wird nicht geführt. Natürlich kann man beim Leser damals wie heute dementsprechendes Hintergrundwissen voraussetzen, aber die Natur des politischen Gesprächs in Dantons Tod bleibt an Namen und Gruppen verhaftet.
Die Revolutionsmaschinerie bleibt als abstrakter Faktor von der Diskussion ausgenommen. In geschlossener Gesellschaft wird zwar über den weiteren Verlauf geredet: „Herault: Die Revolution ist in das Stadium der Reorganisation gelangt. Die Revolution muß aufhören und die Republik muß anfangen.“ (MA 71). In öffentlichen Reden wagt es aber niemand, einschneidende Änderungen an der gängigen politischen Praxis zu fordern, dort ist es Konsens, daß je nach herrschendem politischen Klima die einen oder die anderen Gruppen guillotiniert werden; auch Robespierre schließt sich selber von diesem Schicksal nicht aus. St. Just vergleicht das Wüten der Revolution mit Naturkatastrophen, die im Zeitraffertempo ablaufen (MA 103 f.). Diese Grundeinstellung schließt von Anfang an gewisse Themen aus den Debatten aus und ist vielleicht der Hauptgrund für die nur oberflächliche Auseinandersetzung mit politischen Themen. Das maschinenhafte der Revolution bestätigt sich in Worten wie „Guillotinenthermometer“ (MA 80).
4.4. Sexualität
Eine gut funktionierende Kommunikation dagegen läßt sich über sämtliche Aspekte der Sexualität führen. Gleich am Anfang steht das nachdenkliche Zweifeln Dantons und Julies dem neckischen und frivolen Geflirte Heraults mit einer nicht näher beschriebenen Dame kontrastiv gegenüber. Eine Andeutung mit den Fingern reicht, um Heraults Absichten klar zu artikulieren, sein Wortspiel mit den Kartenfiguren läßt keine Fragen offen. Die Syphilis und ihre Medizin, Quecksilber, sind das verbindende Element in den Gesprächen zwischen Danton, seinen Freunden und den immer wieder auftauchenden Prostituierten. Danton und Marion führen ein ernstes Gespräch, Marion schildert ihren Weg in die Prostitution mit allen dazugehörenden Umständen sehr klar und verständlich.
Der Tod durch die Syphilis ist kontrastiv zu dem Heldentum der Revolutionszeit angelegt.
„Lacroix: [...] ein moderner Adonis wird nicht von einem Eber, sondern von Säuen zerrissen, er bekommt seine Wunde nicht am Schenkel sondern in den Leisten und aus seinem Blut sprießen nicht Rosen hervor sondern schießen Quecksilberblüten an.“ (MA 83)
Der sichere Tod durch die Syphilis relativiert das Todesurteil durch die Guillotine, nimmt ihm aber gleichzeitig auch das Heldenhafte. Ein kurzer Augenblick von Schmerz auf dem Schafott ist monate- oder jahrelangem Leiden deutlich vorzuziehen. Auf dem Schafott erhält man sogar noch einmal die Möglichkeit, ein Star zu werden, im Mittelpunkt zu stehen und sich mittels eines wohl gewählten letzten Wortes vielleicht noch verewigen zu lassen. Das Leben in der Zeit der französischen Revolution ist nurmehr ein schlechtes Schauspiel geworden.
5. Fazit
Kunst, Kunstauffassungen und Sprache lassen sich bei Büchner nicht mehr voneinander trennen. Durch verschiedene Sprachmodi erreicht Büchner über die direkte Aussage des Textes hinaus eine Wirkung, die bedeutungskonstitutive Funktion im Text übernimmt. Personen, die durch die ihnen eigene Wortwahl eine Rolle aufgezwängt bekommen, stehen Frauen wie Lucile gegenüber. Ihnen bleibt der Einblick in das revolutionäre Geschehen mit ihren Eintritt in das Nationalkonvent zwar verwehrt, dadurch bleiben sie aber von der phrasenhaften Verwendung der Rede verschont und im privaten Diskurs sowie durch den selbstmörderischen Ausruf wird ihre Stimme doch gehört.
6. Literaturangaben
BÜCHNER, Georg, Werke und Briefe - Münchener Ausgabe, Karl Pörnbacher, Gerhard Schaub, Hans-Joachim Simm und Edda Ziegler (Hgs.), München 1988 (zitiert MA).
CELAN, Paul, Der Meridian, in: Gesammelte Werke, Dritter Band, Frankfurt (M.) 1983, S. 187 - 202.
MAYER, Hans , Lenz, Büchner und Celan, Anmerkungen zu Paul Celans Georg- Büchner-Preisrede „Der Meridian“ vom 22. Oktober 1960, in: ders., Vereinzelt Niederschläge: Kritik - Polemik, Pfullingen 1973, S. 160 - 171.
REDDICK, John, Lenz and the Problem of Perception in: Oxford German Studies, 24, 1995, OUP, S. 112 - 144.
SHELLEY, Percy Bysshe, A Defense of Poetry, in: Romanticism - an Anthology, Duncan Wu (Hg.), Blackwell 1998, S. 944-956.
[...]
1 Vgl. Irle, Gerhard: Büchners ,,Lenz" - eine frühe Schizophreniestudie, in: ders., Der psychatrische Roman, Stuttgart, 1965, 75-83.
Häufig gestellte Fragen zu Büchners Werk
Was sind die Hauptwerke von Georg Büchner, die in diesem Text erwähnt werden?
Die Hauptwerke, die in diesem Text erwähnt werden, sind: Der Hessische Landbote, Dantons Tod, Leonce und Lena, Lenz, und Woyzeck.
Was ist das zentrale Thema der Werke Büchners, laut dieser Analyse?
Laut dieser Analyse thematisieren alle Werke Büchners zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte, wobei ein besonderer Fokus auf der Verflechtung von Sprache und Inhalt liegt.
Worauf konzentriert sich die Analyse im Bezug auf "Lenz"?
Die Analyse konzentriert sich im Bezug auf "Lenz" auf das Verhältnis zwischen Kunst und Wirklichkeit und sieht in der Figur des Lenz ein Sprachrohr Büchners für dessen ästhetische Anschauungen.
Welche Quellen benutzte Büchner für seine Erzählung "Lenz"?
Büchner benutzte die tagebuchartigen Aufzeichnungen des Pfarrers Johann Friedrich Oberlin (Der Dichter Lenz im Steintal) und Goethes Darstellung in Dichtung und Wahrheit als Quellen für seine Erzählung.
Wie wird die Rolle des Kunstgesprächs im "Lenz" interpretiert?
Das Kunstgespräch im "Lenz" wird als ein Statement zu Büchners ästhetischen Anschauungen interpretiert, wobei Lenzens Ausführungen als Ausdruck von Büchners eigenen Ansichten über Kunst gesehen werden.
Welche Bedeutung hat das Theater in "Dantons Tod"?
Das Theater in "Dantons Tod" wird als ein Ort des Aufschubs von der "löchrigen Oberfläche" des Lebens gesehen. Die Theaterszene dient auch dazu, die Inszenierung des Todes und die theatralische Natur der Revolution hervorzuheben.
Wie wird die Sprache in "Dantons Tod" dargestellt?
Die Sprache wird in "Dantons Tod" als ein bestimmender Faktor dargestellt, der den Personen ihre Bedeutung gibt. Die Unmöglichkeit wirklicher Kommunikation wirkt als Ausdruck der Determiniertheit der Handlung.
Welche Rolle spielt Lucile in "Dantons Tod"?
Lucile greift durch ihren Ausruf "Es lebe der König" in das Drama ein und macht sich selbst zum Teil der Handlung. Ihre Aussage wird als eine absurde Provokation interpretiert, die sie an der Tragödie teilhaben lässt.
Welche Bedeutung hat die Sexualität in "Dantons Tod"?
Die Sexualität, insbesondere die Syphilis, wird in "Dantons Tod" als ein Kontrast zum Heldentum der Revolutionszeit dargestellt. Der sichere Tod durch die Syphilis relativiert das Todesurteil durch die Guillotine und nimmt ihm gleichzeitig das Heldenhafte.
Was ist das Fazit der Analyse?
Das Fazit der Analyse ist, dass Kunst, Kunstauffassungen und Sprache bei Büchner nicht mehr voneinander zu trennen sind. Durch verschiedene Sprachmodi erreicht Büchner über die direkte Aussage des Textes hinaus eine Wirkung, die bedeutungskonstitutive Funktion im Text übernimmt.
- Quote paper
- Philipp von Melle (Author), 2000, Kunst und Kunstgespräche - Ästhetische Aussagen in Büchners Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100268