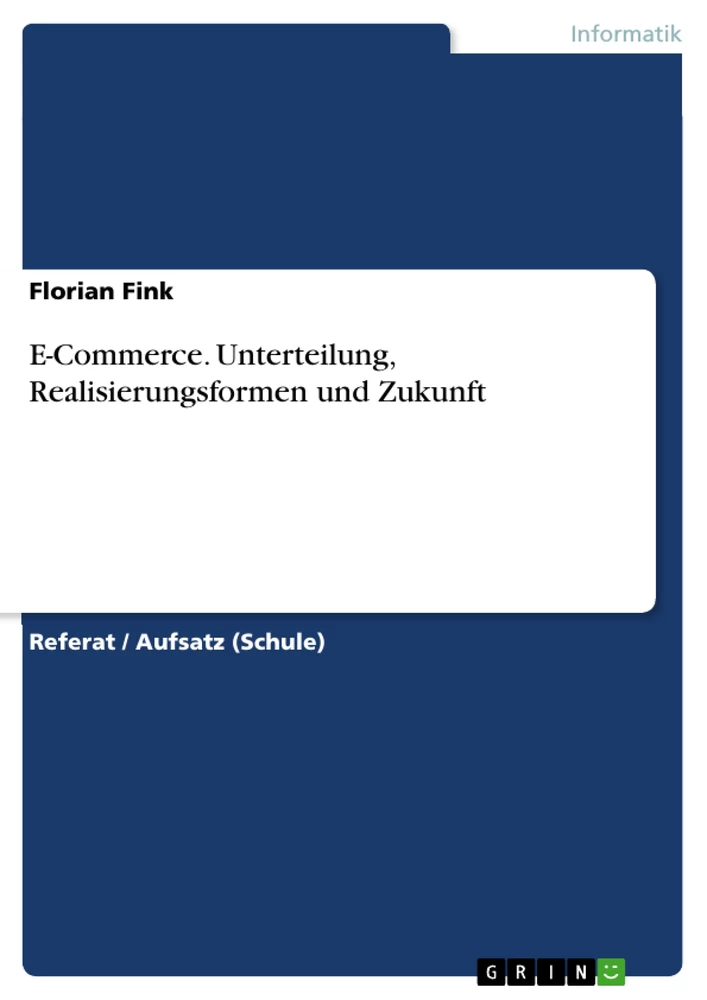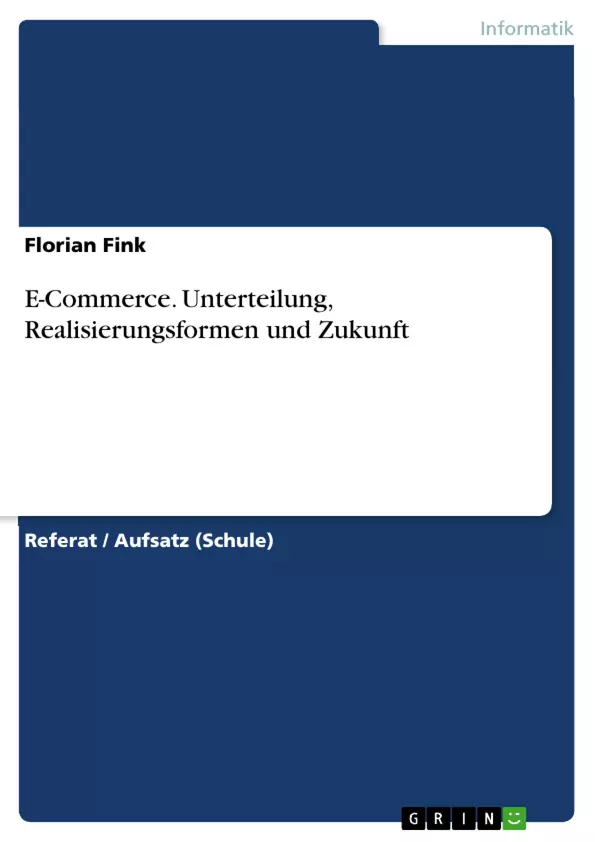E-Commerce
1. Definition:
„Elektronische Marktplätze sind virtuelle Plätze, auf denen eine (beliebige) Zahl Käufer und Verkäufer Waren und Dienstleistungen (offen) handeln und Informationen tauschen.“ Fraunhofer ALB Das englische Wort E-Commerce (electronic commerce / elektronischer Handel) steht für eine online-/ internet-gerechte Steuerung wirtschaftlicher Abläufe. Es bedeutet das Kaufen und Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen über Datennetze. Die elektronischen Geschäftsbeziehungen zwischen Firmen und ihren Lieferanten werden als E-Business bezeichnet.
2. Allgemeine Einführung:
Mit Electronic-Commerce, oder kurz E-Commerce, werden Geschäfte bezeichnet, die über das Internet abgewickelt werden. Grundidee ist, daß Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen über das Internet kommunizieren können. Beide tauschen Informationen über die Ware und den Kaufwunsch aus. Der Verkäufer gibt Informationen über seine Ware und den Preis an. Der Käufer informiert über seinen Kaufwunsch und seine Identität. Er füllt hierzu z.B. ein Bestellformular aus, welches an den Verkäufer über das Internet übermittelt wird. Der Verkäufer verschickt dann die Ware an den Käufer und dieser bezahlt dafür den vereinbarten Preis. Die Bezahlung selbst kann auch durch eine Information über das Internet erfolgen.
Vorteil für den Verkäufer ist, daß er geringere Kosten hat, als bei einem Angebot über ein Ladengeschäft oder andere Vertriebssysteme. Der Käufer hat den Vorteil, daß er bequem von zu Hause aus die Waren des Verkäufers zu jeder Tages- und Nachtzeit begutachten und bestellen kann. Er kann in Ruhe Preise verschiedener Anbieter oder verschiedene Angebote vergleichen, ohne hierfür irgendwelche Geschäfte zu besuchen. Es spielt für ihn auch keine Rolle, ob der Verkäufer in München, Hamburg oder Los Angeles beheimatet ist.
Jedoch gibt es auch Nachteile für beide Seiten. So muß der Kunde zur Zeit noch für den Aufenthalt im Internet in Abhängigkeit von der Zeit bezahlen, was einem Eintrittsgeld in einem herkömmlichem Geschäft gleich kommt. Der Verkäufer hat den Nachteil erst bekannt werden zu müssen, was er meist erst durch teuer angelegte Werbekampagnen oder durch Aufkaufen eines bereits etablierten Domains erreichen kann. So starten die meisten kleinen virtuellen Geschäfte als Versandhandel neben dem bereits realen Geschäft.
3. Allgemeine Unterteilung:
3.1 Sell-Sites
Historisch gewachsen ist der E-Commerce im Internet über sogenannte Sell-Sites, die heute vor allem den sogenannten B2C1 -Bereich dominieren. Merkmal ist der Handel eines Unternehmens mit diversen Abnehmern. Ziel ist die Senkung der Vertriebskosten durch Verbinden zahlreicher Transaktionen über einen Verkäufer und die Vermeidung personalintensiven Kundenkontakts. Zudem kann durch den Vertrieb über das Internet der
Zwischenhandel teilweise ausgeschaltet werden und die Kostenersparnis damit dem Kunden weitergegeben werden. Für den Kunden steht neben der Kostenreduzierung der eingekauften Güter eine größere Transparenz in Hinsicht auf Lieferfristen, Verfügbarkeit und Preis der verschiedenen Produkte als Vorteil im Vordergrund.
3.2 Buy-Sites
Im Gegensatz zu Sell-Sites versuchen Buy-Sites die Kosten eines oder mehrerer Unternehmen durch Bündelung von Beschaffungen und Reduktion von Prozesskosten zu verringern. Sie ermöglichen die Ausschreibung von benötigten Produkten für eine größere Anbierterplattform und reduzieren durch den dadurch entstehenden Wettbewerb die Kosten des gesuchten Produkts erheblich. Zu einem großen Teil wird dies durch die Automobilindustrie genutzt die über den Marktplatz im Internet unter anderem Produktionsteile, Werkzeuge und Büromaterial einfacher bestellen und damit die Geschäftsprozesse optimieren will. Eine große Fusion der Marktplätze von GM, Ford und DaimlerChrysler mit dem des VW Konzerns war letzten April fehlgeschlagen.
3.3 B2B Portale
Im Gegensatz zu2 - den beiden bisher betrachteten Ansätzen von Sell- und Buy-Sites haben Portale den Anspruch eine mehr oder weniger vollständige Aufstellung von Lieferanten und Handelsplattformen anzubieten. Man kann zwischen Portalen, die eigenstädig mehrere Warengruppen abdecken und Portalen, die eine Sammlung von Vertriebsplattformen anbieten.
4. Realisierungsformen:
Darunter versteht man Formen von virtuellen Marktplätzen, wie sie im Internet zu finden sind. Die folgenden Formen treten sowohl isoliert als auch in Mischformen auf. Sie treffen auf alle drei der oben genannten Arten von E-Commerce Seiten zu.
4.1 Schwarze Bretter
Sie stellen eine einfache Form der Anbahnung von Geschäften dar. Unterteilt nach Produkten und Produktgruppen können Käufer und Verkäufer Ausschreibungen und Angebote veröffentlichen. Sie sind vergleichbar mit den Ausschreibungen in Tageszeitungen. Die gehandelten Güter sind häufig nicht katalogisierbar. Eine klare Trennung von Käufer und Verkäufer entfällt da jeder in jede Rolle schlüpfen kann. Die eigentliche Abwicklung des Handels findet abgekoppelt von der Plattform statt. Die Betreiber solcher schwarzen Bretter erzielen ihre Einnahmen durch Schaltung von Werbungen und durch eine Veröffentlichungsgebühr der Anzeige. Häufig bieten „Kataloge“ schwarze Bretter als Nebenleistung an.
4.2 Kataloge
Eine weitverbreitete Form von elektronischen Marktplätzen sind katalogisierte Dienste. Die veröffentlichten Kataloge setzen sich aus dem Angebot mehrerer Anbieter zusammen. Der Käufer hat die Möglichkeit nach Kategorien zu suchen und ähnliche Produkte einer Kategorie zu vergleichen.. Die Preise werden durch die Verkäufer bestimmt. Vergleichbar mit katalogbasierten Diensten sind E-Sales-Lösungen einzelner Unternehmen. Katalogbasierte Dienste tragen zur Marktransparentz bei, da identische und ähnliche Produkte verglichen werden können. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Personalisierung verschiedener Kunden. So werden bei längeren Handelsbeziehungen oder größeren Bestellungen oft Sonderkonditionen ausgehandelt.
4.3 Börsen
Die Börse ist im Prinzip eine Erweiterung des schwarzen Brettes wobei der Hauptunterschied in der Anonymisierung des Handelsprozesses liegt. Weder Verkäufer oder Käufer sind während oder nach dem Handel der jeweils anderen Partei bekannt. Die hauptsächlich gehandelten Güter an den Börsen sind schwer oder nicht verkäufliche Restmengen oder Überkapazitäten, die früher oft nicht genutzt werden konnten oder aufgrund fehlender Anonymität gar nicht erst in den Handel gelangten.
4.4 Auktionen
Börsen und Auktionen ähneln sich zwar in vielen Punkten, doch liegt der Hauptunterschied in der Art der gehandelten Güter. Während über Börsen meist schwer beschreibbare nichtstandardisierte Güter gehandelt werden, vermitteln Auktionen gut beschreibbarer Güter und Dienstleistungen. Dem Teilnehmer an Auktionen bietet sich der Vorteil des Preisfindungsprozesses, dem Anbieter die Möglichkeit der Ermittlung eines Marktpreises für seine Produkte.
5. Gegenwärtiger Status
Momentan befindet sich keine Branche in größerem Wachstum als der Handel über das Internet. So prognostiziert das amerikanische Marktforschungsinstitut IDC (International Data Corporation) dem E- Commerce in Europa jährlich ein rasantes Wachstum von bis zu 100%. Als Gründe werden der Euro und das rasch wachsende Interesse der Benutzer genannt.österreich befindet sich in einer zwiespältigen Situation dieses Ressort betreffend. So meint Univ.- Prof. Hannes Werthner, Wirtschaftsinformatiker und E-Commerce- Experte an der WU Wien,österreich liege drei Jahre hinter der internationalen Entwicklung zurück. Die Unternehmen befänden sich noch in einem „Dornröschenschlaf“ und verpassen den Anschluß an das Ausland. Dies hat zur Folge daß dieösterreicher selbst schon fleißig am Einkaufen über das weltweite Datennetz (prozentuell mehr als unsere deutschen Nachbarn), jedoch ihre Einkäufe meist im Ausland tätigen wodurchösterreichische Firmen kaum profitieren. Gründe für das „Schlafen“ der Unternehmen werden hauptsächlich in der heimischen Unternehmenskultur, die Veränderungen scheut, geortet. Derzeit wird das Internet von heimischen Unternehmen hauptsächlich für E-Mails (87%) und die Präsentation des Unternehmens über eine Homepage (55%) genutzt. Nur etwa 17% bieten konkrete Bestellmöglichkeiten für ihre Kunden an. Obwohl neue Marketingkonzepte dringend nötig wären, ignorieren 60% der Unternehmen die Herausforderungen des Marktes.
6. Die Zukunft
E-Commerce gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Wirtschaft der Länder. So veröffentlichte die Weltbank vor kurzem ein Schreiben, in dem sie den EUOsterweiterungskanditaten empfiehlt ihren E-Commerce Sektor erheblich zu vergrößern und auch das Internet mehr zu verbreiten.
Die Weltbank geht davon aus, dass der E-Commerce produktivitätssteigernd wirkt und den zwischenstaatlichen Handel begünstigt; Länder, die sich daran nicht beteiligen, bleiben im Abseits.
Es gibt heute weltweit rund 170 Millionen Internet-Benutzer, und diese Zahl wird bis zum Jahr 2005 wahrscheinlich auf 1 Milliarde ansteigen (IDC Research). Zur Zeit befinden sich allein in Europa mehr als 42 Millionen Benutzer, und in Großbritannien zieht das Internet jährlich fast 11.000 neue Benutzer an.
Infolge dieser Steigerung der Internet-Nutzung verdoppeln sich die Internet-Einnahmen alle 3 bis 4 Monate.
Der Online-Einkauf ist der am schnellsten wachsende Bereich der Internet-Nutzung in diesem Jahr. Es wird geschätzt, daß 30% aller Websites für den Handel genutzt werden, anstatt nur für Werbungszwecke. Laut Giga werden im Jahr 2002 auch 20% aller Handelseinnahmen über das Internet erfolgen, und Forrester prognostiziert, daß allein die US-Einnahmen in dem Jahr $300 Milliarden übersteigen werden. Für 2004 sagt das Institut einen europäischen E- Commerce-Umsatz von 1,6 Billionen Euro oder 6,3 % des Gesamthandelsvolumens voraus. Damit, so Forrester, hole allerdings nur Nordeuropa den Rückstand zu den USA auf, während die südlichen EU-Länder den Anschluß verlören. Diese Statistiken sind durchaus glaubwürdig, wenn man bedenkt, daß 30% aller gegenwärtigen Internet-Benutzer bereits Waren online einkaufen. Es ist ganz selbstverständlich, daß bei einer so großen Kundenbasis wie dem Internet, bei dem gegenwärtigen wachsenden Interesse an diesem neuen Einkaufsmedium und den reduzierten Kosten in Verbindung mit dem Online-Handel das Internet eindeutig der richtige Ansatz für neue Unternehmen ist oder solche, die ihre Aktivitäten erweitern möchten. Es besteht kein Zweifel. Die Zukunft gehört dem E-Commerce. Doch ob er sich noch zu einer Horrorvision ,durch die Preistransparentz und den dadurch härteren Wettbewerb, entwickelt, wie einige Experten befürchten, oder ob sich alles ganz anders entwickelt wird die Zukunft zeigen.
[...]
1 Business to Consumer
Häufig gestellte Fragen
Was ist E-Commerce laut Fraunhofer ALB?
Laut Fraunhofer ALB sind elektronische Marktplätze virtuelle Plätze, auf denen eine beliebige Anzahl Käufer und Verkäufer Waren und Dienstleistungen offen handeln und Informationen austauschen. E-Commerce steht für die online-/internet-gerechte Steuerung wirtschaftlicher Abläufe und beinhaltet das Kaufen und Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen über Datennetze.
Was ist der Hauptvorteil von E-Commerce für Verkäufer?
Der Hauptvorteil für Verkäufer sind die geringeren Kosten im Vergleich zu einem Angebot über ein Ladengeschäft oder andere Vertriebssysteme.
Was ist der Hauptvorteil von E-Commerce für Käufer?
Der Hauptvorteil für Käufer ist die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus die Waren des Verkäufers zu jeder Tages- und Nachtzeit zu begutachten und zu bestellen. Sie können in Ruhe Preise verschiedener Anbieter vergleichen.
Welche Nachteile hat E-Commerce für Kunden?
Ein Nachteil für den Kunden ist, dass er für den Aufenthalt im Internet bezahlen muss, was einem Eintrittsgeld in einem herkömmlichen Geschäft gleichkommt.
Welche Nachteile hat E-Commerce für Verkäufer?
Ein Nachteil für Verkäufer ist, dass sie erst bekannt werden müssen, was meist durch teure Werbekampagnen oder den Kauf einer etablierten Domain geschieht.
Was sind Sell-Sites im E-Commerce?
Sell-Sites sind im Wesentlichen Online-Shops, die den Handel eines Unternehmens mit diversen Abnehmern ermöglichen (B2C). Ziel ist die Senkung der Vertriebskosten und die Vermeidung personalintensiven Kundenkontakts.
Was sind Buy-Sites im E-Commerce?
Buy-Sites versuchen die Kosten eines oder mehrerer Unternehmen durch Bündelung von Beschaffungen und Reduktion von Prozesskosten zu verringern. Sie ermöglichen die Ausschreibung von benötigten Produkten für eine größere Anbierterplattform.
Was sind B2B-Portale im E-Commerce?
B2B-Portale bieten eine mehr oder weniger vollständige Aufstellung von Lieferanten und Handelsplattformen.
Was sind Schwarze Bretter im Kontext von E-Commerce?
Schwarze Bretter stellen eine einfache Form der Anbahnung von Geschäften dar, in denen Käufer und Verkäufer Ausschreibungen und Angebote veröffentlichen können.
Was sind Kataloge im Kontext von E-Commerce?
Kataloge sind katalogisierte Dienste, die sich aus dem Angebot mehrerer Anbieter zusammensetzen. Der Käufer kann nach Kategorien suchen und ähnliche Produkte vergleichen.
Was sind Börsen im Kontext von E-Commerce?
Die Börse ist eine Erweiterung des schwarzen Brettes, wobei der Hauptunterschied in der Anonymisierung des Handelsprozesses liegt.
Was sind Auktionen im Kontext von E-Commerce?
Auktionen vermitteln gut beschreibbare Güter und Dienstleistungen. Dem Teilnehmer an Auktionen bietet sich der Vorteil des Preisfindungsprozesses.
Wie ist der gegenwärtige Status von E-Commerce?
Der Handel über das Internet wächst rasant. Studien prognostizieren ein jährliches Wachstum von bis zu 100% in Europa. Österreich hinkt der internationalen Entwicklung jedoch hinterher.
Was sagt die Weltbank über E-Commerce?
Die Weltbank empfiehlt den EU-Osterweiterungskandidaten, ihren E-Commerce Sektor erheblich zu vergrößern und auch das Internet mehr zu verbreiten, da es produktivitätssteigernd wirkt und den zwischenstaatlichen Handel begünstigt.
Wie sieht die Zukunft von E-Commerce aus?
E-Commerce gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Zahl der Internet-Benutzer und die Online-Einkäufe steigen rapide an. Die Zukunft gehört dem E-Commerce, wobei die Auswirkungen des Wettbewerbs noch ungewiss sind.
- Quote paper
- Florian Fink (Author), 2001, E-Commerce. Unterteilung, Realisierungsformen und Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100301