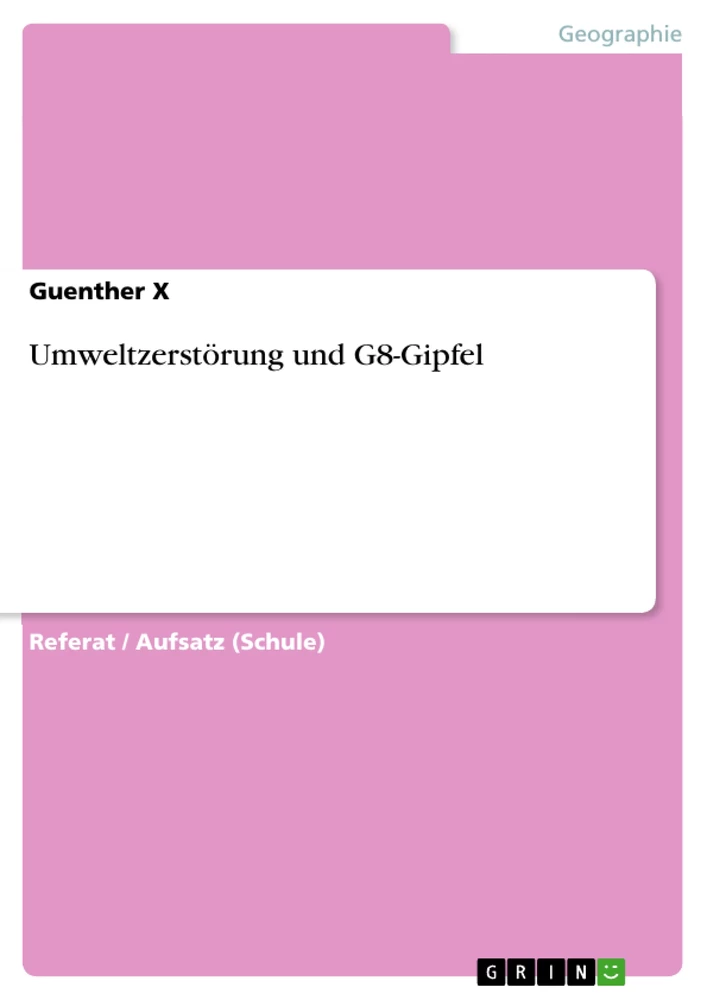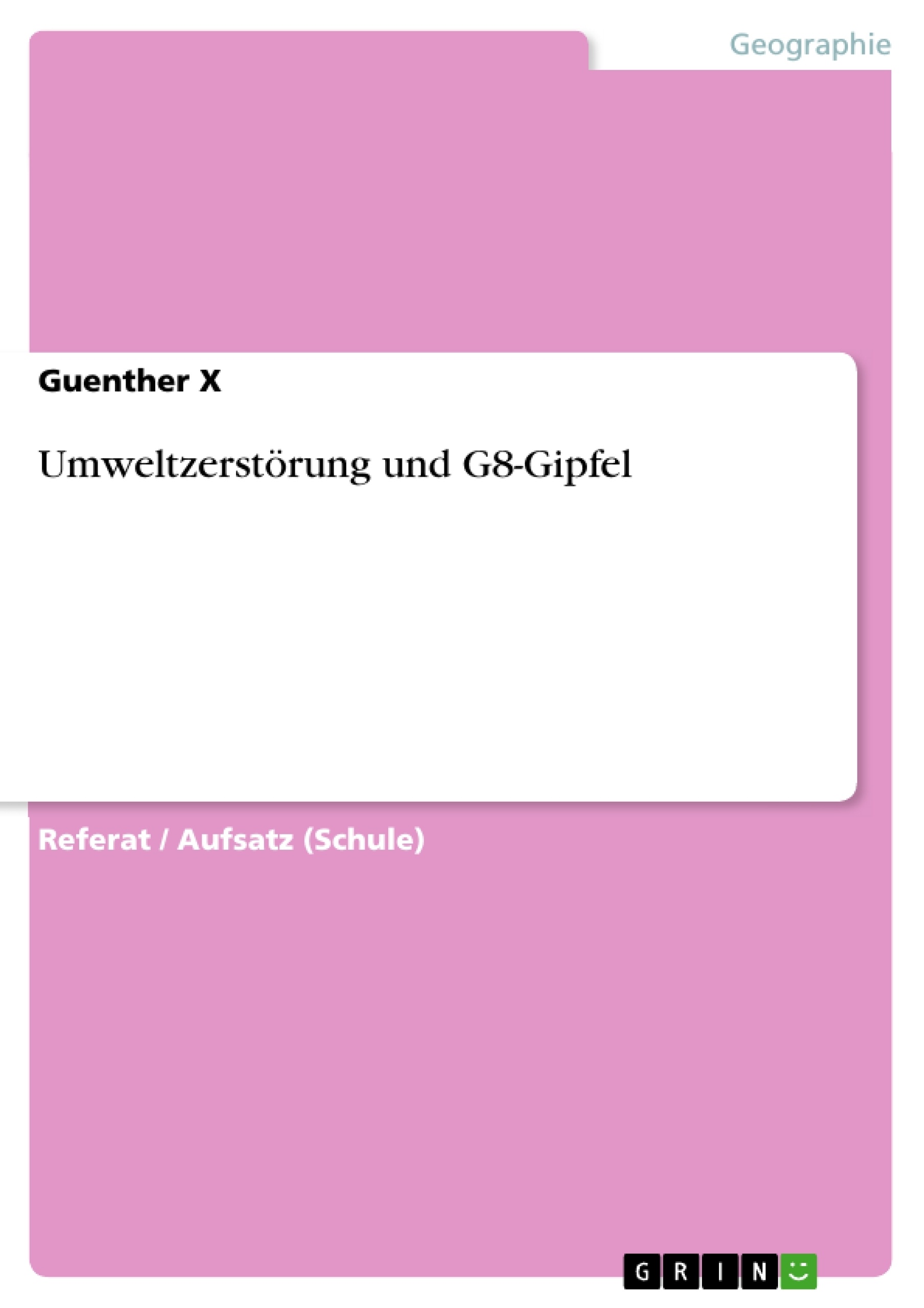Schutz der Erde vor Umweltzerstörung -unser Beitrag
Treibhauseffekt, die Problemdarstellung:
Als größtes globales klimatisches und damit auchökologisches Problem ist die Eindämmung des Treibhauseffektes anzusehen. Eine Studie („Targets and Indicators Of Climate Change“), die schon 1990 im Vorfeld der IPCC (Intergonernmental Panel of Climate Change) erstellt wurde, besagt, dass die globale Erwärmung (von der vorindustriellen Zeit bis zum Jahr 2100) unter zwei Grad Celsius lie - gen muss. Dies wird als Mindestmaß betrachtet, um das Abschmelzen der Polkappen und damit unter anderem die Überflutung von tiefer gelegenen Landmassen, das Fortschreiten der Desertifizierung, Hurrikanes (in den letzten 20 Jahren hat die Winddynamik um 40% zugenommen), unkontrollierbare Rückkopplungseffekte (z.B. die temperaturabhängige Einbindung von CO2 in die Ozeane) und die Ausweitung des Ozonloches (es hat sich vom 1.1.-31.3.2000 um 60% vergrößert) einzudämmen.
Als Ursachen des anthropogenen Treibhauseffektes sind CO2 (50%), FCKW und Methan (jeweils 19%), Ozon (8%) und Distickstoffoxid (4%) zu nennen.
Das durch Verfeuern fossiler Brennstoffe auftretende CO2 entsteht vor allem durch Kraftwerke (35%), aber auch durch Kleinverbraucher (24%), Verkehr (17%), Industrie (14%) und Raffinerien (10%). Wenn der Mensch nicht auf die drohenden Katastrophen reagiert und seinen Lebensstil nicht ändert, dann ist mit einer globalen Erwärmung von 0,4° Celsius pro Dekade zu rechnen unter anderem bedingt durch die durch das Bevölkerungswachstum rasant steigende Energienachfrage, eine größere Anzahl von Fahrzeugen (heute: 680 Millonen, 2030: 1620 Millionen, 2100: 4930 Millionen) und eine auch deshalb steigende Zuwachsrate des CO2 (Die CO2-Emission des Transportsektors wird 2100 um 490% höher sein als heute).
Was bisher geschah
Auf internationaler Ebene:
1989 wurde das IPCC, ein internationales unabhängiges wissenschaftliches Gremium zum Klimawandel gegründet, das das Problem Treibhauseffekt klar definierte.
1992 wurde auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro von der UN ein Rahmenübereinkommen zur Reduktion des Treibhauseffektes auf ein, gefährliche anthropogene Störungen des Klimasystems verhinderndes, Niveau verabschiedet.
1995 tagte in Berlin erstmals und von da an jährlich das COP-X (COP-1), das oberste Gremium der Klimakonvention.
1997 fand in Kyoto der COP-3-Gipfel statt. Die Industrieländer verpflichteten sich rechtsverbindlich, ihre Treibhausgasemission zwischen 2008 und 2012 um mindestens 5% gegenüber 1990 zu senken. Dafür sind (vor allem durch die USA gefordert und durchgesetzt) ergänzend zu nationalen Maßnahmen „Flexible Mechanismen“ vorgesehen:
-Emissionshandel: Ein Staat kann die ihm zugebilligten aber nicht genutzten Rechte auf Emissionen an andere Staaten verkaufen.
-CDM (Clean Development Mechanism): Industrieländer fördern in Entwicklungsländern Projekte zur Reduktion von Treibhausgasen und lassen sich diese anrechen.
1998 fand in Buenos Aires die COP-4 statt. Man verhandelte über die noch strittigen Punkte des Kyoto-Abkommens (Anrechenbarkeit, Kontrolle und Sanktionen). Diese Dinge werden auf der COP-6 Ende dieses Jahres in Den Haag abschließend verhandelt.
Auf nationaler Ebene:
Auch auf nationaler Ebene haben alle Länder die Möglichkeit Maßnahmen über die internationalen Abkommen hinaus durchzusetzen. Beispielsweise hat das marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumentökosteuer in Deutschland die Bemühungen der Industrie zur Produktion sparsamerer Autos spürbar beschleunigt. Wenn in naher Zukunft diese Nachfrage aufgrund steigender Benzinpreise auch in anderen Ländern steigt, ist die deutsche Industrie im Bezug auf sparsame Autos mit führend.
Was müssen wir tun? Die Frage nach der Energiegewinnung der Zukunft Meiner Meinung nach ist eine Reduzierung der CO2-Emission ohne einen schrittweisen Totalausstieg aus der fossilen Energie gewinnung nicht realisierbar. Die regenerativen Energien (vor allem die Kraft- Wärme Kopplung) müssen weltweit den größten Anteil an der Gesamtenergieproduktion gewinnen. Momentan liegt er bei 14%, der Anteil der fossilen Energiegewinnung bei 81%, der der Atomindustrie weltweit bei 5%.
Atomkraftwerke sind aufgrund ihrer nie auszuschließenden Gefahren (siehe jüngste Zwischenfälle in Sellafield oder Japan) keine Alternative. Ihre Entwicklung war zu teuer und die Folgekosten sind immer noch nicht abzusehen: Bis heute gibt es keine sichere Form der Endlagerung. Die irische See ist aufgrund der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield radioaktiv verseucht. Allein zur Eindämmung der Tschernobyl-Katastrophe, bei der 100000m2 Land verseucht wurde und über 600000 Katastrophenhelfer im Einsatz waren, wendete Russland zum damaligen Kurs umgerechnet 100 Milliarden Euro auf.
Der Umstieg auf regenerative Energien ist nach der vom „Boston Centre des Stockholm Environment Institute“ ausgearbeiteten Studie FFES („Fossil free energy scenario“) auch mit dem heutigen Stand der Technik schon wirtschaftlich und technisch machbar.
Ich fordere eine Umleitung der Subventionen und Steuerbefreiungen, die für fossile Energien aufgewendet werden. Insbesondere die Industrienationen, die mit ihrem jährlichen Ausstoß von 22 Milliarden Tonnen CO2 weltweit 75% in die Luft blasen, müssen hier eingreifen. Alleine die USA, die 24,1% der weltweiten CO2-Emission verursachen, fördern Fossilbrennstoffe jährlich mit 44 Milliarden Dollar. Deutschland förderte durch den Kohlepfennig und bis 1998 alleine den Steinkohleabbau mit sieben Milliarden Mark jährlich. Die bis 2005 geplante Absenkung auf 3,8 Millarden Mark ist nicht radikal genug.
Dass die regenerativen Energien immer konkurrenzfähiger werden, kann man am aktuellen Beispiel einer Firma sehen, die offshore Windräder mit der Leistung von drei Atomkraftwerken baut. Eine Windkraftanlage produziert Strom zum Preis von 14Pf/KWs, Kohlekraftwerke (ohne Subventionen) für 13-16Pf/KWs! Aus Analysen verschiedener Forschungsinstitute ergibt sich, dass in zwanzig bis dreißig Jahren auch Solarstrom mit fossiler Energiegewinnung konkurrieren kann. Man muss aber sofort handeln, da wir die CO2-Emission zur Verhinderung der angesprochenen Folgen schon bis 2030 entscheidend eingedämmt haben müssen.
Zu einer Massenarbeitslosigkeit wird es nicht kommen (Beispiel: Dänemark), da im Bereich der regenerativen Energien auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Gleichzeitig bringt eine Konzentration auf regenerative Energien auch eine nicht zu vernachlässigende Unabhängigkeit mit sich. Schon heute sind die Industrienationen stark von denölpreisen abhängig. Dies führte in der Vergangenheit zu zahlreichen Konflikten (z.B. erste und zweiteölkrise). Deshalb forderte Bill Clinton diesen März sparsamere Autos: Der Benzinpreis war inerhalb weniger Wochen in den USA um über 30% gestiegen.
Nach einer Esso-Studie werden allerdings 2020 schon etwa 5% der Gesamtflotte mit Erdgas, Flüssiggas, Biodiesel, Wasserstoff oder Methanol betrieben. Zu den wichtigsten Antriebsarten sollen dann auch Hybrid- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge zählen. Diese Entwicklung gilt es auf nationaler sowie internationaler Ebene zu fördern. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Änderung des Verbrauchsverhaltens der Bürger um die Bilanz der Kleinverbraucher zu verbessern.
Ich erwarte von der COP-6 ein Signal zur Einschränkung des Emissionshandels und der CDM- Maßnahmen. Momentan sind sie zwar unverzichtbar, da Industrieländer nicht von heute auf morgen auf regenerative Energien unsteigen können, langfristig können sie das Problem des Treibhauseffektes aber nicht lösen. In der vorausschauenden Entwicklung, hervorgerufen durch nationale Maßnahmen, sollte jedes Land versuchen sich dauerhaft in neuen Technologien zu etablieren und der Umwelt dadurch indirekt zu helfen.
Aber mit dem Umdenken der Industrie ist noch lang nicht alles getan. Auch wir müssen Abstand von unserem verschwenderischen, kurzfristig gewinnstrebenden Lebensstil nehmen um nachhaltiges Wirtschaften zu befördern. Da sich diese Lebenseinstellung seit der Industrialisierung aber nicht mehr grundlegend geändert hat, ist dieser Prozess als extrem schwierig und langwierig anzusehen. Ein erster Schritt wäre den Umweltschutz ins Grundgesetz zu schreiben.
Quellen.
- Information zur politischen Bildung: Globalisierung. Franzis‘ print & media, München (2. Quartal 1999)
- Internet: http://laurin.munich.netsurf.de/Philipp.Schneider/facharb.htm
- Internet: http://www.br-online.de/news/aktuell/971113/172004.html#3
- Internet: http://www.greenpeace.de/GP_DOK_3P/STU_LANG/C04ST02.HTM
- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland: Erdsicht, Global Change. Verlag Gerd Hatje (1992)
- Robin Wood Magazin: Reizende Umwelt. Robin Wood-Magazin, Schwedt (1/2000)
- Kölner Stadt-Anzeiger: Diesel-Norm bei vier Litern. M. DuMont Schauberg -Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & CoKG (Donnerstag, 30. März 2000, Seite 42)
Häufig gestellte Fragen: Schutz der Erde vor Umweltzerstörung - unser Beitrag
Was ist das größte globale klimatische Problem, das angesprochen wird?
Die Eindämmung des Treibhauseffektes wird als das größte globale klimatische und ökologische Problem angesehen.
Welche Ursachen werden für den anthropogenen Treibhauseffekt genannt?
Als Ursachen werden CO2 (50%), FCKW und Methan (jeweils 19%), Ozon (8%) und Distickstoffoxid (4%) genannt.
Welche Bereiche sind hauptsächlich für die CO2-Emissionen verantwortlich?
Kraftwerke (35%), Kleinverbraucher (24%), Verkehr (17%), Industrie (14%) und Raffinerien (10%).
Welche internationalen Maßnahmen wurden zur Bekämpfung des Treibhauseffektes ergriffen?
Die Gründung des IPCC 1989, das UN-Rahmenübereinkommen von 1992 in Rio de Janeiro, die jährlichen COP-Konferenzen seit 1995 und das Kyoto-Protokoll von 1997, welches rechtsverbindliche Reduktionsziele für Industrieländer festlegte.
Was sind "Flexible Mechanismen" im Rahmen des Kyoto-Protokolls?
Emissionshandel (Verkauf von nicht genutzten Emissionsrechten) und CDM (Clean Development Mechanism), bei denen Industrieländer Projekte zur Reduktion von Treibhausgasen in Entwicklungsländern fördern und sich diese anrechnen lassen.
Welche nationalen Maßnahmen werden als Beispiel genannt?
Die Ökosteuer in Deutschland, die die Bemühungen der Industrie zur Produktion sparsamerer Autos beschleunigt hat.
Welche Energiegewinnung wird als die der Zukunft betrachtet?
Die regenerativen Energien (vor allem die Kraft-Wärme-Kopplung) müssen weltweit den größten Anteil an der Gesamtenergieproduktion gewinnen.
Warum werden Atomkraftwerke nicht als Alternative angesehen?
Aufgrund ihrer nie auszuschließenden Gefahren, der hohen Kosten und der fehlenden sicheren Endlagerung.
Was wird bezüglich der Subventionen gefordert?
Eine Umleitung der Subventionen und Steuerbefreiungen, die für fossile Energien aufgewendet werden, hin zu regenerativen Energien, insbesondere durch Industrienationen.
Welche Vorteile werden von regenerativen Energien erwartet?
Sie werden immer konkurrenzfähiger, schaffen neue Arbeitsplätze und bringen eine größere Unabhängigkeit von Ölpreisen mit sich.
Welche Maßnahmen werden im Bezug auf das Verbrauchsverhalten der Bürger vorgeschlagen?
Eine Änderung des Verbrauchsverhaltens um die Bilanz der Kleinverbraucher zu verbessern, sowie die Förderung von Hybrid- und Brennstoffzellen-Fahrzeugen.
Welche Kritik wird an dem Emissionshandel und den CDM-Maßnahmen geäußert?
Sie sind momentan unverzichtbar, langfristig können sie das Problem des Treibhauseffektes aber nicht lösen.
Welche Erwartung wird an die COP-6 gestellt?
Ein Signal zur Einschränkung des Emissionshandels und der CDM-Maßnahmen.
Was wird bezüglich des Lebensstils gefordert?
Abstand von einem verschwenderischen, kurzfristig gewinnstrebenden Lebensstil nehmen um nachhaltiges Wirtschaften zu befördern und den Umweltschutz ins Grundgesetz schreiben.
- Quote paper
- Guenther X (Author), 2000, Umweltzerstörung und G8-Gipfel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100307