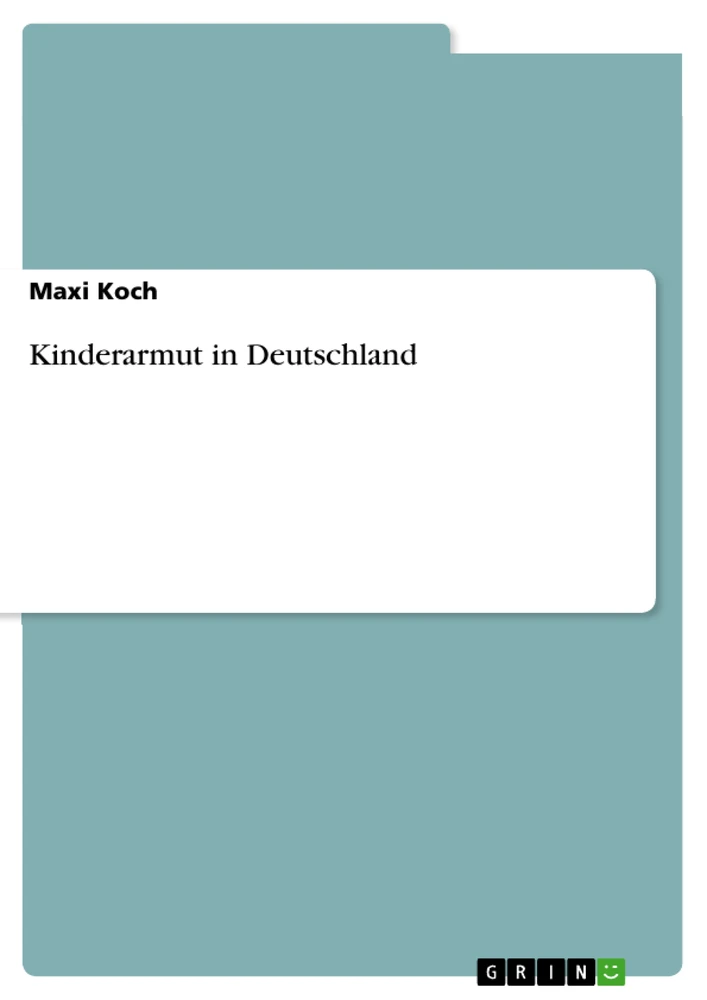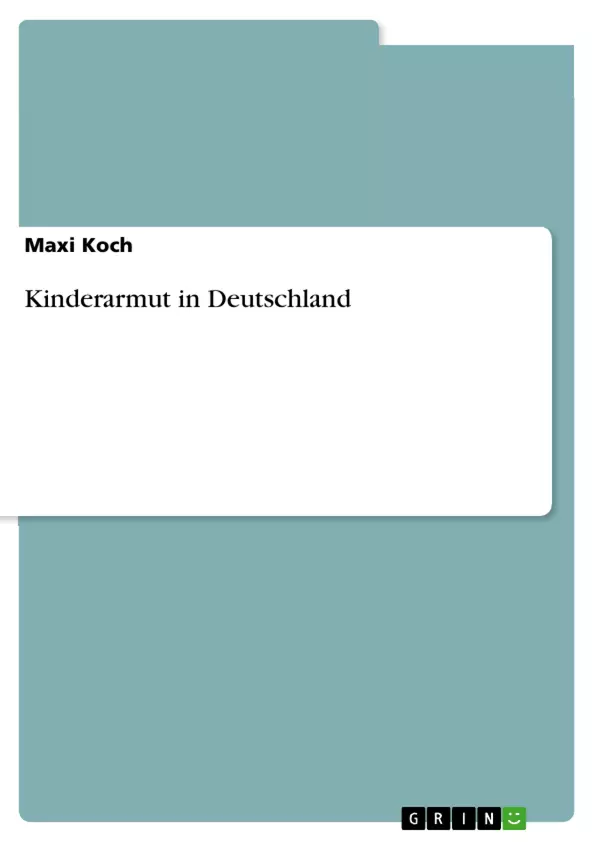In der vorliegenden Arbeit werden Probleme und mögliche Hilfen für in Armut lebende Menschen in Deutschland dargestellt.
Die ZDF-Reportage "Armes reiches Deutschland - kein Geld für Kinder" (2017, Michael Beck und Carina Gadomski) handelt von mehreren Familien, die unter relativer Armut leiden sowie Einrichtungen und Personen, die dieser Armut entgegen wirken wollen. Das Leben sowie der Umgang mit der finanziellen Situation von mehreren Familien und Helfer*innen wird vorgestellt.
Die ZDF-Reportage „Armes reiches Deutschland – Kein Geld für Kinder“ von Michael Beck und Carina Gadomski stammt aus dem Jahr 2017. Sie handelt von mehreren Familien, die unter relativer Armut leiden sowie Einrichtungen und Personen, die dieser Armut entgegen wirken wollen. Mehrere Familien und Helfer*innen werden vorgestellt.
Die erste Familie, die genauer betrachtet wird, ist Familie Lenzen. Die Mutter, Andrea Lenzen, ist alleinstehend und hat keinen Job. Sie und ihre fünf Kinder haben rund 1.172€ für Lebensmittel, Kleidung und Freizeit übrig. Für Tochter Mathilda (9 Jahre) ist es oft unangenehm, ihre finanziellen Mängel vor der Klasse ansprechen zu müssen. Ihre Mutter gesteht, dass sie sich täglich darüber den Kopf zerbricht, ob sie alles richtig macht und ob es die richtige Entscheidung war, so viele Kinder zu kriegen. Die Familie Lenzen ist noch nie in den Urlaub gefahren, worüber jedoch von Seiten der Kinder keine Beschwerden kommen.
Der Verein Froschkönige gegen Armut e.V. in Flingern unterstützt Kinder von einkommensschwachen Familien. Gabriele van den Burg (68) und Irene Elbers (75) sind beide Gründungsmitglieder des seit 2007 bestehenden Vereins. Sie freuen sich über die Danksagungen und stellen fest, wie ungewöhnlich es ist, dass ein Kind sich über Unterwäsche freut. Die beiden Vereinsmitglieder packen eine Kiste mit Kleidung für eine Familie mit sieben Kindern. Die Bestellung fällt sehr bescheiden aus, weshalb Gabriele van den Burg und Irene Elbers zusätzlich Bekleidung einpacken. Das Armutsrisiko steigt besonders bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. Jedes dritte Kind ist davon betroffen.
Die sieben-köpfige Familie Taube-Naumann aus Mühlheim hat rund 1.049€ für den Haushalt übrig. Am Ende des Monats muss die Familie mit sehr wenig Geld auskommen. Vater Alexander Taube-Naumann (39) will nicht am Essen für seine Familie sparen. Die Möbel sind vom Sperrmüll und die letzte Renovierung musste aufgrund von Geldmangel abgebrochen werden. Die Weihnachtswünsche überschreiten das Budget der Familie. Die Mutter Lyba Naumann (39) erzählt, dass sie den gleichen Betrag vom Sozialamt bekommt, wie eine Freundin die zwei Jobs gleichzeitig hat, für Mindestlohn arbeitet und ihre Kinder allerdings kaum sieht.
Niedrige Löhne sind eine Hauptursache für Kinderarmut. Fast jedes zweite Kind aus Familien mit wenig Einkommen bekommt nie oder selten Frühstück. Peter Kraut (54) ist Koch bei der Kindertafel „Immersatt“ in Duisburg. Er schmiert innerhalb einer Stunde, zusammen mit ehrenamtlichen Helfer*innen und Zwei-Euro-Jobber*innen rund 800 Frühstücksbrote für bedürftige Kinder. Es werden 26 kommunale Schulen mit Frühstücksbeuteln mit einem Wert von 50 Cent versorgt. Das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk „Die Arche“ in Düsseldorf versucht arme Kinder psychisch und physisch aufzufangen. Die Leiterin Maike Deckert (35) betreut täglich gemeinsam mit anderen Helfer*innen rund 70 bedürftige Kinder, welche teilweise jeden Tag kommen. Ein armes Kind aus Deutschland sieht anders aus, als ein armes Kind aus Afrika. Bei genauerem Betrachten fallen jedoch Mängel auf.
Die fünf-köpfige Familie Fuß hat rund 1.008€ Haushaltsgeld. Das Einkommen reicht nicht für Taschengeld und nur selten bleibt Geld am Ende des Monats übrig. Der größte Wunsch von Joanna (13) ist, dass ihre chronisch herz- und lungenkranke Mutter wieder gesund wird.
Bei Familie Sprenger arbeiten beide Elternteile, doch aufgrund der ungeplanten Drillinge ist das Geld knapp (1.344€ Haushaltsgeld). Die Familie hat Angst vor den zukünftigen Ausgaben für ihre Kinder.
Die bereits erwähnte Mathilda Lenzen lernt seit zwei Jahren Gitarre. Ihre Mutter bekommt ein Viertel der Ausgaben für den Unterricht vom Staat. Um weiter ihrem Hobby nachgehen zu können, braucht sie eine größere Gitarre, was eine finanzielle Herausforderung für ihre Mutter darstellt.
Die häufigen Ablehnungen von Wünschen seitens der Eltern oder der Besitz von ausschließlich gebrauchten Sachen nagt am Selbstbewusstsein der Kinder. Geldgeschenke von Verwandten sind nur bei bis zu 30 Euro anrechnungsfrei. Ausnahmen gibt es nur an Feiertagen.
Der lebensweltliche und soziale Kontext übt großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder aus. Im Stadtteil Süd-West in Mühlheim an der Ruhr gilt jedes zweite Kind als arm. Ein Spielplatz gegenüber der Wohnung von Familie Taube-Naumann ist nicht betretbar, da dort täglich Drogen verkauft und konsumiert werden.
Viele Eltern übergeben die Verantwortung ihrer Kinder an Einrichtungen wie „Die Arche“. Die Leiterin von „Immersatt“ Nicole Elshoff (44) beschreibt den Teufelskreis von armen Kindern, welche kaum essen, daraufhin Konzentrationsprobleme haben und deshalb in der Schule nicht mehr hinterher kommen. Nur jedes zehnte Kind schafft den Sprung von der Grundschule auf das Gymnasium. Armen Kindern fehlt es an sozialer Gerechtigkeit.
Die Kinder der in der Reportage gezeigten Familien werden nach ihren Wünschen gefragt. Sie reichen von einem gemeinsamen Urlaub mit den Eltern, über genügend Freunde, bis hin zu einem eigenem Bett. Kinderarmut in Deutschland wächst und trifft immer mehr Familien aus sozialen Schichten, die dachten, finanziell abgesichert zu sein.
Die Dokumentation war erschreckend und aufrüttelnd zugleich. Die am Anfang vorgestellten Kinder lösten direkt ein trauriges und erstauntes Gefühl in mir aus. Die einfachen Wünsche der Kinder und das unbegrenzte Verständnis für ihre Eltern ließ mich inne fahren. Als ich selbst im Alter der meisten Kinder war, stellte der Begriff Armut etwas dar, was ganz weit weg von meinem sozialen Umfeld und mir passierte.
Als Mathilda ihre Mutter um zehn Euro für die Klassenkasse bittet, wird mir erst klar, wie eng es tatsächlich am Ende des Monats bezüglich der Finanzen für die Familie ist. Mir tut es leid, dass sich die Mutter dafür schämt, nicht genug Geld zu haben. Ich hätte mir nicht vorstellen können vor der ganzen Klasse ansprechen zu müssen, dass meine Eltern nicht dazu fähig sind, für etwas zu zahlen.
Ich bin beeindruckt von der Mutter, wie sie ihre Zweifel vor ihren Kindern verbirgt und ihnen stattdessen ruhig klar macht, dass Geld nicht alles im Leben ist. Sie ist sich aber unsicher, ob es richtig war so viele Kinder zu bekommen.
Ich denke daran, welche Konsequenzen es für die Geschwister haben könnte, wenn sie davon wüssten. Die Mutter leidet an Existenzängsten, welche sich auf die Kinder übertragen könnten. In so einer Situation ist der Familienzusammenhalt besonders wichtig.
Ich teile die Auffassung von Irene Elbers, dass es eher selten ist, wenn Kinder sich über Unterwäsche freuen. Dinge, die für mich als Kind selbstverständlich waren, sind für diese Familien besonders. Es muss hart für die Kinder sein, wenn sie Gleichaltrige Eis essen, in den Zoo oder das Kino gehen sehen. Alexander Taube-Naumann´s Aussage, dass die Familie an manchen Tagen überlegen muss, ob sie Geld für den Einkauf oder das Tanken nutzen, bewegt mich. Sein Sohn Ivan weiß genau, wie viel sein Weihnachtsgeschenk kostet. Als er den Preis verrät, presst er die Lippen aufeinander, als würde er etwas zurückhalten wollen. Ihm ist sichtlich bewusst, dass sein Wunsch unwahrscheinlich in Erfüllung gehen wird.
Die Mutter Lyba Naumann fühlt sich schlecht für die Sozialhilfe, die sie bekommt. Eine Freundin von ihr hat zwei Jobs und arbeitet für Mindestlohn. Beide Frauen bekommen den gleichen Betrag. Lyba Naumann entscheidet sich bewusst gegen einen Job, da sie auch für ihre Kinder da sein möchte. Ihr innerer Konflikt lässt mich unseren Sozialstaat in Frage stellen.
Peter Kraut versorgt viele Schulen mit Frühstückspaketen an bedürftige Kinder. Ob die Schüler*innen die Hilfe brauchen oder nicht, wird von den Klassenlehrer*innen ermittelt. Ich hätte gerne gesehen, wie diese Ermittlung in der Schule abläuft. Ob die Lehrkräfte die Thematik vor der ganzen Klasse ansprechen oder jedes Kind einzeln befragt wird. Die Vorstellung erinnert mich an Mathilda, der es unangenehm ist vor der Klasse ihre Armut anzusprechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder beschämt darüber sind und daher keine Hilfe annehmen.
Die Leiterin der Arche, Maike Deckert erzählt, dass eine Firma, die Spenden verteilte, darüber verwundert war, dass die Kinder nicht arm aussahen. Natürlich ist es gut, dass man den Kindern die Armut nicht sofort ansehen kann. Doch viele Kinder können dadurch leiden, dass sie zwar ein Teil der Gesellschaft sind und trotzdem an vielen Dingen, nicht oder nur teilweise teilhaben können. Das betrifft Freizeitaktivitäten, Klassenfahrten oder den nicht möglichen Kauf der neuesten Markenklamotten. Genau wie einer der beiden Zwillinge, die oft von „Der Arche“ Kleidung bekommen, der nur Schuhe von Nike haben möchte. Es ist traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns nur akzeptiert und wohl fühlen, wenn wir Kleidung tragen, die einen bestimmten Stellenwert darstellt. Noch schlimmer ist es, dass dieses Bedürfnis auf Kinder übertragen wird. Teilweise denken manche Kinder, dass sie in ihrem sozialen Umfeld nur aufgrund von Markenklamotten akzeptiert werden und so besser verstecken können, dass ihre Eltern in finanziellen Nöten stecken.
Ich finde es erstaunlich, dass Joanna durch die Armut ihrer Eltern, schon viel erwachsener wirkt, als sie tatsächlich ist. Mit 13 Jahren wird sie schon mit der finanziellen Situation ihrer Familie belastet. Ich finde es traurig, dass Kinder wie Joanna in ihrer Kindheit schon auf viele Dinge verzichten müssen und dadurch früh erwachsen werden. Die Familie Sprenger bekam statt einem Kind Drillinge. Marion Sprenger verdiente gut als Apothekerin, doch fand in diesem Beruf keine Teilzeitstelle. Deshalb muss sie nun als Putzfrau arbeiten, was sie selbst eher als minderwertige Tätigkeit ansieht. Ich finde es schade, dass sie nicht als Apothekerin weiter arbeiten konnte.
Die Dokumentation hat mich für eine kurze Zeit am Leben armer Familien teilhaben lassen. Es fiel mir schwer, mitansehen zu müssen, in welcher finanziellen und sozialen Lage sich die Betroffenen befinden. Die Existenzängste der Eltern übertragen sich auf die Kinder, was das Selbstwertgefühl verringern und ihnen ein Stück ihrer unbeschwerten Kindheit nehmen kann. Marion Sprenger erzählt, dass sie keine Teilzeitstelle als Apothekerin findet und als Putzfrau arbeiten muss.
Ich als Sozialarbeiterin würde versuchen ihr eine lokale Stelle zu vermitteln. Mithilfe von Kontextualisierung und Ressourcenanalyse würde ich ermitteln, woran es bisher gelegen hat, dass sie keinen Job in ihrem Arbeitsbereich finden konnte und wo die Familie Hilfe aus ihrem Umfeld beziehen kann. Die Großeltern oder Nachbarn könnten bei der Kinderbetreuung helfen, sodass Marion Sprenger wieder Vollzeit arbeiten kann. Die meisten Hartz4-Empfänger*innen bekommen ihre Wohnung vom Amt zugeteilt. Die billigen Wohngegenden liegen oft in nicht kinderfreundlichen Gebieten. Mutter Lyba Naumann verbietet ihrem Jungen Ivan auf dem gegenüberliegenden Spielplatz zu spielen, da dort täglich Drogen konsumiert und verkauft werden. Mithilfe der Polizei könnte man versuchen, die Drogendealer vom Spielplatz der Kinder fernzuhalten. Zudem könnte man Ivan die Möglichkeit geben, einen anderen Spielort zu finden. Beispielsweise ein Hobby, da Hartz4-Empfänger*innen dafür finanzielle Hilfe vom Staat bekommen. Ivan scheint traurig darüber zu sein, nicht spielen zu können und eine Freizeitaktivität würde ihm Spaß bereiten und neues Selbstvertrauen geben.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „relative Armut“ für Kinder in Deutschland?
Relative Armut bedeutet nicht unbedingt Hunger wie in Entwicklungsländern, sondern den Mangel an finanziellen Mitteln für soziale Teilhabe, gesunde Ernährung und Bildung.
Welche Auswirkungen hat Armut auf die Bildungschancen?
Arme Kinder leiden oft unter Konzentrationsmangel durch fehlendes Frühstück. Statistisch schafft nur jedes zehnte arme Kind den Sprung aufs Gymnasium.
Welche Organisationen helfen gegen Kinderarmut?
In der Reportage werden Vereine wie „Froschkönige gegen Armut e.V.“, die Kindertafel „Immersatt“ und das Hilfswerk „Die Arche“ vorgestellt.
Warum sind niedrige Löhne eine Ursache für Kinderarmut?
Selbst wenn Eltern arbeiten, reicht das Einkommen (Aufstocker) oft kaum aus, um die Kosten für eine mehrköpfige Familie ohne staatliche Hilfe zu decken.
Wie beeinflusst Armut das Selbstbewusstsein von Kindern?
Das ständige Verzichtenmüssen und das Tragen gebrauchter Kleidung führen oft zu Schamgefühlen und sozialem Rückzug gegenüber Gleichaltrigen.
- Citation du texte
- Maxi Koch (Auteur), 2019, Kinderarmut in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003136