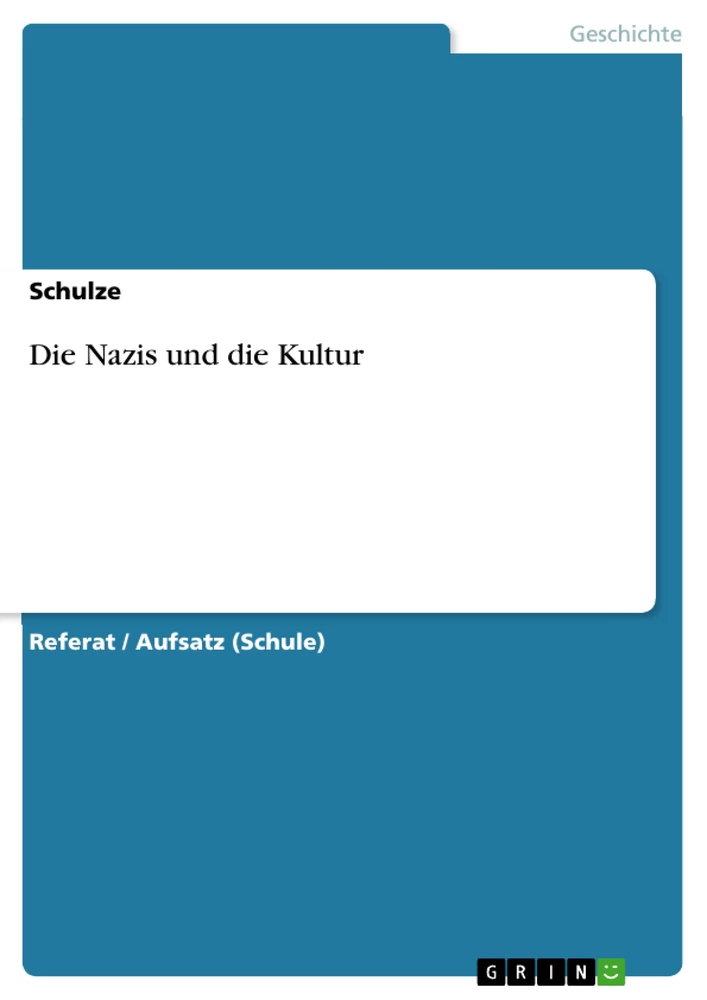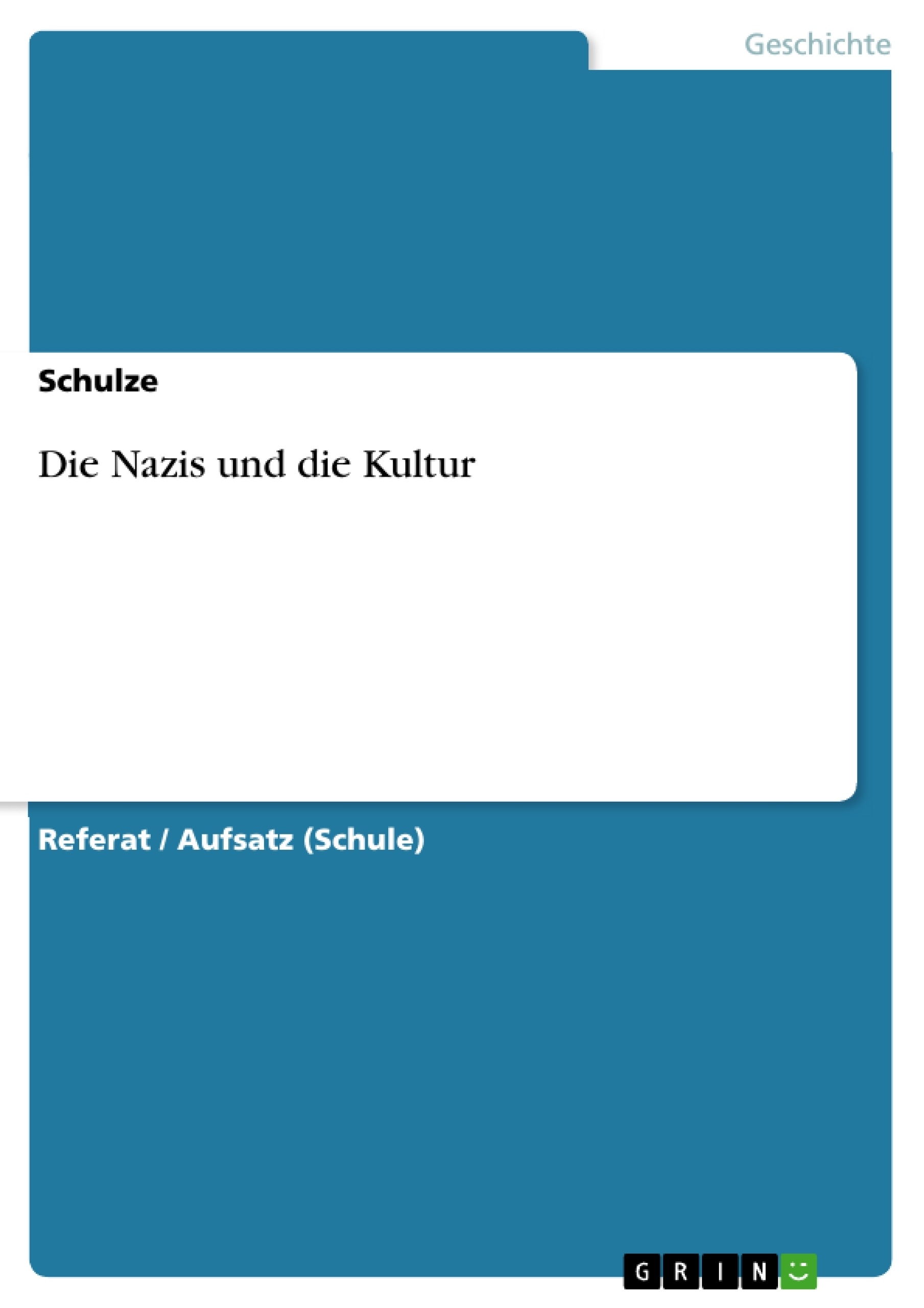Die Nazis und die Kultur
Im Gegensatz zu den "Goldenen Zwanziger Jahren", in denen das kulturelle Leben in Deutschland aufblühte, kam es nach der Machtergreifung Hitlers 1933 zu einer Verödung der deutschen Kultur. Die berühmtesten Repräsentanten der deutschen Literatur verließen sehr bald ihr eigenes Land. Was veranlasste sie zu diesem Schritt?
Im Mai 1933 war es in verschiedenen deutschen Universitätsstädten auf Befehl der Nationalsozialisten zu öffentlichen Bücherverbrennungen gekommen. Vertreter der Studentenschaften verbrannten Bücher von unliebsamen Schriftstellern. Darunter waren so bekannte Autoren wie Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Heinrich Mann und Thomas Mann, Stefan Zweig, Kurt Tucholsky Was 1933 mit der Bücherverbrennung begann, ging 1937 mit der öffentlichen Diffamierung von Malern und Musikern weiter.
Kampf gegen die Moderne
Die Nazis und die Kultur - Von der Bücherverbrennung bis zum Durchhaltefilm
Umringt von seinen Ministern schlendert Adolf Hitler gutgelaunt durch den gerade fertiggestellten nationalsozialistisch-neogriechischen Kulturtempel "Haus der Kunst", in dem unter dem Motto "Entartete Kunst" gezeigt wird, was die deutsche Seele seit Jahrzehnten in Rage bringt. Die Nazis feiern ihren Sieg über die Moderne. Am Tag nach der Eröffnung titelt der "Völkische Beobachter", es ist der 20. Juli 1937, auf seiner ersten Seite: "Deutsches Volk, urteile selbst! Entartete Kunst am Pranger". Am Pranger stehen Kokoschka und Beckmann, Dix und Grosz, Nolde, Kirchner und Kandinsky, Klee, Schlemmer und viele andere, mithin die Crème der deutschen Kunst.
(...) Bilder missliebiger Künstler verschwanden aus Museen, Filme und Theaterstücke wurden verboten. Der erste Kulminationspunkt im Amoklauf gegen die Moderne waren die Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933. Auf öffentlichen Plätzen brannten Bücher von Feuchtwanger, Freud, Kästner, Tucholsky und vielen anderen. In Berlin leitete Propagandaminister Goebbels die Bücherverbrennung mit einer Rede ein: "Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende, und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auch dem deutschen Wesen wieder die Gasse freigegeben." Die Nazis hatten es eilig, die Kultur unter ihre Kontrolle zu bringen. (...) Wie beispielsweise die offizielle bildende Kunst aussehen sollte, das zeigte, parallel zur "Entarteten Kunst", vom 18. Juli bis 31. Oktober 1937 im Haus der Deutschen Kunst die "Große Deutsche Kunstausstellung", ein unbeholfener Rückschritt ins 19. Jahrhundert im Dienst einer völkischen Kunstideologie. Was es dort zu sehen gab: Neun Führerbildnisse in Öl und Bronze; "fröhliche Landmänner" beim Essen, Trinken, Arbeiten; viele drahtige Jünglinge, auch Pimpfe, Mädchen meist blond, gelegentlich nackt, stets aber bar jeder Erotik; vereinzelt Frontsoldaten, SA-, SS-Männer und U-Boote; schöne (deutsche) Landschaft, Blut und Boden akkurat blutleer gemalt; (...) meist gefällige Posen, miefige Langeweile.
Auch in der Musik suchten die Nazis nach "Entartetem". (...) Kurt Weill und Hans Eisler traf der Bann ebenso wie den Jazz, was die SS nicht daran hinderte, im KZ Theresienstadt die Gründung der "Ghetto Swingers" zuzulassen, die insbesondere dann aufspielen mussten, wenn sich Besuch vom Internationalen Roten Kreuz angekündigt hatte. Goebbels diffamierte Paul Hind emith als "atonalen Geräuschmacher", Arnold Schönberg warf man "intellektuelle Gehirnakrobatik" vor. Schönberg emigrierte 1933, (...). 1934 hatten die Nazis die Reichsmusikkammer eingerichtet - mit keinem geringeren als Richard Strauss an der Spitze, der jedoch zwei Jahre später aus Protest gegen die Judenverfolgung zurücktrat.(...) Gefragt war "deutsche Musik" von Bruckner bis Wagner, alles, was dazu geeignet war, als romantisch-geheimnisvolle Schicksalsmacht aufzutreten oder der kollektiven Identifikation diente.
Jedoch wird die nationalsozialistische Kulturpolitik nirgends so spürbar wie im Massenmedium Film. 1933 wurde die Reichsfilmkammer eingerichtet. Alle Fäden liefen im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda beim Filmenthusiasten Goebbels zusammen, der schon früh die Macht des Mediums erkannt hatte: "Wir sind der Überzeugung, dass der Film momentan zu den modernsten und wissenschaftlichsten Mitteln gehört, um die Masse zu beeinflussen. Eine Regierung kann deswegen den Film nicht sich selbst überlassen." (...) 1933 wurden in Deutschland 135 Spielfilme produziert, während des gesamten "Dritten Reichs" waren es 1097, darunter "nur" 96, die ausdrücklich vom Propagandaministerium bestellt worden waren ("Jud Süß" von Veit Harlan zum Beispiel). 20 Millionen Deutsche sahen, nach offiziellen Angaben, Leni Riefenstahls ersten Parteitagsfilm "Sieg des Glaubens" (1934). (...)
Mit der Reichsfilmkammer hatten die Nazis ab 1933 ein Steuerungsinstrument, um das Medium gezielt einzusetzen und gegen "nichtarische" Filmschaffende vorzugehen. Zwar wurde die Filmindustrie nicht gleich verstaatlicht, die Produktionsseite lag abe in Hand der Partei - und der Filmkreditbank. So konnte Druck ausgeübt werden. (...) Unzählige Regisseure und Schauspieler gingen ins Exil (...).
Immer wieder wurde die Filmproduktion an die politische Lage angepasst. (...) "Der Westwall" etwa kommt am 10. August 1939 mit 350 Kopien in die Kinos, um die Deutschen auf den Krieg vorzubereiten. In den folgenden Jahren dominierten jedoch Unterhaltungsfilme - willkommene Ablenkung vom Frontbericht. Die Deutschen strömten in wachsender Zahl in die Kinos: Über eine Milliarde Kinokarten wurde 1942 umgesetzt - doppelt so viel wie 1939. Spaß stand hoch im Kurs. (...)
"Entartete Kunst": Herabsetzende und verleumderische Bezeichnung für alle Kunstwerke und Kunstrichtungen, die der Ideologie und dem "Kunstverständnis" der Nationalsozialisten nicht entsprachen. In der bildenden Kunst waren es vor allem die Richtungen der Moderne wie Impressionismus, Expressionismus, Kubismus, abstrakte Kunst, Fauvismus, Dadaismus und neue Sachlichkeit, gegen die sich dieser nationalsozialistische Kampfbegriff richtete. 1937 wurde in ganz Deutschland die von den Nationalsozialisten organisierte Ausstellung "Entartete Kunst" mit Werken der Moderne gezeigt. Die Bilder waren mit diffamierenden Texten und Fotos kranker Menschen versehen. Diese Darstellungsweise sollte bei der
Bevölkerung Abscheu und Widerwillen hervorrufen. Auch Architekten, Schriftsteller, Theater- und Filmschaffende und selbst Musiker wurden von den Nazis öffentlich diffamiert, wenn ihre Werke nicht der nationalsozialistischen Sichtweise entsprachen.
Reichsfilmkammer: Die Aufgabe dieser Kammer war eine einheitliche Kulturförderung im Sinne des nationalsozialistischen "Kulturverständisses". Die Reichsfilmkammer hatte die Möglichkeit, Mitglieder abzulehnen und Berufsverbote auszusprechen.
Die Nazis hetzten gegen die moderne Malerei und stellten die von ihnen diffamierten Künstler in der Ausstellung "Entartete Kunst" an den Pranger. Parallel dazu zeigten sie die Ausstellung "Große Deutsche Kunst".
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Die Nazis und die Kultur"?
Der Text beleuchtet die Auswirkungen der nationalsozialistischen Machtergreifung auf das kulturelle Leben in Deutschland. Er beschreibt, wie die Nazis die deutsche Kultur "verödeten", indem sie moderne Kunst verurteilten, Bücher verbrannten und Künstler verfolgten. Der Text thematisiert den Kampf gegen die Moderne, die Diffamierung von Künstlern und Musikern, die Rolle der Reichskulturkammer und die Instrumentalisierung des Films als Propagandainstrument.
Was waren die "Goldenen Zwanziger" und wie unterschied sich die Kultur unter den Nazis davon?
Die "Goldenen Zwanziger" waren eine Zeit kultureller Blüte in Deutschland. Im Gegensatz dazu führten die Nazis nach 1933 eine Politik der kulturellen Gleichschaltung und Verfolgung durch, was zu einer "Verödung" des kulturellen Lebens führte. Viele Künstler und Schriftsteller verließen Deutschland.
Was geschah bei den Bücherverbrennungen 1933?
Im Mai 1933 wurden in verschiedenen deutschen Universitätsstädten Bücher von als "unliebsam" geltenden Schriftstellern öffentlich verbrannt. Zu den betroffenen Autoren gehörten Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Heinrich Mann, Thomas Mann, Stefan Zweig und Kurt Tucholsky.
Was ist mit "Entartete Kunst" gemeint?
"Entartete Kunst" war ein abwertender Begriff, den die Nationalsozialisten für Kunstwerke und Kunstrichtungen verwendeten, die nicht ihrer Ideologie entsprachen. Dies betraf vor allem moderne Kunstrichtungen wie Impressionismus, Expressionismus, Kubismus und abstrakte Kunst. 1937 wurde die Ausstellung "Entartete Kunst" in Deutschland gezeigt, um die Bevölkerung gegen diese Kunstformen aufzubringen.
Wer waren einige der Künstler, die als "entartet" galten?
Zu den als "entartet" diffamierten Künstlern gehörten Kokoschka, Beckmann, Dix, Grosz, Nolde, Kirchner, Kandinsky, Klee und Schlemmer.
Welche Rolle spielte Joseph Goebbels in der nationalsozialistischen Kulturpolitik?
Joseph Goebbels, der Reichspropagandaminister, spielte eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Kulturpolitik. Er erkannte die Macht des Films als Propagandainstrument und kontrollierte die Reichsfilmkammer, um sicherzustellen, dass Filme im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie produziert wurden.
Was war die Reichsfilmkammer und welche Funktion hatte sie?
Die Reichsfilmkammer war eine Organisation, die 1933 gegründet wurde, um die Filmproduktion im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu steuern. Sie konnte Mitglieder ablehnen und Berufsverbote aussprechen, um sicherzustellen, dass nur "arische" Filmschaffende tätig waren.
Wie wurde der Film als Propagandainstrument eingesetzt?
Der Film wurde von den Nationalsozialisten gezielt eingesetzt, um die Bevölkerung zu beeinflussen und die politische Ideologie zu verbreiten. Propagandafilme wie "Jud Süß" wurden produziert, aber auch Unterhaltungsfilme wurden genutzt, um von den Kriegsereignissen abzulenken.
Was war die "Große Deutsche Kunstausstellung"?
Parallel zur Ausstellung "Entartete Kunst" wurde 1937 die "Große Deutsche Kunstausstellung" im Haus der Deutschen Kunst gezeigt. Diese Ausstellung präsentierte Kunstwerke, die im Sinne der völkischen Kunstideologie standen und einen Rückschritt ins 19. Jahrhundert darstellten.
Was geschah mit Musikern und der Musik unter den Nazis?
Auch in der Musik suchten die Nazis nach "Entartetem". Kurt Weill und Hans Eisler wurden mit Aufführungsverboten belegt, und Jazz wurde verboten. Gleichzeitig wurde "deutsche Musik" von Komponisten wie Bruckner und Wagner gefördert, die als romantisch und identitätsstiftend galten.
- Citar trabajo
- Schulze (Autor), 2000, Die Nazis und die Kultur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100341