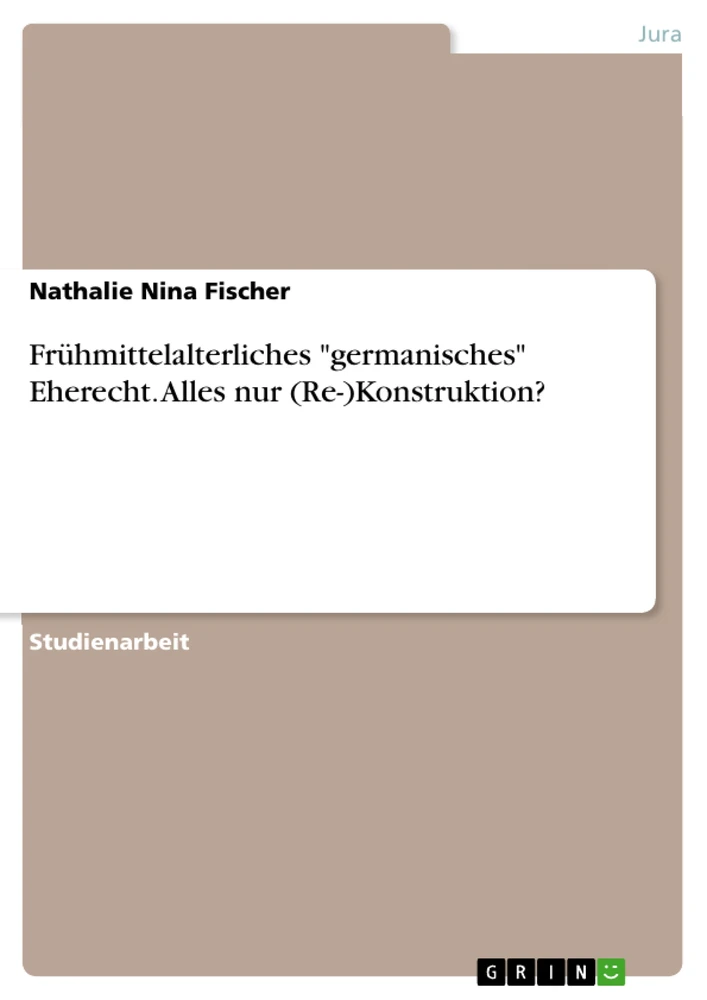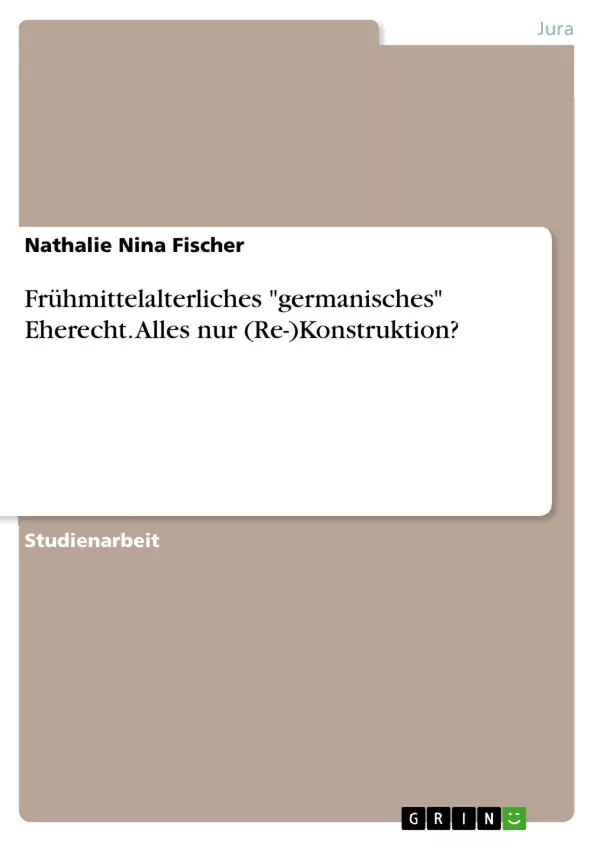Die vorliegende Seminararbeit knüpft zeitlich an das Ende der römischen Spätantike an und zielt darauf ab, das frühmittelalterliche "germanische" Eherecht zu beleuchten. Ein Einblick in soziokulturelle Strukturen der Germanenzeit soll ermöglicht werden. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, wer mit der oftmals als Sammelbegriff verwendeten Bezeichnung der Germanen gemeint ist und ob es ein gemeinsames, "urgermanisches" (Ehe)Recht gibt.
Vor diesem Hintergrund sollen die Eheschließungsformen und die "germanische" Mentalität insbesondere, aber nicht ausschließlich, nach langobardischem Recht, verankert im Edictus Rothari, untersucht werden. Es soll aufgezeigt werden, welche Rolle den zukünftigen Ehepartnern zukam und welche Konsequenzen die Ehe für das einzelne Individuum, das Ehepaar und deren "Sippen" hatte. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Muntehe sowie die Friedelehe gelegt. Es wird die Bedeutung und der Inhalt der Munt erläutert, anschließend das Regelungswerk der Muntehe umfassend beleuchtet, von Wegen in die Ehe, hin zu etwaigen Wegen aus derselben. Anschließend wird auf zwei weitere etwaige Eheschließungsformen eingegangen, die Kebsehe sowie die Raub-bzw. Entführungsehe.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Fragestellung - Frühmittelalterliches „germanisches“ Eherecht, alles nur (Re-)Konstruktion?
- Historischer Kontext
- Die Epoche des Frühmittelalters - Zeitgeschehen
- Die Germanen und die germanische Sippe
- Die Germanen eine Begriffsbestimmung
- Die germanische Sippe im Rechtswesen des Frühmittelalters
- Germanisches Eherecht - Mentalität - Eheformen
- Die Muntehe
- Etymologie
- Bedeutung und Inhalt der Munt bei den Germanen
- Die Muntehe unter germanischem Stammesrecht
- Das Regelungswerk der Ehe im germanischen Stammesrecht
- Ehehindernisse im germanischen Stammesrecht
- Das Innenverhältnis germanischer Eheleute
- Die Beendigung der Ehe im germanischen Stammesrecht
- Die Friedelehe
- Etymologie
- Bedeutung und Inhalt der Friedelehe
- Die Friedelehe im germanischen Recht - alles nur Konstrukt?
- Die morganatische Ehe - Inspiration zur Friedelehe?
- Die Kebsehe
- Etymologie
- Bedeutung und Inhalt der Kebsehe
- Die Kebsehe im germanischen Stammesrecht - alles nur Konstrukt?
- Die Raubehe oder auch die Entführungsehe
- Bedeutung und Inhalt der Raubehe und der Entführungsehe
- Quellenbeispiel Edictus Rothari, Kapitel 191
- Die Raubehe im germanischen Stammesrecht - alles nur Konstrukt?
- Die Muntehe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das frühmittelalterliche „germanische“ Eherecht, betrachtet den historischen Kontext und die soziokulturellen Strukturen der Germanenzeit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung des Begriffs „Germanen“ und der Frage nach einem gemeinsamen „urgermanischen“ Eherecht. Die Arbeit analysiert verschiedene Eheschließungsformen und deren Konsequenzen für Individuen, Paare und Sippen, mit besonderem Fokus auf der Muntehe und der Friedelehe.
- Historischer Kontext des frühmittelalterlichen „germanischen“ Eherechts
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Germanen“
- Analyse verschiedener frühmittelalterlicher Eheformen (Muntehe, Friedelehe, Kebsehe, Raubehe)
- Konsequenzen der Ehe für Individuen, Paare und Sippen
- Rekonstruktion und Interpretation des „germanischen“ Eherechts basierend auf verschiedenen Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt den historischen Kontext sowie die Zielsetzung der Arbeit. Es wird erläutert, dass die Arbeit sich mit dem frühmittelalterlichen „germanischen“ Eherecht auseinandersetzt und verschiedene Eheschließungsformen untersucht. Die Bedeutung des Begriffs „Germanen“ wird thematisiert, sowie die Frage nach einem einheitlichen „urgermanischen“ Eherecht. Die Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Analyse der verschiedenen Eheformen in den folgenden Kapiteln.
Historischer Kontext: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Epoche des Frühmittelalters und das Zeitgeschehen. Es behandelt die Germanen als Bevölkerungsgruppe, ihre soziale Organisation in Sippen und deren Bedeutung im frühmittelalterlichen Rechtswesen. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der soziokulturellen Bedingungen, in denen das germanische Eherecht entstand und funktionierte. Die genaue Bestimmung der „Germanen“ und der Frage nach einer einheitlichen Kultur wird untersucht, um die Grundlage für die spätere Diskussion über das germanische Recht zu legen.
Germanisches Eherecht - Mentalität - Eheformen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert verschiedene Formen der Ehe im germanischen Recht. Es wird detailliert auf die Muntehe, Friedelehe, Kebsehe und Raubehe eingegangen. Für jede Form werden Etymologie, Bedeutung, Inhalt und rechtliche Relevanz untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung des Regelungswerks, von der Eheschließung bis zur Auflösung der Ehe. Die Kapitel untersuchen auch die Rolle der zukünftigen Ehepartner und die Konsequenzen der Ehe für Individuen, Paare und ihre Sippen. Die Analyse bezieht sich auf verschiedene Quellen, darunter langobardische Gesetze im Edictus Rothari, um ein umfassendes Bild zu liefern.
Schlüsselwörter
Frühmittelalter, Germanen, germanisches Eherecht, Muntehe, Friedelehe, Kebsehe, Raubehe, Sippe, Stammesrecht, Edictus Rothari, Rechtsgeschichte, soziokulturelle Strukturen, (Re-)Konstruktion.
FAQ: Frühmittelalterliches „germanisches“ Eherecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das frühmittelalterliche „germanische“ Eherecht, den historischen Kontext und die soziokulturellen Strukturen der Germanenzeit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung des Begriffs „Germanen“ und der Frage nach einem gemeinsamen „urgermanischen“ Eherecht. Die Arbeit analysiert verschiedene Eheschließungsformen und deren Konsequenzen für Individuen, Paare und Sippen, mit besonderem Fokus auf der Muntehe und der Friedelehe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Kontext des frühmittelalterlichen „germanischen“ Eherechts, die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Germanen“, die Analyse verschiedener frühmittelalterlicher Eheformen (Muntehe, Friedelehe, Kebsehe, Raubehe), die Konsequenzen der Ehe für Individuen, Paare und Sippen und die Rekonstruktion und Interpretation des „germanischen“ Eherechts basierend auf verschiedenen Quellen.
Welche Eheformen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Muntehe, die Friedelehe, die Kebsehe und die Raubehe. Für jede Form werden Etymologie, Bedeutung, Inhalt und rechtliche Relevanz untersucht, einschließlich der Regelungen von der Eheschließung bis zur Auflösung der Ehe sowie der Rolle der Ehepartner und der Konsequenzen für Individuen, Paare und ihre Sippen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Quellen, um ein umfassendes Bild des germanischen Eherechts zu liefern. Ein genanntes Beispiel ist der Edictus Rothari.
Welche Frage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob von einem einheitlichen „urgermanischen“ Eherecht gesprochen werden kann oder ob die vermeintlichen Gemeinsamkeiten eher (Re-)Konstruktionen darstellen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext, ein Kapitel zur Analyse verschiedener Eheformen, und ein Fazit. Zusätzlich gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel zum Historischen Kontext behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Epoche des Frühmittelalters, die Germanen als Bevölkerungsgruppe, ihre soziale Organisation in Sippen und deren Bedeutung im frühmittelalterlichen Rechtswesen. Es wird die genaue Bestimmung der „Germanen“ und die Frage nach einer einheitlichen Kultur untersucht.
Was wird im Kapitel zu den Eheformen behandelt?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die Muntehe, Friedelehe, Kebsehe und Raubehe, inklusive Etymologie, Bedeutung, Inhalt und rechtlicher Relevanz. Es untersucht das Regelungswerk von der Eheschließung bis zur Auflösung und die Rolle der Ehepartner und der Konsequenzen für Individuen, Paare und Sippen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühmittelalter, Germanen, germanisches Eherecht, Muntehe, Friedelehe, Kebsehe, Raubehe, Sippe, Stammesrecht, Edictus Rothari, Rechtsgeschichte, soziokulturelle Strukturen, (Re-)Konstruktion.
- Quote paper
- Nathalie Nina Fischer (Author), 2020, Frühmittelalterliches "germanisches" Eherecht. Alles nur (Re-)Konstruktion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003423