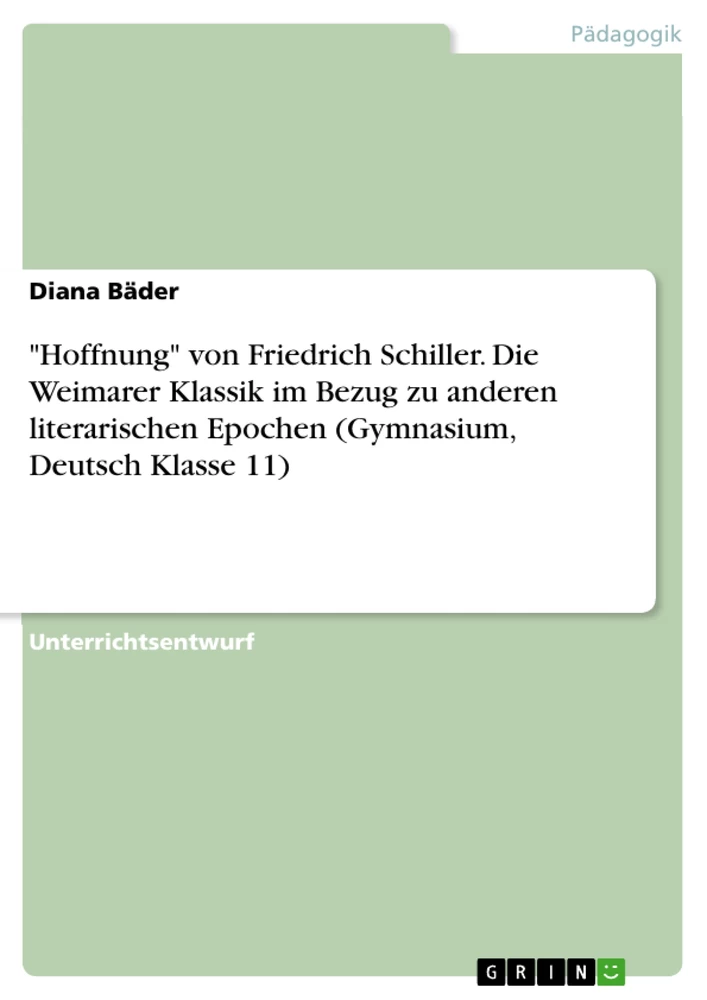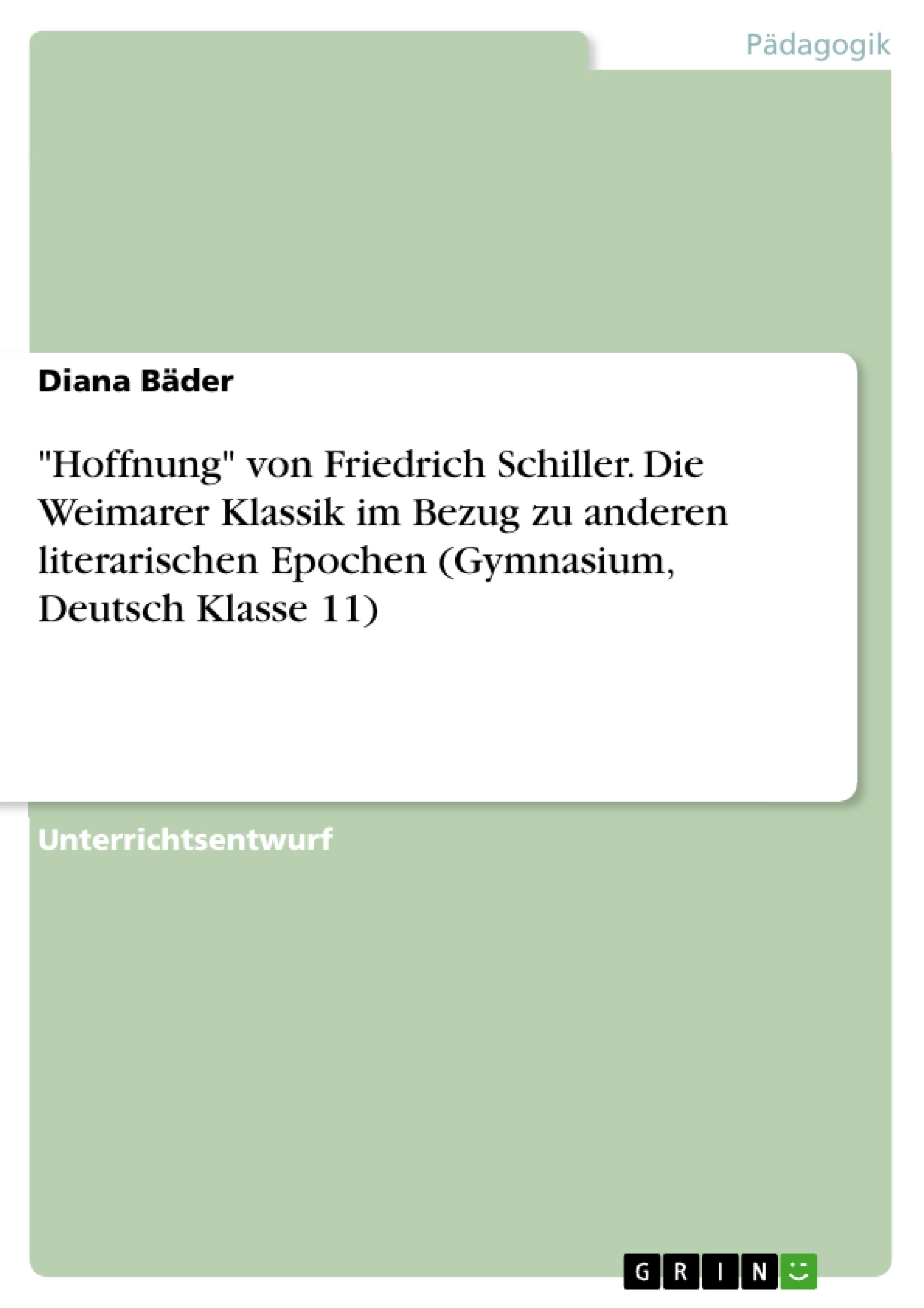Eine Unterrichtseinheit zum Thema Weimarer Klassik im Bezug zu anderen literarischen Epochen. Nachdem eine Gedichtsanalyse des Gedichts "Hoffnung" von Friedrich Schiller vorgenommen wird, werden die Ergebnisse in den Bezug zu der Weimarer Klassik gesetzt und verglichen mit anderen literarischen Epochen. Der Unterrichtsentwurf ist pädagogisch aufbereitet und begründet.
Der Grundkurs Deutsch befindet sich in der 11. Klasse eines Gymnasiums. Die Lernathmosphäre ist im allgemeinen recht positiv zu bezeichnen. Die SuS (Schülerinnen und Schüler) haben in der Sekundarstufe I erlernt, wie man lyrische Texte anlaysiert und interpretiert. Des Weiteren haben sie in einer vorherigen Unterrichtsreihe einen Überblick über Texte und Gattungen der Goethezeit und deren Merkmale erhalten. Nun soll sich näher mit den Epochen im 18. Jahrhundert beschäftigt werden, um Gedichte und theoretische Texte einer Epoche enger miteinander zu verknüpfen. Es soll sich vor allem auf die Goethezeit konzentriert werden, um den SuS einen Orientierungsrahmen zu setzen, der ihnen ermöglicht, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Epochen zu sehen, erworbenes Wissen zu strukturieren und neuen Stoff sinnvoll einzuordnen oder sogar kritisch zu betrachten. Das Werk soll im Rahmen einer thematischen Unterrichtsreihe behandelt werden und als Mittel zum Zweck des entdeckenden Lernens genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtsreihe: Literarische Epochen im 18. Jahrhundert
- Thema der Unterrichtseinheit: „Hoffnung“ von Friedrich Schiller. Die Weimarer Klassik im Bezug zu anderen literarischen Epochen
- Einleitung-Bedingungsanalyse zur Lerngruppe
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Unterrichtsreihe
- Lernziele
- Methodische Analyse
- Unterrichtsverlauf
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern (SuS) der 11. Klasse einen tieferen Einblick in die literarischen Epochen des 18. Jahrhunderts zu ermöglichen. Durch die Analyse des Gedichts „Hoffnung“ von Friedrich Schiller sollen die SuS die Weimarer Klassik im Kontext anderer Epochen besser verstehen und deren Merkmale vergleichen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Lyrikanalyse, dem Verständnis für die Bedeutung der Hoffnung im Kontext der Weimarer Klassik sowie der kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten und Gedanken der Epoche.
- Analyse von Lyrik im Kontext der Weimarer Klassik
- Das Motiv der Hoffnung in der Weimarer Klassik
- Vergleich der Weimarer Klassik mit anderen Epochen des 18. Jahrhunderts
- Kritische Analyse der Inhalte und Gedanken der Weimarer Klassik
- Verknüpfung von Lyrik und Anthropologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung-Bedingungsanalyse zur Lerngruppe beschreibt die Voraussetzungen der SuS und die Lernatmosphäre im Deutsch-Grundkurs der 11. Klasse. Die Sachanalyse fokussiert sich auf das Gedicht „Hoffnung“ von Friedrich Schiller, analysiert dessen Form, Struktur, Sprache und thematische Schwerpunkte. Die Didaktische Analyse beleuchtet die Relevanz des Gedichts im Hinblick auf den rheinland-pfälzischen Lehrplan und erläutert, wie es als Mittel zum entdeckenden Lernen eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Weimarer Klassik, Friedrich Schiller, „Hoffnung“, Lyrik, Anthropologie, Hoffnung, Fortschritt, Gedichtsanalyse, Epochenvergleich, Literaturgeschichte, 18. Jahrhundert, Sturm und Drang, Französische Revolution, Gedichtsstruktur, Reime, Versfüße, Stilmittel, Lehrplan.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schillers Gedicht „Hoffnung“?
Das Gedicht thematisiert das menschliche Streben nach einem besseren Ziel und die unzerstörbare Kraft der Hoffnung, die den Menschen durch alle Lebensphasen begleitet.
Wie wird das Gedicht im Unterricht der 11. Klasse eingesetzt?
Es dient als Basis für eine Gedichtanalyse, um Merkmale der Weimarer Klassik zu erarbeiten und diese mit anderen Epochen wie dem Sturm und Drang zu vergleichen.
Was sind zentrale Merkmale der Weimarer Klassik?
Dazu gehören das Streben nach Harmonie, Humanität, formale Strenge (z. B. Reimschemata und Metren) sowie die Verknüpfung von Lyrik und anthropologischen Fragestellungen.
Warum ist der Epochenvergleich für Schüler wichtig?
Er bietet einen Orientierungsrahmen, um literarische Texte historisch einzuordnen und Zusammenhänge zwischen den geistigen Strömungen des 18. Jahrhunderts zu verstehen.
Welche Rolle spielt die Anthropologie in dieser Unterrichtseinheit?
Die Arbeit verknüpft Schillers Lyrik mit dem damaligen Menschenbild der Klassik, insbesondere dem Glauben an Fortschritt und die Vervollkommnung des Individuums.
- Quote paper
- Diana Bäder (Author), 2019, "Hoffnung" von Friedrich Schiller. Die Weimarer Klassik im Bezug zu anderen literarischen Epochen (Gymnasium, Deutsch Klasse 11), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003892