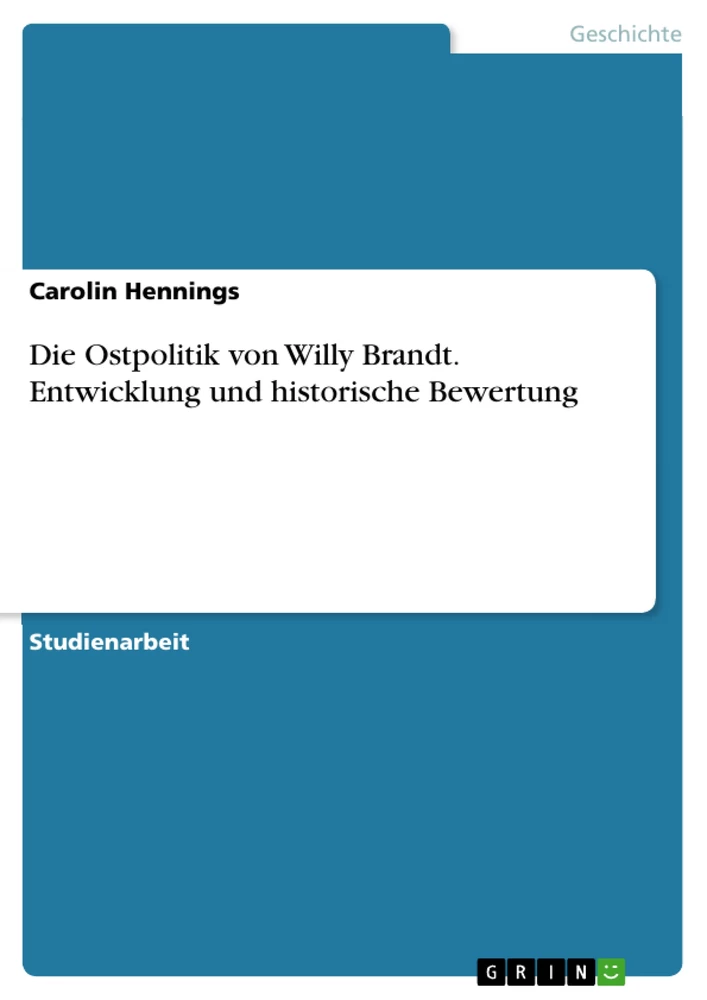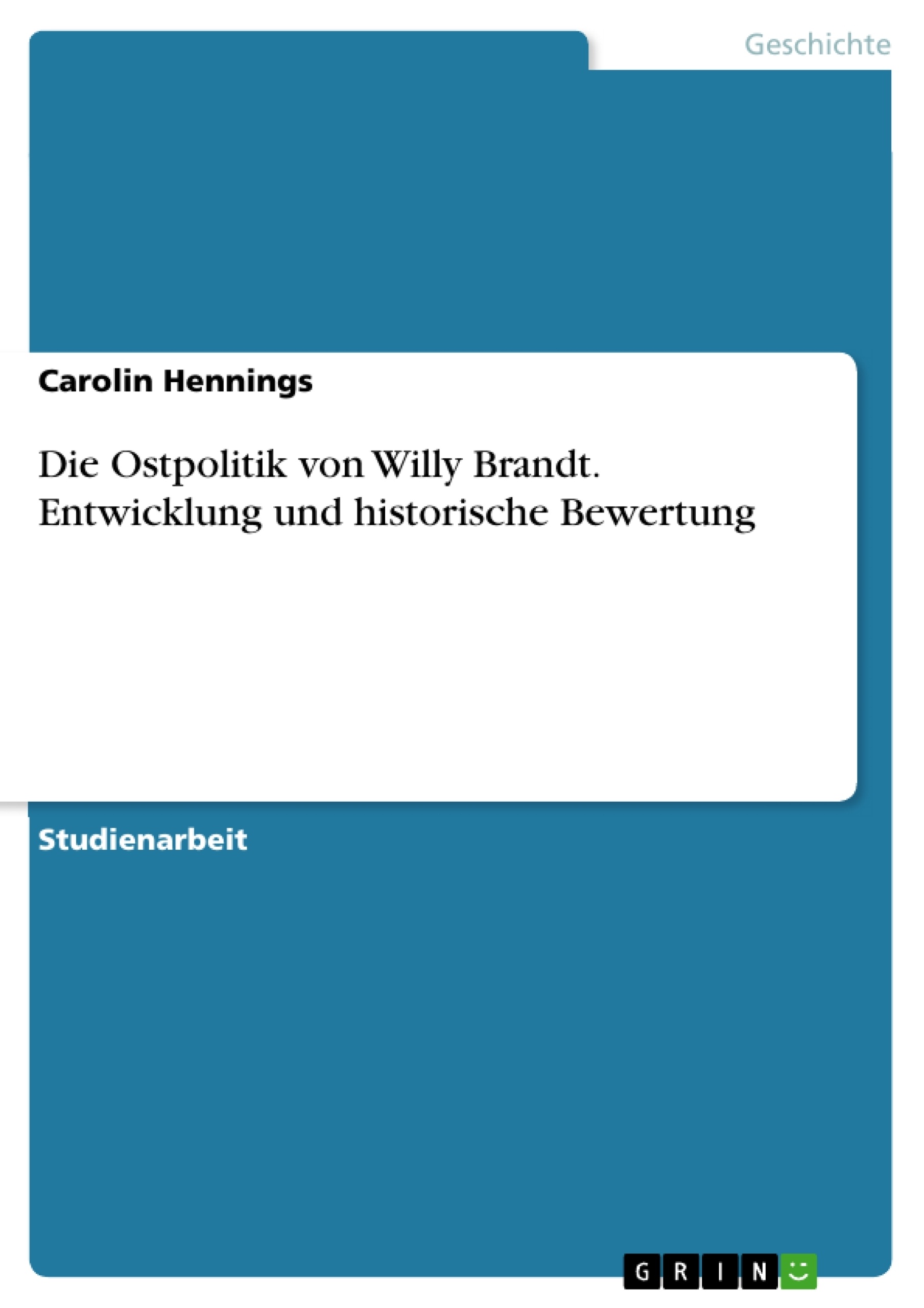Die Arbeit thematisiert die Ostpolitik von Willy Brandt. Willy Brandt war der erste Bundeskanzler, der es schaffte, die durch das Ende des zweiten Weltkrieges angespannte Lage zwischen Ost und West langfristig zu entspannen. Das gelang ihm durch die sogenannte „Neue Ostpolitik“. Bis heute wird die Ostpolitik von Willy Brandt als erster Schritt zur Wiedervereinigung angesehen und folgte neuen Grundsätzen. Dennoch ist auch die Politik von Willy Brandt immer vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen zu betrachten, die sich mehr und mehr auf die Versöhnung richteten. Willy Brandt nutzte demnach in gewisser Weise auch die Gunst der Stunde, um eine welthistorische Wende einzuleiten. Ob ihm das gelungen ist, welche Widerstände es gab und welches Misstrauen ihm dabei entgegenschlug, soll in dieser Arbeit geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Entwicklung der außenpolitischen Lage der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Ära Brandt
- 2.1 Der Kalte Krieg und der Ost-West- Konflikt
- 2.2 Politik der Westintegration unter Adenauer
- 3 Die Entwicklung der Ostpolitik unter Willy Brandt
- 3.1 Erste Annäherungen durch Passagierschein- Abkommen
- 3.2 Wandel von Wertesystem, Einstellungen und Zeitgeist in der BRD
- 3.2.1 Spaltung zwischen Sozialdemokraten und Konservativen
- 3.2.2 Optimistischer Zeitgeist als Voraussetzung für Transformation
- 3.2.3 Wandel durch Annäherung
- 3.3 Wichtige Verträge und deren Intention
- 3.3.1 Moskauer Vertrag mit der Sowjetunion (1970)
- 3.3.2 Warschauer Vertrag mit Polen (1970)
- 3.3.3 Viermächteabkommen über Berlin mit den USA, der UdSSR, dem Vereinigten Königreich und Frankreich (1971)
- 3.3.4 Transitabkommen mit der DDR (1971)
- 3.3.5 Grundlagenvertrag mit der DDR (1972)
- 3.3.6 Prager Vertrag mit der CSSR (1973)
- 4 Die historische Bewertung der Ostpolitik von Willy Brandt
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ostpolitik von Willy Brandt und untersucht, inwiefern sie einen Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik darstellte. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Entwicklung der außenpolitischen Lage der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg, der Entwicklung der Ostpolitik unter Willy Brandt sowie der historischen Bewertung der Ostpolitik.
- Die Bedeutung der Ostpolitik für die Bundesrepublik Deutschland
- Die Rolle von Willy Brandt in der Entwicklung der Ostpolitik
- Die wichtigsten Verträge der Ostpolitik
- Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die deutsch-deutschen Beziehungen
- Die historische Bewertung der Ostpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einleitung und erläutert die historische Bedeutung der Kanzlerschaft von Willy Brandt als Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Das zweite Kapitel beschreibt die Entwicklung der außenpolitischen Lage der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich des Kalten Krieges und der Politik der Westintegration unter Konrad Adenauer. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Ostpolitik unter Willy Brandt, insbesondere mit den ersten Annäherungen, dem Wandel von Wertesystem und Zeitgeist in der BRD, sowie den wichtigen Verträgen der Ostpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ostpolitik, Willy Brandt, Kalter Krieg, Westintegration, Bundesrepublik Deutschland, Deutsch-Deutsche Beziehungen, und historischen Analysen.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Neue Ostpolitik“ von Willy Brandt?
Es war eine Politik der Entspannung und Annäherung an die osteuropäischen Staaten und die DDR, unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“.
Welche waren die wichtigsten Verträge dieser Ära?
Dazu gehören der Moskauer Vertrag (1970), der Warschauer Vertrag (1970) und der Grundlagenvertrag mit der DDR (1972).
Wie unterschied sich Brandts Politik von der Adenauers?
Während Adenauer auf strikte Westintegration setzte, suchte Brandt zusätzlich den Dialog mit dem Osten, um die Folgen der Teilung zu lindern.
Galt die Ostpolitik als Schritt zur Wiedervereinigung?
Ja, sie wird heute oft als langfristiger Wegbereiter für die Entspannung gesehen, die schließlich die deutsche Wiedervereinigung ermöglichte.
Welchen Widerständen sah sich Brandt gegenüber?
In der BRD gab es starke Kritik von konservativen Kreisen, die in der Annäherung einen Ausverkauf deutscher Interessen und eine Anerkennung des Unrechtsregimes der DDR sahen.
- Arbeit zitieren
- Carolin Hennings (Autor:in), 2020, Die Ostpolitik von Willy Brandt. Entwicklung und historische Bewertung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003950