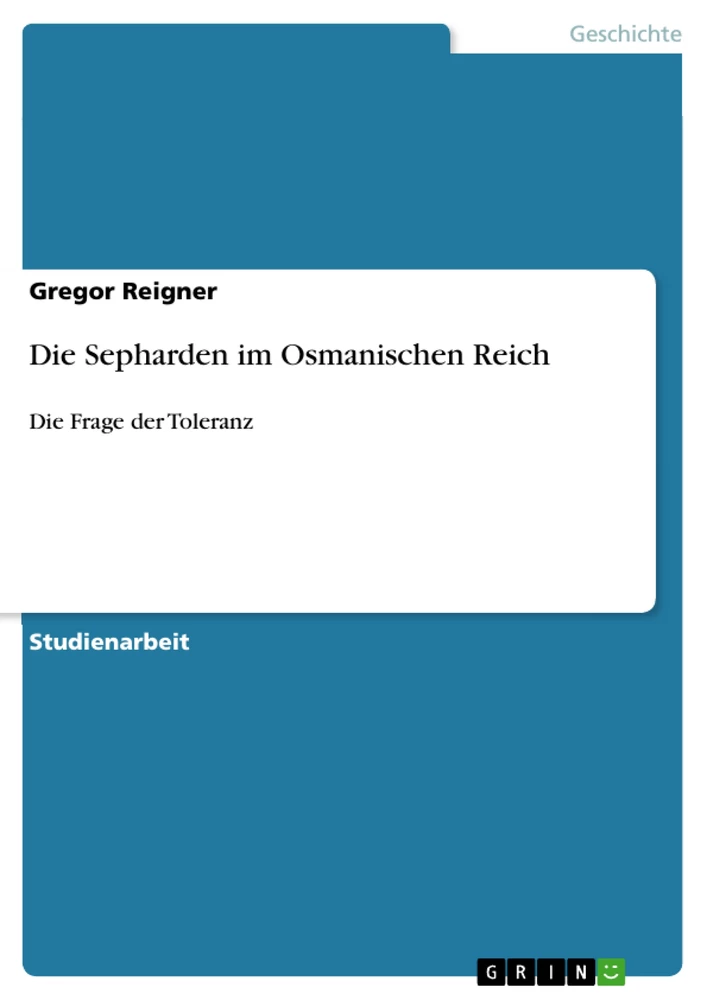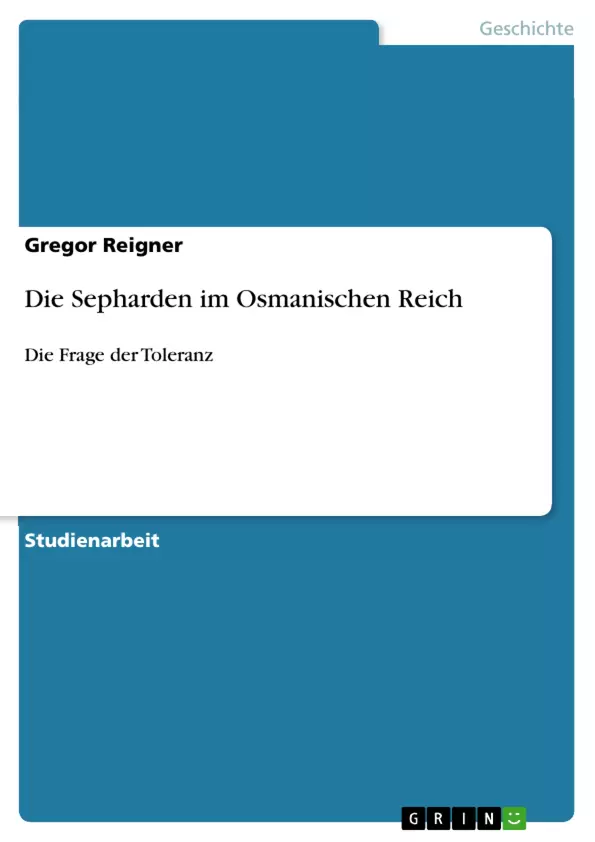Diese Arbeit beschäftigt sich mit den spanischen Juden, den Sepharden, im Osmanischen Reich. Vornehmlich will ich mich dabei auf die Döhnme und dem sog. Messianismus konzentrieren. Räumlich bewege ich mir hierbei im Bereich Europas, der unter osmanischer Herrschaft stand, mit besonderem Fokus auf Saloniki. Zeitlich wird diese Arbeit das 17. Jahrhundert umfassen. Hierbei will ich folgende Frage beantworten: Wie war es um die Toleranz der Osmanen gegenüber den Sepharden bestellt und war das Leben weniger beschwerlich als in anderen europäischen Reichen.
Um der Frage der Toleranz nachzugehen, werde ich v. a. das Phänomen der Döhnme – Juden, die zum Islam konvertiert waren – untersuchen. Welchen Einfluss der Messianismus darauf hatte und ob dieser in der Geschichte Europas einzigartig war, soll ebenfalls beleuchtet werden. Zuerst will ich mich aber der Stadt Saloniki widmen und ihre Besonderheit hervorheben. Dabei soll auch auf die Frage der osmanischen Toleranz eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Saloniki
- Shabbetay Tsevi und der Messianismus
- Das Phänomen der Dönme
- Die Konfessionalisierung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Sepharden im Osmanischen Reich, insbesondere mit den Dönme und dem sog. Messianismus. Die Arbeit konzentriert sich auf den Raum Europas unter osmanischer Herrschaft, insbesondere Saloniki, und behandelt das 17. Jahrhundert. Die Arbeit untersucht die Toleranz der Osmanen gegenüber den Sepharden und vergleicht das Leben im Osmanischen Reich mit anderen europäischen Reichen.
- Die besondere Rolle der Stadt Saloniki im Osmanischen Reich
- Der Einfluss des Messianismus auf das Leben der Sepharden
- Das Phänomen der Dönme und die Konversion zum Islam
- Die Frage der Toleranz der Osmanen gegenüber den Sepharden
- Die Auswirkungen des Messianismus auf die jüdische Gemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Herangehensweise der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Besonderheiten der Sepharden im Osmanischen Reich und stellt die Bedeutung des Messianismus und der Dönme in den Fokus.
- Saloniki: Dieses Kapitel widmet sich der Stadt Saloniki als wichtigstem Siedlungsort der Sepharden im Osmanischen Reich. Es beleuchtet die religiöse Freiheit der Sepharden als Dhimmis und die besondere Stellung Salonikis als „Jerusalem des Balkans". Das Kapitel geht auf die wirtschaftliche Bedeutung der Sepharden und das Millet-System ein.
- Shabbetay Tsevi und der Messianismus: Dieses Kapitel behandelt die Person und die Lehre des falschen Messias Shabbetay Tsevi. Es analysiert den Messianismus als Phänomen der Krisenzeit und seine Auswirkungen auf das Sephardentum. Das Kapitel untersucht die Bedeutung des Messianismus für die Dönme und die Konflikte mit der osmanischen Elite.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Toleranz, Sepharden, Osmanisches Reich, Messianismus, Dönme, Saloniki, Konversion zum Islam, Millet System, jüdische Geschichte, soziale Geschichte, Hermeneutik, Dhimmi.
- Citation du texte
- Gregor Reigner (Auteur), 2014, Die Sepharden im Osmanischen Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1004248