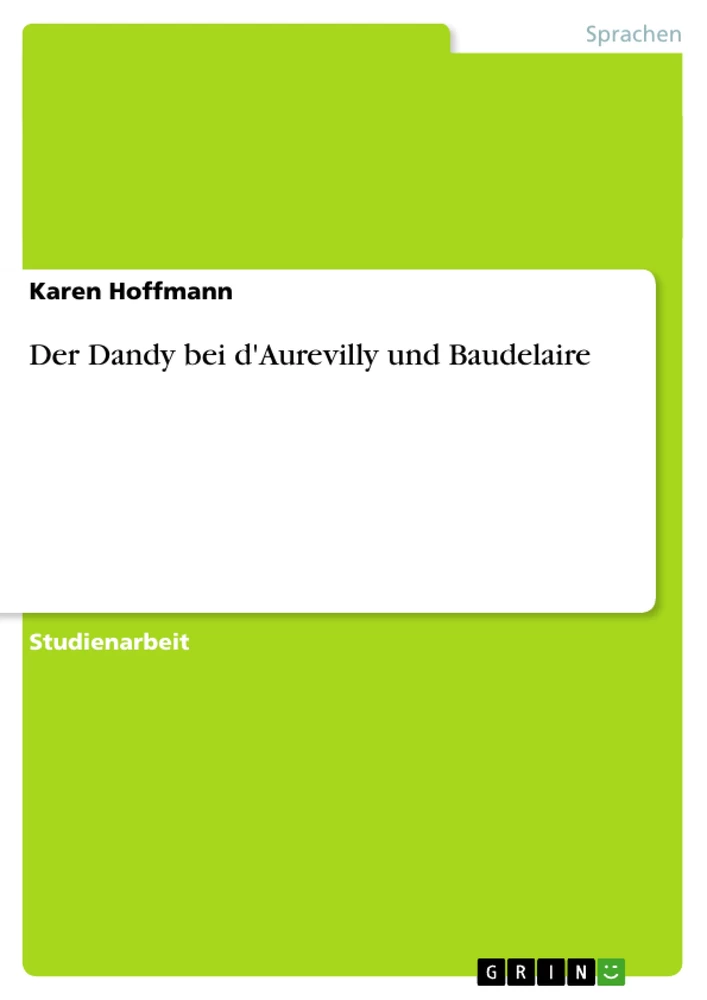Der Dandy ist ein bis heute vieluntersuchter und verschiedentlich interpretierter Sozialtypus des 19. Jahrhunderts. Balzac schreibt in seinem "Traktat über das elegante Leben", es gäbe drei Arten von Menschen: der Mensch, der arbeitet, der Mensch, der denkt, der Mensch, der nichts tut. Zur letzteren Sorte gehört der Dandy, der in einer Zeit des Umbruchs zuerst in England bezeugt ist, später in Frankreich und Deutschland. Das Dandytum war ein Ausdruck des Protestes einer überkommenen adligen Schicht, die mehr und mehr ihre tragende gesellschaftliche Rolle an das Bürgertum und an die industrielle Massengesellschaft verlor. Äußerlich zeigte sich dies in einer distinguierten Kleidung und in betont vornehmen Umgangsformen, zum Teil auch in Marotten: so ist von Dandys bezeugt, daß sie Schildkröten an der Leine spazieren führten, um so dem Bürgertum ihr Übermaß an Zeit höhnisch zu demonstrieren.
Doch neben diesen anekdotischen Einzelheiten beschäftigten sich einige große Geister des 19. Jahrhunderts, etwa Barbey d'Aurevilly oder Charles Baudelaire, theoretisch mit dem Phänomen des Dandys, der im Innersten von narzißtischer und frauenfeindlicher Kälte geprägt war. Den Gipfel an Provokation erlaubte sich als einer der letzten Dandys der irische Dichter Oscar Wilde, von dem die bewußt absurde Sentenz überliefert ist:
"Ich bin enttäuscht über den Atlantischen Ozean."
Es hatte zu allen Zeiten dem Dandy verwandte Naturen gegeben: etwa den spätrömischen Kaiser Heliogabal, der in Stefan Georges Gedichtband "Algabal" als mythisches Vorbild wiederauferstand, oder im 17. Jahrhundert Kardinal Richelieu und Lord Buckingham. Letztere hatten unter anderem durch ihre auffällige Kleidung, ihr gepflegtes Aussehen und ihre ausgeklügelten, effektheischenden Marotten geglänzt. Von Richelieu etwa heißt es, er habe seine Pferde mit silbernen Hufen absichtlich locker beschlagen lassen, in der Hoffnung, sie lösten sich und er hätte das Vergnügen, den Pöbel sich darum schlagen zu sehen. Und Buckingham habe seine Anzüge mit locker angenähten Edelsteinen verzieren lassen, deren Verlust er großzügig mit einkalkulierte, so seinen Reichtum offen zur Schau tragend.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einige Begriffserklärungen
- 2.1 Dandy und Dandysmus
- 2.2 Bohème
- 2.3 Der Ästhetizismus
- 3. d'Aurevilly, Brummel und Baudelaire
- 3.1 Jules Amédée Barbey d'Aurevilly
- 3.2 George Bryan Brummel
- 3.3 Charles Baudelaire
- 4. George Bryan Brummel und der Dandysmus bei d'Aurevilly
- 4.1 Entstehung
- 4.2 Der Dandysmus bei Brummel
- 5. Das Schöne und der Dandy bei Baudelaire
- 5.1 Das Schöne
- 5.2 Der Dandy
- 5.3 Die Frauen
- 6. Versuch eines Abschlusses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Dandy als Sozialtypus des 19. Jahrhunderts, insbesondere im Kontext der Werke von Barbey d'Aurevilly und Baudelaire. Ziel ist es, verschiedene Interpretationen des Dandytums zu beleuchten und die Rolle des Dandys im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel zu analysieren.
- Der Dandy als Ausdruck des gesellschaftlichen Protests gegen die aufkommende Bürgerlichkeit.
- Die ästhetische und philosophische Bedeutung des Dandysmus.
- Der Vergleich der Darstellung des Dandys bei d'Aurevilly und Baudelaire.
- Die Rolle der Kleidung und des Äußeren im Dandytum.
- Die Verbindung zwischen Dandytum und Ästhetizismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Dandys als vielschichtig interpretierten Sozialtypus des 19. Jahrhunderts ein. Sie erwähnt Balzacs Einteilung der Menschheit in drei Kategorien, wobei der Dandy derjenigen zugeordnet wird, die nichts tun. Der Dandy wird als Ausdruck des Protests einer untergehenden Adelsschicht gegen das aufsteigende Bürgertum und die industrielle Gesellschaft dargestellt. Die Einleitung erwähnt exemplarisch einige Dandys und deren provokantes Verhalten, um den Kontext zu verdeutlichen und die Schwierigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema aufgrund der limitierten Literaturlage und der Sprachbarrieren zu beleuchten. Es werden Forschungsfragen hinsichtlich Baudelaires Position zum Dandytum und Constantin Guys formuliert.
2. Einige Begriffserklärungen: Dieses Kapitel liefert Definitionen wichtiger Begriffe wie Dandy und Dandysmus, Bohème und Ästhetizismus. Es wird erläutert, dass der Begriff "Dandy" vielleicht vom englischen "to dandle" abgeleitet ist und ursprünglich nicht Selbstverliebtheit, sondern einen Ausdruck gesellschaftlicher Krise repräsentierte. Die geschichtliche Einordnung des Dandys im Kontext der napoleonischen Kontinentalsperre und des Wandels in der englischen Gesellschaft wird betont, wobei der Dandysmus als Protest gegen die aufkommende Bürgerlichkeit und den Materialismus gesehen wird.
3. d'Aurevilly, Brummel und Baudelaire: Dieses Kapitel bietet kurze biografische Skizzen von Barbey d'Aurevilly, George Bryan Brummel und Charles Baudelaire, den zentralen Figuren der Arbeit. Es liefert den Kontext für die nachfolgende Analyse ihrer jeweiligen Auseinandersetzung mit dem Thema Dandy.
4. George Bryan Brummel und der Dandysmus bei d'Aurevilly: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Dandysmus und dessen Ausprägung bei Brummel, dem "König der Dandys". Die Analyse konzentriert sich auf d'Aurevillys Betrachtung von Brummel und dessen Beitrag zum Verständnis des Dandysmus. Es werden Brummells Lebensumstände und sein Einfluss auf die Entwicklung des Dandysmus thematisiert.
5. Das Schöne und der Dandy bei Baudelaire: Dieses Kapitel untersucht Baudelaires Konzept von Schönheit und dessen Beziehung zum Dandy. Es wird die Darstellung des Dandys in Baudelaires Werk analysiert, wobei die Rolle der Frau im Kontext des Dandysmus beleuchtet wird. Der Fokus liegt auf Baudelaires Ästhetik und wie diese sich im Bild des Dandys widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Dandy, Dandysmus, Barbey d'Aurevilly, Charles Baudelaire, George Bryan Brummel, Ästhetizismus, Bohème, 19. Jahrhundert, Gesellschaftlicher Wandel, Protest, Schönheit, Narzissmus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über den Dandy im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Dandy als vielschichtigen Sozialtypus des 19. Jahrhunderts, insbesondere anhand der Werke von Barbey d'Aurevilly und Baudelaire. Sie beleuchtet verschiedene Interpretationen des Dandysmus und analysiert dessen Rolle im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel.
Welche Autoren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Figuren der Arbeit sind Barbey d'Aurevilly, George Bryan Brummel und Charles Baudelaire. Die Arbeit vergleicht deren jeweilige Auseinandersetzung mit dem Thema Dandy und analysiert, wie sie den Dandy in ihren Werken darstellen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. den Dandy als Ausdruck des gesellschaftlichen Protests gegen die aufkommende Bürgerlichkeit, die ästhetische und philosophische Bedeutung des Dandysmus, den Vergleich der Darstellung des Dandys bei d'Aurevilly und Baudelaire, die Rolle der Kleidung und des Äußeren im Dandytum sowie die Verbindung zwischen Dandytum und Ästhetizismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffserklärungen (Dandy, Dandysmus, Bohème, Ästhetizismus), biografische Skizzen von d'Aurevilly, Brummel und Baudelaire, die Analyse des Dandysmus bei Brummel und d'Aurevilly, die Analyse von Baudelaires Konzept des Schönen und des Dandys, und schließlich ein abschließender Versuch einer Zusammenfassung.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse des Dandys als komplexen Sozialtypus, beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels des 19. Jahrhunderts und vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven von d'Aurevilly und Baudelaire auf diesen Typus. Die Ergebnisse basieren auf einer gründlichen Auseinandersetzung mit den Werken der genannten Autoren.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Dandy, Dandysmus, Barbey d'Aurevilly, Charles Baudelaire, George Bryan Brummel, Ästhetizismus, Bohème, 19. Jahrhundert, Gesellschaftlicher Wandel, Protest, Schönheit, Narzissmus.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht unter anderem Baudelaires Position zum Dandytum und die Rolle von Constantin Guys im Kontext des Dandysmus. Sie beleuchtet die Entstehung des Dandysmus und dessen Ausprägung bei Brummel, dem "König der Dandys".
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für den Dandy als Sozialtypus des 19. Jahrhunderts, Literatur des 19. Jahrhunderts und die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen dieser Epoche interessieren. Sie richtet sich insbesondere an akademische Leser, die sich mit den Themen Ästhetizismus, Bohème und dem gesellschaftlichen Wandel auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Karen Hoffmann (Autor:in), 2001, Der Dandy bei d'Aurevilly und Baudelaire, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10047