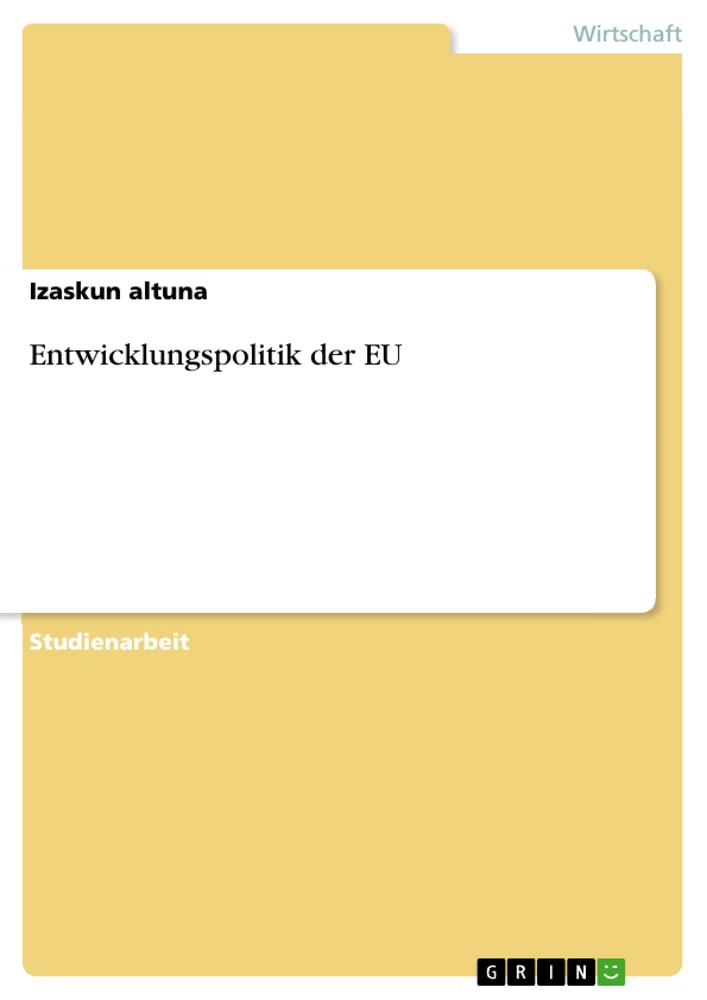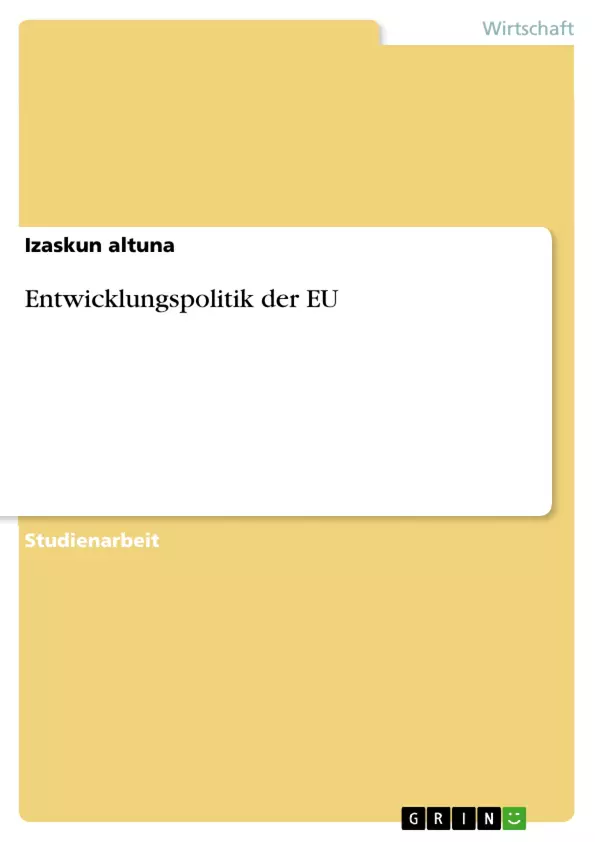1. EINLEITUNG: DIE EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGSPOLITIK
Die Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union1 stellt eine Ergänzung der Politik der Mitgliedstaaten dar. "Die Europäische Entwicklungspolitik meint nicht die Summe der von den EU-Staaten aufgebrachte ODA-Leistungen, sondern die vergemeinschaftete und in Brüssel verwaltete Entwicklungspolitik."2 Sie macht etwa 13% dieser Gesamtleistungen aus . Rechtliche Grundlage ihrer Tätigkeit ist der entwicklungspolitische Titel XVII des EG- Vertrages, der durch den am 1. November 1993 in Kraft getretenen Maastrichter Vertrag eingefügt wurde. "Nach dem Vertrag von Maastricht ist die Entwicklungshilfe der EU erstmals vertraglich abgesichert, aber nur als Ergänzung der nationalen Entwicklungspolitiken der Mitgliedsländer"3.
Ziele der europäischen Entwicklungszusammenarbeit sind danach (Artikel 130u EG-Vertrag), die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, deren harmonische und schrittweise Eingliederung in die Weltwirtschaft sowie Armutsbekämpfung.
Finanzierungsquelle sind der EU-Haushalt sowie der Europäische Entwicklungsfonds (EEF). Die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifik (AKP) wird aus dem EEF finanziert, der sich aus nationalen Beiträgen der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Die Mittel für entwicklungspolitische Massnahmen in den anderen Weltregionen (Mittelmeer, Asien, Lateinamerika) sowie für besondere Instrumente, z.B Nahrungsmittelhilfe und Humanitäre Hilfe, kommen aus dem allgemeinen EU-Haushalt. Das gleiche gilt für die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Die Europäische Investitionsbank4 stellt Darlehen für produktive Projekte und Programme sowie für Infrastrukturmassnahmen bereit5.
Als Gründe und Motive des entwicklungspolitischen Engagements der EG sind vier Faktoren zu nennen, die in der Arbeit erklärt werden: die Gründungsgeschichte der Gemeinschaft, die Auswirkungen bestehender EG-Kompetenzen, vor allem im Handels- und Agrarbereich, die Aussicht auf grössere Entwicklungsimpulse bei einem gemeinsamen Vorgehen der Mitgliedstaaten in EG-Rahmen und schliesslich die fehlende koloniale Vergangenheit der Gemeinschaft und ihr Image als "Zivilmacht Europa".
Die EU ist also weltweit entwicklungspolitisch tätig. Sie hat zahlreichen Ländern -ihren Nachbarn in der Mittelmeerregion (Assoziierungsabkommen mit Malta, die Türkei und Zypern; Kooperationsabkommen mit der Maghreb- und der Maschrek-Ländern sowie Israel) und in Mittel und Osteuropa (PHARE und TACIS)- einen Präferenzzugang zu ihrem Markt verschafft (APS). Den Ländern in Asien und Lateinamerika werden ebenfalls Präferenzen für die meisten ihrer Fertigerzeugnisse und ermässigte Zollsätze für bestimmte Agrarerzeugnisse gewährt. Abkommen wurden auch mit Zusammenschlüssen wie den ASEAN-Staaten oder den Andenpakt-Staaten geschlossen.
Der Kernpunkt bildet aber das Abkommen von Lomé, das von 71 Ländern in Afrika, im karibischen Raum und in Pazifischen Ozean (AKP Länder) unterzeichnet wurde. "Es ist das bedeutendste der EU mit den Entwicklungsländer"1. Das grösste Teil der Gemeinschaftshilfe wird über das Lomé Abkommen abgewickelt2, "ein Übereinkommen, das Handel, Entwicklungshilfe und politische Belange umfasst und Ausdruck der Verbundenheit der EU mit den ehemaligen Kolonien der Mitgliedstaaten ist"3.
Dieses Abkommen ist jedoch nicht unumstritten, während einige Autoren von der "Modellcharacter" dieser Beziehungen sprechen4gibt es Autoren, die über "die Agonie eines Models" oder "Demontage eines Models" sprechen5. September 1998 haben die Verhandlungen für die künftige Zusammenarbeit begonnen und Kolloquia und Seminaren finden in verschiedene Universitäten und innerhalb NRO statt6.
2. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN AKP-LÄNDERN
2.1. VORGESCHICHTE
Die Entwicklungspolitik der EG ist "geerbt"1. Man muss sich ins Gedächtnis zurückrufen, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 die meisten Mitgliedstaaten noch Kolonialmächte waren und somit enge wirtschaftliche Verflechtungen zu den Gebieten in Übersee bestanden. Die damaligen Kolonialmächte machten die Einbeziehung ihrer damaligen abhängigen Gebiete in die neu zu gründende Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einer Vorbedingung für ihre Mitgliedschaft2. "Alles hat ganz bescheiden, vielleicht sogar etwas peinlich begonnen, als Frankreich gegen Ende der Romvertrag-Verhandlungen das Problem seiner überseeischen Gebiete auf den Tisch gelegt und deren Assoziierung an die künftige EWG verlangt hat... Rückblickend sollten wir Frankreich dankbar sein, dass es uns das Kucksei der Assoziierung ins EWG-Nest legte"3.
Am 20.07.1963 wurde in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde ein Assoziierungsabkommen mit 18 souveränen afrikanischen Staaten für fünf Jahre geschlossen. Ende 1969 wurde dieses Abkommen weitergeführt (Jaunde II).
Am 28.02.1975 konnte mit dem Auslaufen der Jaunde Konvention ein neues Abkommen von den neun Mitgliedstaaten und 46 Staaten Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums in der togoischen Hauptstadt Lomé unterzeichnet werden. Nach dem EG-Beitritt von Grossbritanien im Jahre 1973 erweiterte sich der Kreis dieser Staaten um ehemalige Commonwealthgebiete. Der Beitritt Grossbritanniens, Irlands und Dänemarks war also der Anlass für eine Neuformulierung der Asoziierungspolitik. Über die territoriale Erweiterung hinaus zeichnete sich für ein neues Abkommen die Notwendigkeit inhaltlicher Veränderungen ab. Diese für fünf Jahre abgeschlossene Konvention stellte somit eine Weiterführung der Abkommen von Jaunde dar, enthielt aber auch neue Elemente. Die wichtigste Neuerung wurde im Rohstoff-bereich eingeführt, das STABEXSystem, eine Stabilisierung der Exporterlöse.
Laut Präambel zeigten sich die Vertreter entschlossen, "mit diesem Abkommen ein neues Modell der Beziehungen zwischen entwickelten und sich entwickelnden Staaten zu schaffen, im Sinne des internationalen Bestrebens nach einer gerechteren und ausgewogeneren Wirtschaftsordnung."
Das Lomé-Abkommen wurde gefeiert als Beitrag zu einer Neuen Weltwirtschaftsordnung. Die Euphorie der Politiker wurde allerdings von den Ökonomen nicht ganz geteilt. Kritiker waren der Meinung, dass es sich bei diesem etablierten Nord-Süd-Modell um eine moderne Verlängerung der tradierten Beziehungen Mutterland-Kolonie handelte, und dass es hinter der Ausbildung dieser neuzeitlichen Entwicklungsmodelle weniger humanitäre oder karitative Gründe gab, als vielmehr der Wunsch die historisch gewachsene Beziehungen und gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten in neue Bahnen zu lenken, um die Rohstoffe Afrikas, die Europa nicht hatte, zu sichern und zusätzlicher Absatzmäkte für die europäische Produkte zu schaffen.
Zwischen den neun EG-Staaten und 60 Entwicklungsländer folgte 1979 Lomé II , das in den Grundzügen dem ersten ähnelte. Lomé III wurde 1984 mit 65 AKP-Ländern unterzeichnet.
Mit Lomé III wurden nicht nur Investitionen in die Infrastrukturen gefördert, sondern auch die ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit der assoziierten Länder1.
Lomé IV wurde für eine Laufzeit von 10 Jahren, am 15.12.1989 mit 70 AKP-Staaten2 unterzeichnet, mit der Möglichkeit zur Änderung des Abkommentextes nach fünf Jahren. Mit diesem neuen Abkommen wurde der STABEX-Fonds erhöht, ein neuer Fonds zur Unterstützung von Strukturanpassungen eingeführt, der Dienstleistungssektor gefördert, der private Sektor gestärkt, die Demokratisierungsprozesse und die Menschenrechte unterstützt...usw . 3Aufgrund der Begrenzung des Finanzprotokolls auf 5 Jahre (1990-1995) musste für die zweite Hälfte der Laufzeit des Abkommens ein 2. Finanzprotokoll abgeschlossen werden.
Hinsichtlich der Instrumenten ist zu unterscheiden zwischen weltweiten und regionalen Instrumenten1.
2.2. WELTWEITE INSTRUMENTE
Zu den weltweit ausgerichteten Instrumente gehören folgende:
1967 trat die EWG dem Internationalen Nahrungsmittelhilfe-Abkommen bei, das nicht mehr regional beschränkt war, sondern bei Bedarf alle Entwicklungsländern einbezog. Dieses Programm war zunächst wenig entwicklugsorientiert und enthielt beachtliche Probleme. Es dauerte Zeit bis man sich klar wurde, dass es viel mehr darauf kommt, die Agrarproduktion in den Entwicklungsländer selbst zu steigern. Deshalb soll darauf geachtet werden, dass diese Art Hilfe nur dort geleistet wird, wo die Eigenproduktion noch nicht ausreicht oder unvorhersehbare Ernteausfälle eingetreten sind . Es sei doch auch zweckmässiger und kostengünstiger, in den jeweiligen Nachbarregionen Produkte anzukaufen, die den Essgewohnheiten der dort lebenden Menschen entsprechen, anstatt den Transport teurer EG-Überschüsse in weit entfernte Regionen zu bezahlen2.
1971 wurde zum ersten Mal eine Haushaltslinie für Katastrophen- und Soforthilfe aufgestellt, die zugunsten aller Entwicklungsländer verwendet werden kann. Ziel der Soforthilfe ist die Linderung der Folge von Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten durch Erste-Hilfe-Massnahmen. Seit 1992 gibt es ECHO, das Amt für humanitäre Hilfe der Gemeinschaft, um die bislang zeitaufwendige Vorbereitung künftig effizienter zu gestalten.
Die von ECHO verwalteten Mittel werden zum grössten Teil (85%) über Nichtregierungs- und internationale Organisationen abgewickelt.
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen: Betont wird die Notwendigkeit der Dezentralisierung der Kooperation , d.h. verstärkte Kooperation mit halb-staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen. Durch Aufnahme dieser Art Zusammenarbeit soll das Spektrum der Akteure erweitert werden, "um damit die entwicklungspolitischen Kompetenzen und Initiativkräfte in den Entwicklungsländer und auch in Europa besser zu mobilisieren"1. Auch im Zuge der Halbzeitüberprüfung des IV Abkommens von Lomé wurde "eine Neubelebung der dezentrale Zusammenarbeit beschlossen". Diese sei aber noch weit entfernt von der Wünschen der NRO2.
2.3. DIE WICHTIGSTE BEREICHE DER AKP-ZUSAMMENARBEIT
Die Verträge räumen den AKP-Staaten Handelsvorteile, Finanzhilfe und einen Ausgleich im Falle von Schwankungen ihrer Exporterlöse ein.
Die Handelspolitik der EU bedeutet die völlig freien Marktzugang zu den Märkten der EU bei Industriewaren. Bei Agrargütern ist der Marktzugang mit Ausnahme einiger Marktordnungsprodukte ebenfalls frei. Bei Agrargütern mit Einfuhrbeschränkungen bestehen für die AKP-Staaten jedoch Präferenzregelungen (z.B. bei Zitrusfrüchten, Fleisch, Getreide).
Diese handelspolitische Vergünstigungen sind nicht reziprok, d.h. die AKP-Staaten müssen der EU nicht die gleichen Vergünstigungen einräumen. Die Importe aus der EU müssen aber zumindest gleich behandelt werden wie Importe aus anderen Industrieländern (Meistbegünstigung).
Diese vor allem bezüglich der Industriewaren vorteilhaften handelspolitischen Regelungen können von den AKP-Staaten jedoch nur unzureichend genutzt werden. Ihre Exportstruktur ist durch Rohstoffexporte gekennzeichnet (über 80 v.H)3. Durch die Präferenzregelungen für andere Entwicklungsländer werden zudem die Marktzugangsvorteile der AKP-Staaten geschmälert. Diese fördern daher auch, dass ihr relativer Vorteil gegenüber anderen Entwicklungsländer erhalten bleiben soll. Die EU ist jedoch hierzu nicht bereit.
Der freie Zugang ist in mehreren Bereichen durch eine Reihe von Sonderstimmungen eingeschränkt, dazu zahlen insbesondere die Schutzmassnahmen, die die EU, wenn "ernste Störungen" bei EG-Staaten aufgrund der Lomé-Handelsregelungen ergreifen können; bestimmte Protokolle für einige Agrarerzeugnisse (Zucker, Rindfleisch, Rum); und die Ursprungsregeln, das heisst, die Anforderungen hinsichtlich des Ursprungs einer Ware, damit sie in die EG exportiert werden kann1.
Die Finanzielle und Technische Zusammenarbeit ist ein weiteres wesentliches Element des Lomé-Abkommens.
Finanzielle Zusammenarbeit bezeichnet die Kapitalhilfe an Entwicklungsländer in Form von Zuschüssen oder günstigen Darlehen. Damit sollen die Produktionsmöglichkeiten eines Entwicklungslandes einschliesslich der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur verbessert werden.
Unter Technischer Zusammenarbeit wird demgegenüber die fachliche Hilfe für Entwicklungsländer gefasst. Sie soll das Leistungsvermögen von Menschen und Organisationen in der Dritte Welt erhöhen.
Obwohl die ländliche Entwicklung den Schwerpunkt der Zusammenarbeit der EU mit den AKP-Staaten unter Lomé IV bildet, eine Umsichtung zugunsten der sozialen Sektoren -u.a. Gesundheit und Erziehung/Ausbildung- ist zu verzeichnen2.
Weitere Instrumente der Zusammenarbeit sind das schon erwähnte System zur Stabilisierung der Exporterlöse STABEX und Système Minerais SYSMIN:
STABEX: Mit diesem 1975 geschaffenen System trägt die Gemeinschaft zur Stabilisierung von Exporterlösschwankungen agrarischer Rohstoffe bei. STABEX wird häufig als eine Art "Versicherung gegen schlechte Jahre" gesehen und soll die zuweilen stark schwankenden Weltmarktpreise für unverarbeitete Agrarerzeugnisse abfedern und durch Ausgleichszahlungen Einbrüche in den jeweils betroffenen Sektoren verhindern.
Ziele des Systems ist also "durch finanzielle Ausgleichstransfers die negativen Auswirkungen von Exporterlöseinbüssen zu begrenzen, die diese Länder bei der Ausfuhr bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in die Gemeinschaft erleiden"1.
Auch nach mehr als 20-jähriger Praxis gilt dieses System innerhalb der Lomé-Abkommen zu den entwicklungspolitisch wichtigsten Kooperationsbereiche. Die Liste der Güter, die in das STABEX-System einbezogen sind, umfasst bei der Halbzeitrevision 50 landwirtschaftliche Rohstoffe. Zwei technische Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Land Leistungen aus dem System erhalten kann:
a) Der Anteil der Exporte des jeweiligen Rohstoffs an den Gesamtexportes des Landes muss mindestens 5% betragen (dieser Wert wird Abhängigkeitsschwelle genannt).
b) Ausserdem müssen die tatsächlichen Exporterlöse eines Jahres um mindestens 4,5 % (Auslöseschwelle) unter dem Durchschnitterlös der vier vorangegangenen Jahre (Bezugsniveau) liegen.
Sonderregelungen gelten für die am wenigsten entwickelten AKP-Staaten, AKP Binnenstaaten und AKP Inselstaaten; für sie betragen die Abhängigkeits- und Auslöseschwelle jeweils 1%.
Seit Inkrafttreten von Lomé IV werden die Transferzahlungen in Form von nicht rückzahlbare Zuschüssen vergeben.
Beurteilung dieses Systems 1:
In der entwicklungspolitischen Diskussion wird die Beurteilung von STABEX häufig durch eine Gegenüberstellung von Vorteilen und Nachteilen erfolgt. Die Stärken und Schwächen können, je nach Bewertungsmasstab auch ambivalent bewertet werden. Hier werden nur einige Vorteile bzw. Nachteile betrachtet, als Beispiel von den zahlreiche sowohl positive, als auch negative Kritiken, um zu zeigen, dass dieses System (wie alle andere Instrumente der Entwicklungspolitik) kein unumstrittenes System ist.
Als entwicklugspolitisch positiv sind, u.a.:
-die differenzierende Behandlungen der AKP-Staaten nach dem Grad der Bedürftigkeit,
-die nicht-Rückgabezahlungsverpflichtung der Zuschüssen,
-als ordnungspolitischer Vorteil wird herausgestellt, dass durch dieses Instrument kein direkter Eingriff in den Marktmechanismus stattfindet.
Die Kritikpunkte fallen insbesondere in folgende Bereiche:
-allen Erlösstabilisierungsystemen ist gemeinsam, dass sie der Zwang zur Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur mindern. Diese Problematik stellte sich vor allem bei Lomé I-III. Es wird sich zeigen , ob die starke Betonung von Diversifizierungsmassnahme im Lomé IV Strukturanpassungen unterstützen wird.
-Kritisiert wird ferner, dass es sich um kein sich selbst finanzierendes System handelt; die Leistungen sind nicht rückzahlbar. Auch die Kontrolle von Missbrauch sei, nach vielen Autoren, unzureichend;
-die Zahl der einbezogenen Produkte ist begrenzt, es fehlen die Agrarprodukte, die durch die EG-Marktordnungen gestützt werden. Ausserdem sind verarbeitete Agrarprodukte nicht einbezogen;
-hinzu kommen die unzureichende Mittel des Fonds: als zu Beginn der 80er Jahre die Rohstoffpreise verfielen, waren die Mittel bald erschöpft.
SYSMIN: Ein ähnlicher Mechanismus (System zur Stabilisierung der Ausfuhrerlöse bei Bergbauerzeugnisse) sichert die Ausfuhrerlöse bei Bodenschätzen. Die Abhängigkeitsschwelle beträgt hier 15 v.H., die Auslöseschwelle 10 v.H. Im Gegensatz zu STABEX erfolgt beim Mineralienfonds jedoch keine automatische Stabilisierung. Vielmehr sind unter bestimmten Bedingungen projektbezogene Leistungen möglich, die der Beseitigung der Problemursachen dienen sollen.
Durch das Abkommen von Lomé wurden auch die politischen Beziehungen institutionalisiert: AKP-EU-Ministerrat für die Festlegung der Grundzüge der Kooperation, Botschafterausschuss (ständige Vertreter der Mitgliedstaaten bei der Europäischen Kommission, ein Vertreter der Europäischen Kommission und die Vertreter der AKP-Staaten bei der Europäischen Kommission), der dem Ministerrat bei seinen Aufgaben assistiert und die Verwirklichung der Ziele des Abkommens überwacht, und Paritätische Ausschuss, in dem zu gleichen Anteilen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Mitgliedern der Parlamente der AKP-Staaten gestellt wird. Hier findet ein Dialog statt, der der Völkerverständigung zwischen AKP- und Unionsstaaten, der Diskussion über die AKP-EU- Zusammenarbeit und Problemen der Entwicklungspolitik im allgemeinen dient.
Strukturanpassungshilfe: Die hohe Verschuldung der meisten AKP-Länder,
Zahlungsbilanzprobleme... haben die EG veranlasst sich seit 1987 mit den
Strukturanpassungshilfe zu beschäftigen. Sie unterstützt zum Beispiel Importprogramme, die die Zahlungsbilanz eines Landes verbessern oder Dezentralisierungsprogramme, die die Verwaltungsstrukturen eines Landes optimieren helfen.
Menschenrechte: Die insbesondere seit Ende der 80er Jahre wieder neu aufflackernde Diskussion um Menschenrechte und Demokratie in der Dritten Welt hat seit langem Eingang in die Diskussionen der europäischen Entwicklungspolitik gefunden.
Unterschiedliche Ansätze in der EG und die Ablehnung von der AKP-Seite Bestimmungen über die Menschenrechte in die Lomé Konvention aufzunehmen hatten u.a. zur Folge, dass bis Lomé IV kein Kapitel über Menschenrechte aufgenommen wurde. Darin (Artikel 5) wird das Recht auf Menschenwürde und -recht ausdrücklich betont. Darüber hinaus nimmt die Präambel bezug auf Menschenrechtskonventionen. Allerdings besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte. Im Rahmen der Halbzeitrevision (1995) wurde eine Klausel eingeführt, nach der die Hilfe für einen Staat ausgesetzt werden kann, wenn er gegen die Artikel über Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat der Konvention verstösst
Allerdings hat die EU in en letzten Jahren gezeigt, dass sie die Bedeutung der Demokratie in der Kooperation mit Ländern der Dritten Welt sehr unterschiedlich gewichtet: In den meisten Ländern hat die EU seit 1990 ihren Einfluss zur Sicherung von Menschenrechten und zur Förderung von Demokratie geltend gemacht, aber in andere Fälle (z.B. Nigeria) konnte man über Stillschweigende Duldung von Menschenrechtsverletzungen oder Ausgrenzung sprechen. "Entwicklungspolitik ist Interessenpolitik"1und deswegen spielen die wirtschaftliche und strategische Gründen so eine grosse Rolle.
Ausserdem verfügt die EU über keine ausreichende Kontroll- und Sanktionsmassnahmen, die im Falle von Menschenrechtsverletzungen zum Einsatz kommen könnten. Von daher ist es fraglich, inwiefern die Aufnahme solcher Artikel nicht nur deklaratorischen Charakter haben und letztlich ineffizient bleiben.
3. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT DER EU MIT DER AKP-STAATEN.
3.1. ZIELERREICHUNG UND LEISTUNGSFÄHIGKEITEN
Seit Beginn der 80er Jahre befinden sich zahlreiche AKP-Staaten in einer schweren ökonomischen Krise. Die Lomé Politik konnte diese Entwicklung nicht verhindern.
Die hohe Erwartungen, mit denen man 1975 die Lomé Zusammenarbeit begonnen hatte, sind nicht erfüllt worden. Schon beim Abschluss von Lomé II war die anfängliche Euphorie einer gewissen Resignation gewichen. Zwar bedeutete Lomé III und IV eine Verbesserung der Entwicklungsprogramme, da man die Einsicht gewonnen hatte, dass die Probleme der Dritten Welt langfristig nur aus dem Inneren heraus gelöst werden können und man entsprechende Schritte einleitete (Pissani Memorandum 1982), wie z.B. Projekte zum Ausbau der Ernährungsautonomie, zur besseren Berücksichtigung ökologischer Notwendigkeiten wie Bekämpfung der Versteppung und der Wüstenbildung, Wiederaufforstung, dörfliche Wasserversorgung, Begrenzung der Viehbestände... und Massnahmen zur Wahrung der Menschenrechte, aber dennoch ist die Gesamtbilanz eher traurig.
"Die Resultate der bisherigen Lomé-Zusammenarbeit sind keineswegs zufriedenstellend"1und Entwicklungsexperten fordern in der Zusammenarbeit mir der Dritten Welt ein weitreichendes "Umdenken der Europäer"2.
Die Lücke zwischen Zielsetzung und Zielerreichung ist besonders gross bei der handelspolitische Zusammenarbeit. Trotz des präferentiellen Zollsystems ist der AKP-Anteil am EU-Handel seit Jahren rückläufig3. So stabilisiert das Instrument zur Exporterlösstabilisierung STABEX rohstofforientierte Strukturen. Der Erfolg der Strukturanpassungsprogramme kann noch nicht beurteilt werden. Am ehesten haben noch die Not- und Soforthilfe die entwicklungspolitische Ziele der EG erreicht.
3.2. KOHÄRENZ MIT ANDEREN POLITIKBEREICHEN
Die Entwicklungspolitik der EU hat ein grosses Kohärenzproblem, Kohärenz insbesondere zwischen Handels-, Agrar- und Umweltpolitik, das heisst, "dass sie mit der einen Hand Wohltaten vergibt und mit der anderen Hand noch mehr Schaden anrichtet"4.
Seit langem schon wird über die negativen Auswirkungen der EG-Agrarpolitik Klage geführt. Dies berührt zwei Problemfelder1 . Zum einen nimmt die EG Produkte aus der Dritten Welt in hinreichendem Masse trotz günstigerer Preise nicht auf, zum anderen wirft sie ihre Überschüsse zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt und beeinträchtigt dadurch die Weltmarktpreise und somit die Verdienstmöglichkeiten der Bauern in der Dritten Welt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die negativen Auswirkungen der EG- Nahrungsmittelhilfe. Die EU sollte ihre eigenen Agrarstrukturen verändern im Interesse eines ausgewogenen Welthandels, der allen Beteiligten eine Chance gibt.
Der Abschluss der Uruguay-Runde2höhlte die den AKP-Staaten eingeräumten Handelspräferenzen und damit ein Kernstück der Lomé Politik aus. Dies wird auch als "Präferenzerosion" bezeichnet. Weltweite Liberalisierung im Bereich der tarifären Handelshemmnisse reduzieren zunehmend die Vorteile von Lomé und haben diese Präferenzerosion zur Folge. Die AKP-Staaten befürchten, dass der Europäische Binnenmarkt und die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen der EG mit den Ländern Osteuropas zusätzlich zu ihrer Verdrängung vom EG-Markt beitragen werden.
4. DISKUSSION UM DIE ZUKUNFT DER KOOPERATION
"Afrika südlich der Sahara ist der Teil der ehemaligen "Dritten Welt", der besonders mit der Union verbunden ist und gleichzeitig in den 80er Jahren die geringsten Entwicklungsfortschritte aufwies"3.
Ob und in welche Richtung die Lomé Zusammenarbeit zu reformieren ist, gehört zu den umstrittensten Fragen der aktuellen Debatte zur EU-Südpolitik. Das Lomé IV-Abkommen hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2000. Inzwischen fordern zahlreiche Experten eine Revision des Lomé Modells: Einige Autoren argumentieren grundlegend gegen eine Fortführung der Kooperation, andere wiederum sehen Perspektiven für eine Reform des Lomé-Modells1. "Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob das Modell heute überhaupt noch eine Perspektive hat, wo sich doch alle Bedingungen verändert haben"2.
Die Überwindung der Ost-West-Konflikts hat die geostrategische Funktion der Lomé- Politik als antikommunistische Eindämmungspolitik überflüssig gemacht und die AKP- Staatengruppe in das innenpolitische Abseits verdrängt. Stellvertreterkriege, die vor Hintergrund des Ost-West-Konflikts nicht selten in den Entwicklungsländer ausgetragen wurden, nach dem Motto: "Wir (IL) unterstützen euch finanziell, dafür haltet ihr (EL) euch von Kommunismus oder umgekehrt vom Kapitalismus fern", entfallen seitdem und sind sicher einer der Gründe für das abnehmende Interesse an den Drittweltländern des Südens.
Festzuhalten bleibt also, auch wenn die EU das immer wieder bestreitet, eine Interessenverschiebung, zu Ungunsten der AKP-Staaten, nach Osteuropa und auf den Mittelmeerraum.
Viele Politiker des Südens meinen heute, die "Freunde im Norden" würden sie infolge der Bedürfnisse ihrer "Brüder im Osten" vergessen. Und sicherlich steckt hinter dieser Auffassung mehr als nur ein Körnchen Wahrheit.
Die AKP-Staaten bilden keine Einheit mehr, sondern viel mehr eine immer vielfältigere Gruppe von Entwicklungsländer. Von daher wird kritisiert, ob eine stärker differenzierte Zusammenarbeit mit diesen Länder nicht sinnvoller wäre.
"Welche der möglichen Optionen für die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den AKP-Staaten eingeschlagen wird, ist noch nicht abzusehen."3 . Die eigentliche Verhandlungen darüber haben September 1998 begonnen. Das Grünbuch der Kommission1bietet zahlreiche Optionen an. Mit Sicherheit wäre ein ähnliches Dokument von der AKP Seite sehr interessant. Es steht darüber Einigkeit, dass die Effizienz der Zusammenarbeit gesteigert werden muss und dass dabei die wirtschaftliche und soziale Dimension, die institutionelle Dimension und die Unterstützung des staatlichen Sektors sowie die Förderung von Handel und Investitionen im Mittelpunkt der zukünftigen Zusammenarbeit stehen sollen.
[...]
1 EG und EU werden paralell benutzt.
2 Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch..., 1996, S. 471
3 Andersen, Entwiclungshilfe..., 1996, S. 41.
4 nur noch 10% der gesamten Finanzen stehen in Rahmen von Lomé IV über die EIB zur Verfügung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der europäischen Entwicklungspolitik laut EG-Vertrag?
Die Ziele sind die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, deren harmonische und schrittweise Eingliederung in die Weltwirtschaft sowie Armutsbekämpfung.
Woher stammen die finanziellen Mittel für die europäische Entwicklungszusammenarbeit?
Die Finanzierungsquellen sind der EU-Haushalt und der Europäische Entwicklungsfonds (EEF). Der EEF wird durch nationale Beiträge der Mitgliedstaaten gespeist.
Welche Länder profitieren hauptsächlich vom Europäischen Entwicklungsfonds (EEF)?
Die Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifik (AKP) profitieren hauptsächlich vom EEF.
Welche Gründe werden für das entwicklungspolitische Engagement der EG genannt?
Vier Faktoren werden genannt: die Gründungsgeschichte der Gemeinschaft, die Auswirkungen bestehender EG-Kompetenzen (besonders im Handels- und Agrarbereich), die Aussicht auf größere Entwicklungsimpulse durch gemeinsames Vorgehen und das Image der EG als "Zivilmacht Europa" aufgrund fehlender kolonialer Vergangenheit.
Was ist das Abkommen von Lomé?
Das Abkommen von Lomé ist ein Abkommen mit 71 Ländern in Afrika, der Karibik und im Pazifik (AKP-Länder). Es umfasst Handel, Entwicklungshilfe und politische Belange und wird als das bedeutendste Abkommen der EU mit Entwicklungsländern angesehen.
Was war der Hintergrund für die Entwicklungspolitik der EG?
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 waren die meisten Mitgliedstaaten noch Kolonialmächte mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen zu Gebieten in Übersee. Die Einbeziehung dieser Gebiete in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde zur Vorbedingung für die Mitgliedschaft.
Was ist das STABEX-System?
STABEX ist ein System zur Stabilisierung der Exporterlöse agrarischer Rohstoffe. Es soll die schwankenden Weltmarktpreise für unverarbeitete Agrarerzeugnisse abfedern und Einbrüche in den betroffenen Sektoren durch Ausgleichszahlungen verhindern.
Was ist SYSMIN?
SYSMIN ist ein ähnlicher Mechanismus wie STABEX, jedoch für Bergbauerzeugnisse. Er sichert die Ausfuhrerlöse bei Bodenschätzen.
Welche Kritikpunkte werden an STABEX geäußert?
Kritisiert wird, dass STABEX den Zwang zur Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur mindert, kein sich selbst finanzierendes System ist, die Zahl der einbezogenen Produkte begrenzt ist und die Mittel des Fonds unzureichend sind.
Welche Rolle spielen Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit der EU mit den AKP-Staaten?
Die Diskussion um Menschenrechte und Demokratie hat seit langem Eingang in die europäische Entwicklungspolitik gefunden. Lomé IV betonte das Recht auf Menschenwürde und -recht, jedoch ohne eine Verpflichtung zur Einhaltung. Später wurde eine Klausel eingeführt, nach der die Hilfe ausgesetzt werden kann, wenn ein Staat gegen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat verstößt.
Welche Probleme gibt es bei der Kohärenz der EU-Entwicklungspolitik mit anderen Politikbereichen?
Die Entwicklungspolitik der EU hat ein Kohärenzproblem, insbesondere zwischen Handels-, Agrar- und Umweltpolitik. Es wird kritisiert, dass die EU mit der einen Hand Wohltaten vergibt und mit der anderen Hand Schaden anrichtet, beispielsweise durch die Auswirkungen der EG-Agrarpolitik auf die Weltmarktpreise.
Welche Herausforderungen stehen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten an?
Die geostrategische Funktion der Lomé-Politik ist durch die Überwindung des Ost-West-Konflikts überflüssig geworden. Die AKP-Staaten bilden keine Einheit mehr, was eine stärker differenzierte Zusammenarbeit sinnvoll erscheinen lässt. Es besteht Einigkeit, dass die Effizienz der Zusammenarbeit gesteigert werden muss und dass die wirtschaftliche und soziale Dimension, die institutionelle Dimension sowie die Unterstützung des staatlichen Sektors und die Förderung von Handel und Investitionen im Mittelpunkt stehen sollen.
- Arbeit zitieren
- Izaskun altuna (Autor:in), 1999, Entwicklungspolitik der EU, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100478