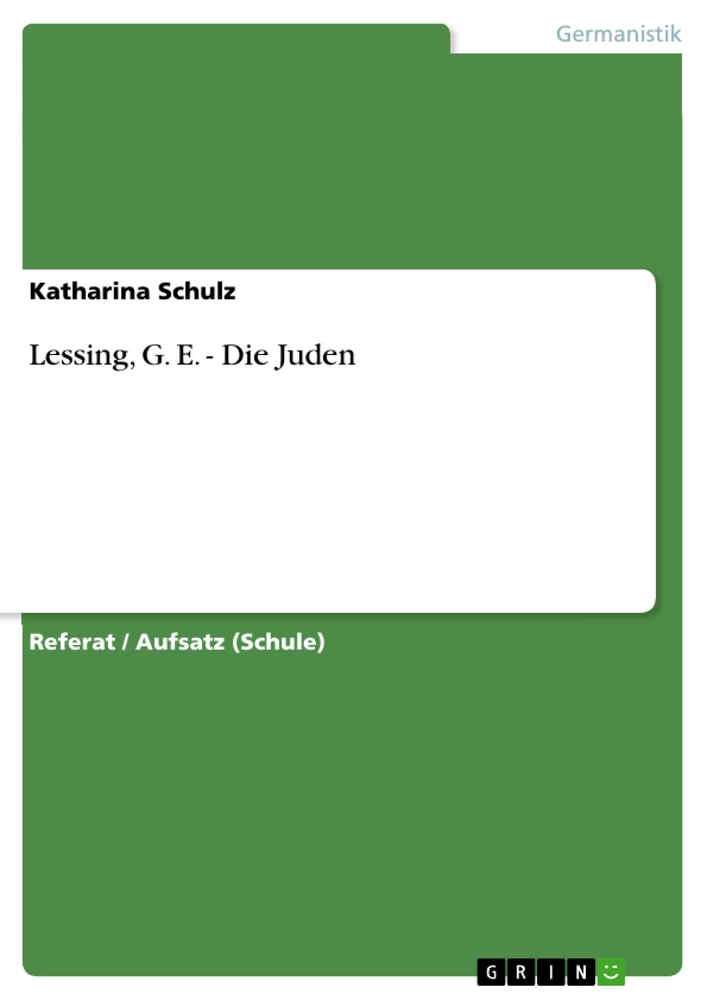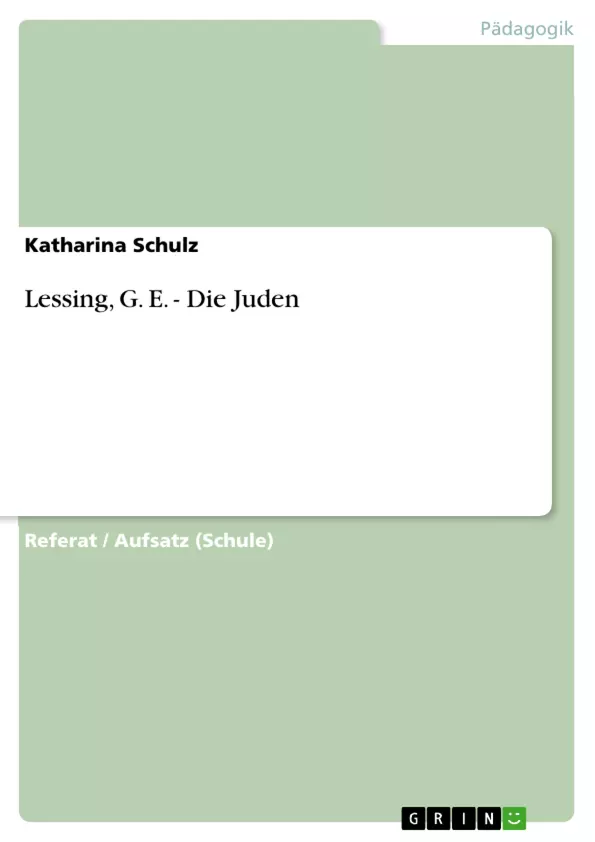In einer Zeit tief verwurzelter Vorurteile und gesellschaftlicher Schranken entführt uns Gotthold Ephraim Lessings "Die Juden" in eine Welt, in der Schein und Sein auf überraschende Weise miteinander ringen. Ein unbekannter Reisender, der einem Baron in höchster Not beisteht, wird auf dessen Gutshof als Gast aufgenommen. Doch als finstere Machenschaften und unbewiesene Anschuldigungen die Gemeinschaft zu spalten drohen, geraten die ohnehin schon marginalisierten Juden ins Visier der Verdächtigungen. Lessing zeichnet ein fesselndes Bild einer Gesellschaft, die von Misstrauen und voreiligen Urteilen geprägt ist, und stellt die Frage, ob wahre Menschlichkeit und Toleranz in einer solchen Umgebung überhaupt gedeihen können. Intrigen, Verwechslungen und überraschende Wendungen halten den Leser bis zum Schluss in Atem, während die Charaktere – vom gutgläubigen Baron über die neugierige Tochter bis hin zum verschlagenen Vogt – ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaft darstellen. Das Stück, angesiedelt im 18. Jahrhundert, beleuchtet auf eindringliche Weise die schwierige Situation der Juden in Sachsen und Preußen, die von Ausgrenzung, Diskriminierung und wirtschaftlicher Not geprägt war. "Die Juden" ist jedoch mehr als nur eine historische Momentaufnahme; es ist ein zeitloses Plädoyer für Vernunft, Mitmenschlichkeit und die Überwindung von Vorurteilen. Lessing gelingt es auf meisterhafte Weise, die Leser mit den Augen der Protagonisten sehen zu lassen und sie so dazu anzuregen, ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Diese Typenkomödie, die zunächst den Erwartungen des Publikums entspricht, verkehrt die gängigen Muster am Ende ins Gegenteil und richtet einen Appell an die Zuschauer, sich von voreiligen Urteilen zu distanzieren und Andersdenkenden mit Offenheit zu begegnen. Ein Werk, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt und die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz in einer vielfältigen Gesellschaft hervorhebt. Die Sprache ist derb wo sie es sein muss, und gewählt wo es angebracht ist. Der Leser wird auf eine Reise mitgenommen, an deren Ende ein Umdenken stattfinden kann. "Die Juden" ist ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung und ein Meilenstein auf dem Weg zu Lessings berühmtem Werk "Nathan der Weise", ein Aufruf zu religiöser und rassistischer Toleranz, der bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und weiterhin eine bedeutende Rolle in der Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Diskriminierung spielt.
"Die Juden" - Gotthold Ephraim Lessing
1. Zum Autor
Der Schriftsteller, Kritiker und Philosoph Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22.1.1729 in Kamenz/Oberlausitz als Sohn eines Pastors geboren. Der junge Lessing besuchte zuerst die Stadtschule in Kamenz, dann die Fürstenschule in Meißen. Er studierte danach Medizin, Philosophie und Theologie in Leipzig. Danach lebte er als freier Schriftsteller in Berlin, wo er für mehrere Zeitungen schrieb. Er hatte Verbindung zu verschiedenen Theatergruppen und schrieb für diese seine ersten Stücke. Dauernd in Geldnot nahm er während des 7jährigen Krieges eine Stelle als Sekretär beim Kommandanten von Breslau an. 1767 erhielt er eine Anstellung als Dramaturg und Kritiker am Deutschen Nationaltheater in Hamburg, 1770 eine Stelle als Bibliothekar in Wolfenbüttel. Lessing starb am 15.2.1781 auf der Reise nach Braunschweig im Alter von 52 Jahren.
Lessing gilt als hervorragender Vertreter der Ideale und Aktivitäten der Aufklärung: Vernunft, Toleranz, Freiheit, Menschlichkeit, gegen Vorurteile, kirchliche Bevormundung und Fürstenwillkür. Er verstand die Aufklärung als unabschließbaren Erziehungs- und Erkenntnisprozess des Menschen.
Außerdem wird er als literarischer Wegbereiter der Emanzipation des Bürgertums verstanden. Er befreite die deutsche Dichtung aus ihrer Abhängigkeit von französischen Mustern, rechtfertigte Shakespeares bis dahin weitgehend unverstandene Werke vor dem künstlerischen Gewissen seiner Zeit und verteidigte die griechischen Tragiker. Dadurch wurde er zum Wegbereiter der Klassik wie einer deutschen Nationalliteratur überhaupt.
Seine Theorien über Drama und Schauspielkunst und über die bildende Kunst Malerei und Poesie beeinflussten die Kunstauffassung und -ausübung der Klassik entscheidend.
2. Seine Werke
Schon während seiner Studienzeit erwarb er ersten Ruhm durch Lustspiele im Stil der Aufklärungszeit: "Der junge Gelehrte", "Der Freigeist" und "Die Juden", die von einer Theatergruppe erfolgreich aufgeführt wurden. Zahlreiche Gedichte, Fabeln, Erzählungen, philosophische und theologische Schriften sollten noch folgen.
"Miss Sara Sampson" war das erste bedeutende deutsche bürgerliche Trauerspiel.
In Breslau begann er das Lustspiel "Minna von Barnhelm" und schrieb "Laokoon: oder die Grenzen der Malerei und Poesie" in dem er den prinzipiellen Unterschied zwischen Poesie und bildenden Künsten entwickelte.
Am "Deutschen Nationaltheater" in Hamburg befreite der das Theater durch "Hamburgische Dramaturgie" von der Vorherrschaft des französischen Dramas und dessen starren Regeln. Nach der lang ersehnten Heirat mit Eva König ( die 2 Jahre später starb ) entstand "Emilia Galotti".
Das wohl berühmteste Werk "Nathan der Weise" entsprang einem theologischen Streit mit dem Hauptpastor Goeze, der durch Zensur verboten worden war. Damit legte er Zeugnis für Humanität, Vernunft und Toleranz (zw. den Weltreligionen) ab.
3. Inhalt "Die Juden"
Ein unbekannter Reisender wird von einem Gutsbesitzer, einem Baron, den er bei einem nächtlichen Raubüberfall vor Ausplünderung bewahren konnte, dankbar als Gast aufgenommen. Die beiden unerkannten Räuber, Vogt Martin Krumm und Michel Stich, die seit Jahren im Dienst des Barons stehen entkommen und versuchen nun den Verdacht auf die in der Nähe des Guts lagernden Juden zu lenken. Martin Krumm, der sich bei dem Reisenden scheinheilig nach den näheren Umständen erkundigt und ihm dabei eine Silberdose entwendet beschuldigt die Juden des ungeglückten Verbrechens. ( denn sie seien alle Betrüger, Diebe und Straßenräuber ) Der Reisende widerspricht jedoch dieser generellen Diffamierung.
Der Baron kann den Reisenden schließlich doch noch zu bleiben um ihm seine Dankbarkeit zu zeigen. Außerdem hat auch seine Tochter lebhaftes Interesse an dem Fremden gefunden und so beauftragt der Baron Lisette, die Zofe, genauere Auskünfte über ihn einzuholen.
Lisette, die inzwischen die silberne Tabakdose von Martin Krumm als Geschenk erhalten hat, verspricht sie Christoph, dem Bedienten des Gastes, wenn er das Inkognito seines Herrn zu lüften bereit ist. Christoph zögert angesichts des Wertgegenstandes nicht der Zofe eine frei erfundene Geschichte zu präsentieren, da er selbst -erst kurz im Dienste des Unbekannten - keine Ahnung um dessen Person hat.
Als der Reisende den Verlust seiner Tabakdose bemerkt, und Martin Krumm verdächtigt, unterzieht sich dieser bereitwillige einer Leibesvisitation, da er sie ja nicht mehr hat. Dabei kommen jedoch zwei falsche Judenbärte zum Vorschein, die er und sein Komplize während des Überfalls getragen haben. Als der Reisende schließlich die Dose in den Händen seines Bediensteten wiederfindet, werden die beiden Übeltäter durch Zurückverfolgung des "Tauschweges" überführt.
Der dankbare Baron bietet daraufhin dem Fremden sein Vermögen und die Hand seiner Tochter an, was der Fremde jedoch ausschlägt als er das Geheimnis um seine Person lüftet: er ist Jude! Der anfänglichen Enttäuschung des Barons folgt jedoch mit Bewunderung gemischte Hochachtung. Diese Reaktion zeigt auch Christoph, nach der Überwindung seiner Empörung, einem als Christ einem Juden gedient zu haben.
4. Die Situation der Juden im 18. Jahrhundert
Es handelt sich hierbei vorzüglich um die Lage der Juden in Sachsen und Preußen, die Lessing bei seinem Stück vor Augen gehabt haben dürfte:
Sachsen versuchte sich möglichst juden-frei zu halten, was jedoch nicht gelingen konnte, da sich bald finanzkräftige Juden in dieser Region fest niederließen die förderlich für das dortige Wirtschaftsleben waren. Daher gewährte ihnen der Kurfürst das Aufenthaltsrecht, die Handelsfreiheit, bereicherte sich jedoch durch Sonderabgaben gleichzeitig an ihnen. Mit der Thronbesteigung von Kurfürsten Wilhelm I. trat aber wieder eine Verschlimmerung der Verhältnisse ein. Die erst kürzlich gewonnen Rechte wurden ihnen wieder aberkannt und das Einwandern wurde nur noch sehr reichen Juden erlaubt. Den restlichen drohte die Ausweisung. Auf Bestreben christlicher Kaufleute, die ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt bedroht sahen, wurde auch der Handel für Juden erheblich eingeschränkt. Sie konnten sich nun nur mehr auf Trödelwaren und sonstige Kleinigkeiten beschränken. Auch die Ausübung eines Handwerks war ihnen untersagt. Jene Juden, die sich durch Pachtung des Münzregals bereits sehr bereichert hatten standen unter königlicher Protektion - die restlichen wurden in ihren bürgerlichen Rechten stark beschnitten:
- Zutritt zu Staatsämtern verwehrt
- Mischehen verboten
- Erwerb von Grund und Boden ein Sonderrecht
- Teilung in "ordentliche" ( mit erblichen Wohnrecht )
- und "außerordentliche" Schutzjuden( unübertragbares Wohn-u. Eherecht)
Das alles machte die Integration der Juden unmöglich und ihre einzige Chance aus dem Ghetto aufzusteigen lag in 2 Punkten:
- öffentliche Diskussion
- Beseitigung der Vorurteile über Juden
Nur wenige trieb die Neugierde dazu die nähere Bekanntschaft mit einem Juden zu suchen um das vorgefasste Urteil schließlich selbst revidieren zu können.
5. Die Typenkomödie
Ein Held steht im Mittelpunkt, der Träger einer allgemeinen Torheit ist, die während des Stücks mit vernünftiger Einsicht korrigiert werden kann. Meistens ist sie nach der Art des Toren benannt, der verlacht wird ( die Advokaten, die Kaufleute...). Die Komödie lebt aus einem stillschweigenden Konsens zwischen dem Zuschauer und den vernünftigen Figuren auf der Bühne, die den Unvernünftigen verlachen und ihn zu bessern versuchen.
- Bei den Juden ist dieser Konsens fraglich geworden, da der erwartete Tor fehlt auf den sich das Publikum sonst stürzt. Es entpuppt sich nämlich der Zuschauer selbst als der Tor, der mit dem Baron zur Einsicht gelangen soll. Der Zuschauer wird genauso in seinem Vorurteil korrigiert, wie der Baron. Der Lernprozess des Barons ist der Lernprozess des Zuschauers. Der zeitgenössische Zuschauer erwartet dem Titel nach, der meistens den Tor einer Komödie benennt, eine Verlachung eines Juden, wird aber in seiner Erwartungshaltung enttäuscht.
- Am Ende wird ein Appell an den Zuschauer gerichtet, der sich im Wunsch des Fremden äußert:
Zu aller Vergeltung bitte ich nichts, als dass sie künftig von meinem Volke etwas gelinder und weniger allgemein urteilen.
Obwohl die Anlage und die Form zunächst der Erwartung entsprechen:
- strikte Einheit von Raum und Zeit
- Einheit der Handlung
- typische Wahl der Figuren und deren Konstellationen:
- (keine Mutter, Herr und Diener, witzige vorlaute Zofe, rüpelhafter Christoph )
schlägt die gewohnte Form am Schluss um:
- Das Happy-end in From einer Hochzeit fehlt. Es zeichnet sich einzig und allein eine Liasion zwischen Christoph und der Zofe ab, was aber das Fehlen der Vereinigung der Baronstochter mit dem Juden umso deutlicher werden läßt. Obwohl sich die beiden Beziehungen das ganze stück hindurch parallel zueinander entwickeln, kommen sie nicht zu einem gewohnten Ende. Der Baron spielt hier auf das gesetzliche Verbot für Mischehen an.
Dieser Schluß weist auf die Dringlichkeit mit der Veränderungen dieser Gesetzte notwendig sind hin. Lessing gibt auch einen geschichtlichen Grund für das Aufkommen dieser Diffamierung der Juden: Christen verfahren von vorn herein nicht aufrichtig mit den Juden und können daher auch kaum Gutes im Gegenzug erwarten denn für Treue zwischen zwei Völkern müssen beide dazu beitragen.
Mit diesem Jugendwerk, das einen Meilenstein auf dem Weg zum "Nathan" darstellt, postuliert sich zum allerersten Mal die religiöse und rassistische Toleranz Lessings. Am Schluss des Nathan steht die Utopie einer Menschheitsfamilie, was in den Juden erst die Vorstufe - die Freundschaft zwischen dem christlichen Baron und dem Jüdischen Reisenden. Im Gegensatz zu der Selbstsicherheit zu seiner Religion stehen zu können beim Nathan muss sich der Reisende erst zu seinem Bekenntnis durchringen.
6. "Die Juden" - unerwartete Belehrung
Lessing stellte schon hier, wie später im Nathan den jüdischen Helden reich und gelehrt dar. An der christlichen Front hingegen gibt es zwei verschiedene Typen: einerseits den christlichen Pöbel, der von Christoph und Martin Krumm dargestellt wird und den Adel, verkörpert vom Baron. Beide haben einen unterschiedlichen Umgang mit dem Geständnis des Juden am Schluss.
Der Pöbel bleibt bei seinem Vorurteil gegenüber den Juden, läßt jedoch Ausnahmen gelten und teilt den Hochmut der Christen nicht mehr. Krumm gelangt nicht zu dieser Einsicht, denn er würde alle Juden umbringen, wäre er König. Diese Meinung wird noch durch die kirchlich gepredigte Meinung unterstützt. Außerdem kann Krumm das Vorurteil gegenüber den Juden schon im vorhinein einkalkulieren und so den Verdacht von sich weisen.
Der Vertreter des Adels teils ebenso das Vorurteil mit dem Pöbel und der Baron zweifelt nicht einmal an der Tatsache, dass den Überfall Juden verübt haben. Er schließt von einem schlechten Erlebnis mit einem Juden auf das ganze Volk. Außerdem urteilt er aus der Physiognomie der Juden auf deren Charakter ( bemerkt aber nicht, dass er einem aufrichtigen, großmütigen Juden gegenübersteht ). Er sieht aber sein Fehlverhalten noch nicht ein, als der Reisende sagt: "Ich bin kein Freund allgemeiner Urteile über ganze Völker", schämt sich jedoch später dafür.
Die "unschuldige" Tochter ist in ihrer kindlichen Naivität noch in keiner Weise von antisemitischen Einstellungen beeinflußt. Sie wird aber sofort von Lisette zurechtgewiesen, als sie ihre Gleichgültigkeit über die Religion des Fremden kundtut. Auch sie soll noch nach dem traditionellen Schema den bösen Juden vom guten Christen unterscheiden.
7. Zur Sprache und zur Form
- in Prosa verfasst
- Die Vertreter des Adels und der Bildungselite ( Baron und dessen Tochter, der Reisende ) drücken sich gewählt und ihrem Stand entsprechend aus. Ihre Umgangsformen sind von Höflichkeit und Respekt gekennzeichnet.
- Vertreter des Pöbels ( Diener und Zofe, die beiden Räuber ) hingegen fallen in die Umgangssprache. Christoph spiel der Zofe gegenüber völlig schamlos auf eine sexuelle Beziehung an, die er mit ihr eingehen will - was im Gespräch der Baronstochter mit dem Reisenden keineswegs der Fall ist.
- Chronologisch erzählt gelangt die Handlung bei den Verdächtigungen des Reisenden an ihren Höhepunkt. Nach der Aufklärung des Dosendiebstahls und gleichzeitig der Beantwortung der Frage wer nun der Reisende sei, tritt mit der Reaktion der Figuren auf diese Enthüllung die Entspannung ein. Jedoch fehlt das übliche Happy-end.
8. Lessing über sein Werk
Die Kritik in einer Zeitung, Lessings Jude sei zu vollkommen und daher allzu unwahrscheinlich was das Vergnügen des Stückes mindere, schreibt er eine Gegenargumentation. Es sei nicht unmöglich aber doch zu unwahrscheinlich einem solch gutem Juden zu begnen, ja es sei schon schwer auch nur einem mittelmäßig tugendhaften zu begegnen, da alle den Christen feindlich begegnen würden.
Lessing sieht die Ursache der Vorurteile darin, dass die Juden, die unter der Unterdrückung der Christen leiden nur vom Handel leben können. Seufzt ein Volk unter solcher Verachtung, sei die Unwahrscheinlichkeit eines so toleranten Juden völlig legitim. Doch könnte durch Beseitigung dieser Umstände nicht - weniger unterdrückt zu werden und nicht mehr dazu gezwungen zu sein das Geschäft des Handels zum Leben auszunutzen - nein genauso redliche Juden wie Christen entstehen? Laut seinen Gegnern nicht, da die Schlechtigkeit schon in der Erziehung, Lebensart und den Grundsätzen verankert liegen. Doch Lessing versucht genaun mit diesem Vorurteil aufzuräumen: Er läßt den Juden reich sein. Somit ist er nicht gezwungen mit dem Handel zu betrügen. Außerdem ist er belesen - also klug und auf Reisen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Gotthold Ephraim Lessing?
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) war ein deutscher Schriftsteller, Kritiker und Philosoph der Aufklärung. Er setzte sich für Vernunft, Toleranz, Freiheit und Menschlichkeit ein und gilt als Wegbereiter der Emanzipation des Bürgertums.
Was sind Lessings bekannteste Werke?
Zu Lessings bekanntesten Werken gehören "Miss Sara Sampson," "Minna von Barnhelm," "Laokoon," "Hamburgische Dramaturgie," "Emilia Galotti," und "Nathan der Weise." Das Stück "Die Juden" ist ein frühes Werk, das bereits Lessings Toleranzgedanken andeutet.
Worum geht es in Lessings Stück "Die Juden"?
Das Stück handelt von einem unbekannten Reisenden, der einen Baron vor einem Raubüberfall rettet. Der Baron nimmt ihn dankbar auf. Zwei Räuber versuchen, den Verdacht auf die in der Nähe lagernden Juden zu lenken. Am Ende stellt sich heraus, dass der Reisende selbst Jude ist, was beim Baron zunächst Enttäuschung, dann aber Bewunderung hervorruft. Die Geschichte behandelt Vorurteile gegenüber Juden und plädiert für Toleranz.
Wie war die Situation der Juden im 18. Jahrhundert, die Lessing in "Die Juden" thematisiert?
Im 18. Jahrhundert waren die Juden in Sachsen und Preußen mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert. Ihnen wurde der Zugang zu Staatsämtern verwehrt, Mischehen waren verboten, und der Erwerb von Grundbesitz war eingeschränkt. Diese Diskriminierung erschwerte ihre Integration und förderte Vorurteile.
Was ist eine Typenkomödie und wie unterscheidet sich "Die Juden" von diesem Genre?
Eine Typenkomödie stellt einen Helden in den Mittelpunkt, der eine allgemeine Torheit verkörpert, die im Laufe des Stücks durch Vernunft korrigiert wird. Bei "Die Juden" fehlt jedoch der erwartete Tor, der verlacht wird. Stattdessen wird der Zuschauer selbst zum Tor, der seine Vorurteile überwinden soll, ähnlich wie der Baron.
Welche sprachlichen und formalen Merkmale weist "Die Juden" auf?
"Die Juden" ist in Prosa verfasst. Die Sprache der Adelsangehörigen und Gebildeten ist gewählt und respektvoll, während die Sprache des Pöbels umgangssprachlich ist. Die Handlung verläuft chronologisch und erreicht ihren Höhepunkt in den Verdächtigungen gegen den Reisenden. Das Stück verzichtet jedoch auf das übliche Happy End in Form einer Hochzeit.
Was sagte Lessing selbst über sein Werk "Die Juden"?
Lessing verteidigte seinen Juden als nicht zu vollkommen und unwahrscheinlich. Er argumentierte, dass die Unterdrückung der Juden durch Christen und die daraus resultierenden Lebensumstände die Ursache für Vorurteile seien. Er glaubte, dass bei Beseitigung dieser Umstände genauso redliche Juden wie Christen entstehen könnten.
Welche Rolle spielt Toleranz in "Die Juden"
Toleranz ist ein zentrales Thema in "Die Juden". Lessing plädiert für religiöse und rassistische Toleranz, indem er einen Juden als Protagonisten darstellt und Vorurteile gegenüber Juden in Frage stellt. Er fordert eine gelindere und weniger allgemeine Beurteilung des jüdischen Volkes.
Wie stellt Lessing die christlichen Charaktere im Stück dar?
Lessing stellt zwei Typen von Christen dar: den Pöbel (Christoph und Martin Krumm), der Vorurteile hegt, und den Adel (Baron), der ebenfalls Vorurteile hat, aber Einsicht zeigt. Die "unschuldige" Tochter ist zunächst unvoreingenommen, wird aber von den vorherrschenden antisemitischen Einstellungen beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Katharina Schulz (Autor:in), 2000, Lessing, G. E. - Die Juden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100507