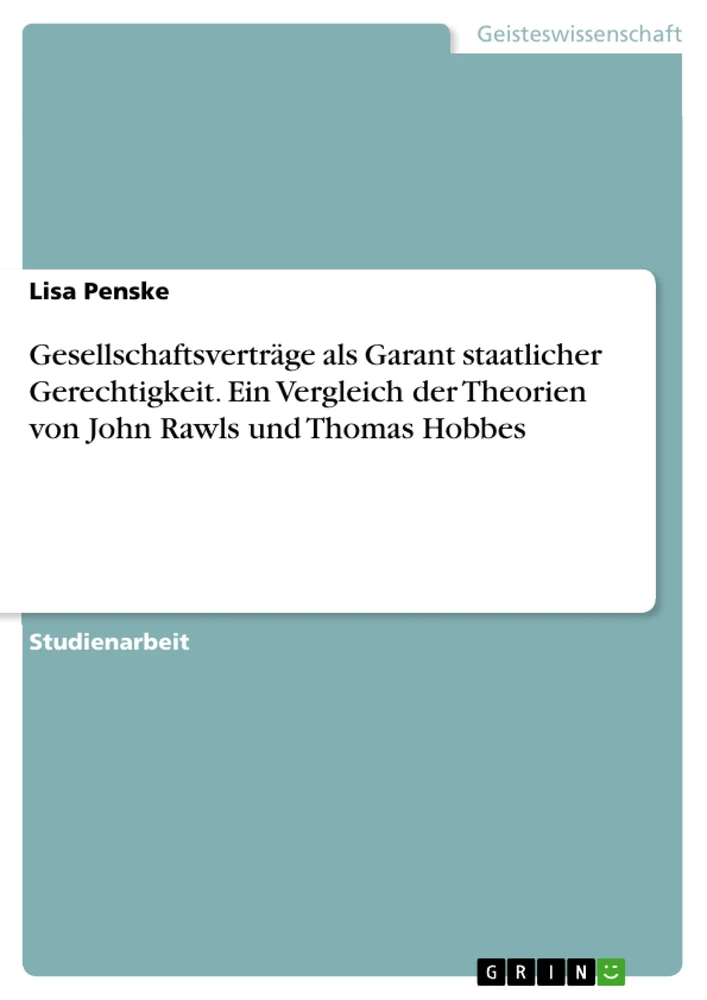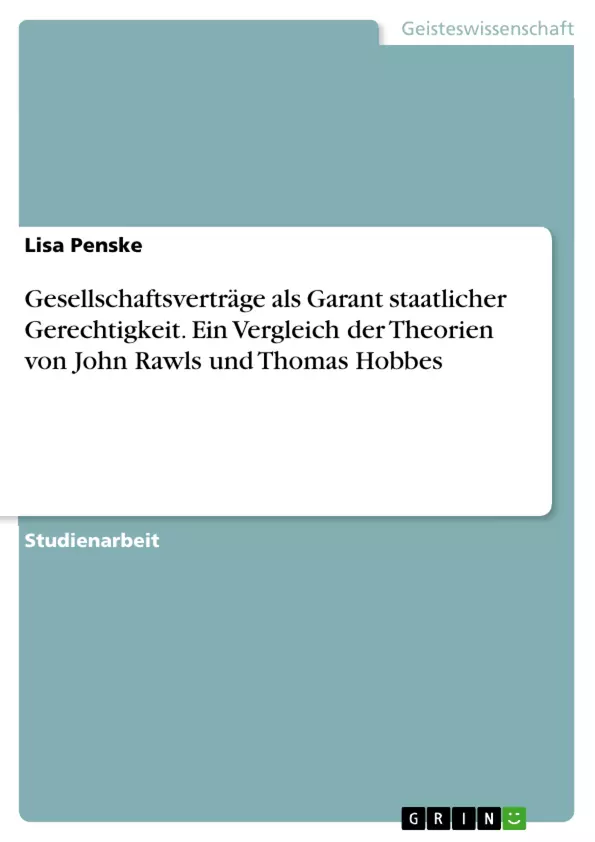In dieser Hausarbeit werden die Theorien von Thomas Hobbes und John Rawls zum Thema Gesellschaftsverträge und politische Systeme vorgestellt und miteinander verglichen. Dafür wurde Thomas Hobbes Leviathan und John Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Primärliteratur herangezogen.
Wie kann ein Staat Gerechtigkeit erreichen, wenn jeder Mensch eine andere Definition von Gerechtigkeit besitzt und wie lässt sich überhaupt ein „gerechter Staat“ erzielen? Dieser Frage widmen sich Philosophen seit der Antike. Ansätze für die Verwirklichung eines gerechten Staates bilden unter anderem die von Philosophen aufgestellten kontraktualistischen Theorien zur Staatsgründung. In diesen Theorien werden hypothetische oder reale Verträge zwischen Individuen geschlossen, welche dann eine staatliche Rechts- und Herrschaftsform legimitieren. Zwei besondere Vertreter dieser Vertragstheorien sind John Rawls und Thomas Hobbes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thomas Hobbes- Der Leviathan
- Der Naturzustand im Leviathan
- Rawls Theorie der Gerechtigkeit
- Vergleich beider Theorien
- Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie Gesellschaftsverträge als Garant für staatliche Gerechtigkeit fungieren können. Dabei wird ein Vergleich der Vertragstheorien von Thomas Hobbes und John Rawls durchgeführt. Die Arbeit untersucht die Grundprinzipien beider Theorien und beleuchtet die unterschiedlichen Konzepte von Naturzustand, Gesellschaftsvertrag und gerechter Ordnung.
- Die Naturzustandstheorien von Hobbes und Rawls
- Die Rolle des Gesellschaftsvertrags in der Begründung staatlicher Ordnung
- Das Verhältnis von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in beiden Theorien
- Der Einfluss der Vertragstheorien auf aktuelle Debatten über staatliche Legitimität
- Kritische Analyse der Stärken und Schwächen beider Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der staatlichen Gerechtigkeit und die Rolle von Vertragstheorien ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit Thomas Hobbes' Leviathan und beschreibt den Naturzustand als einen Zustand des Krieges aller gegen alle. Der dritte Abschnitt widmet sich Rawls' Theorie der Gerechtigkeit und stellt den Urzustand als Ausgangspunkt des Gesellschaftsvertrags vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind: Gesellschaftsvertrag, Naturzustand, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Staat, Legitimität, Thomas Hobbes, John Rawls, Leviathan, A Theory of Justice.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen den Vertragstheorien von Hobbes und Rawls?
Hobbes sieht den Gesellschaftsvertrag als Schutz vor dem gewaltsamen Naturzustand, während Rawls ihn als Mittel zur Etablierung fairer Gerechtigkeitsprinzipien nutzt.
Wie beschreibt Thomas Hobbes den Naturzustand?
Er beschreibt ihn im „Leviathan“ als einen Krieg „aller gegen alle“, in dem das Leben des Menschen einsam, armselig und kurz ist.
Was versteht John Rawls unter dem „Urzustand“?
Ein hypothetisches Szenario, in dem Menschen hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ über Gerechtigkeitsprinzipien entscheiden, ohne ihre eigene soziale Position zu kennen.
Warum sind Gesellschaftsverträge für staatliche Gerechtigkeit wichtig?
Sie dienen als theoretische Legitimation für die staatliche Herrschaft und definieren die Rechte und Pflichten von Bürgern und Staat.
Welche Primärliteratur wurde für diesen Vergleich herangezogen?
Herangezogen wurden Hobbes' „Leviathan“ und Rawls' „A Theory of Justice“ (Theorie der Gerechtigkeit).
- Quote paper
- Lisa Penske (Author), 2018, Gesellschaftsverträge als Garant staatlicher Gerechtigkeit. Ein Vergleich der Theorien von John Rawls und Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005115