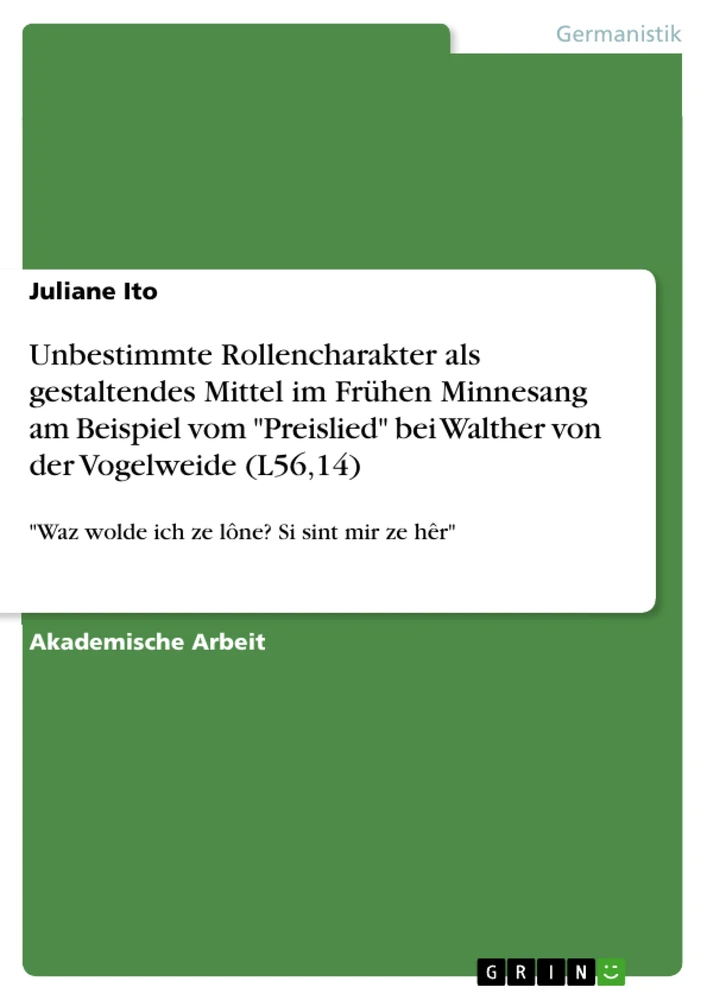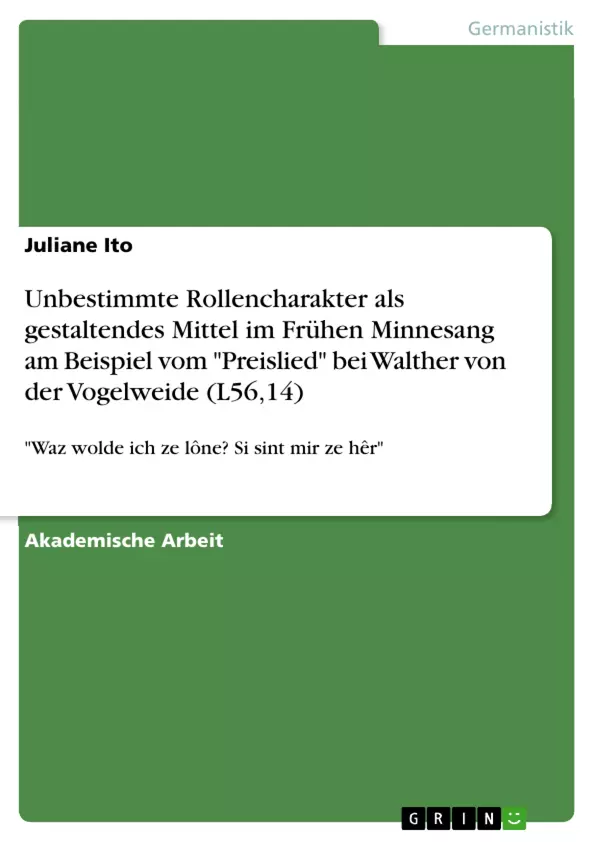Die Arbeit untersucht anhand vom "Preislied" von Walther von der Vogelweide Möglichkeiten der Ausgestaltung der Rolle einer Sprecherinstanz im Frühen Minnesang. Dabei wird ein pragmatischer Ansatz verfolgt und gefragt, wie sich das Einnehmen verschiedener Rollen auf die übertragenden Inhalte ausübt.
Der transzendente Charakter des scheinbar zeitenthobenen und weltentrückten Minnesangs kann für eine Studentin zunächst sehr befremdlich wirken. Der Zugang zu diesen Liedern erweist sich als sperrig, die Sprecherintention erscheint nebulös und man tappt aufgrund der ungesicherten Bezüge weitestgehend im mittelalterlichen Dunkeln. Wie in der Lyrik allgemein üblich wirken die Aussagen dieser Kunstform aufgrund der fehlenden konkret-situativen Verweise in den Liedern als nicht eindeutig fixierbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die performative Aufführungssituation und somit die Kommunikationsstruktur nicht authentisch rekonstruierbar ist.
Die vorliegende Arbeit versucht sich auf einem pragmatischen Weg, unter besonderer Berücksichtigung von Funktion und Mittel, dem Minnesang zu nähern. Hierbei nimmt die Sprecherinstanz als zentralen Bezugspunkt eine exponierte Position ein. Um das Freischwebende des Minnesangs zumindest ansatzweise zu 'erden', wird demzufolge nach der Rolle des Minnesängers gefragt. In diesem Zusammenhang ist außerdem die Frage interessant, inwiefern dabei dem Sänger ein gestalterischer Freiraum einzuräumen ist. Um die Funktion des Sängers zu ermitteln, erschien es erforderlich, zunächst die unterschiedlichen literaturhistorischen Deutungsansätze zum Konzept des Minnesangs nachzuzeichnen. Anschließend erfolgt eine kurze Erläuterung zur Kommunikationssituation des Minnesangs als Teil höfischer Lebenspraxis. Dieser theoretische Hintergrund wird dann anhand einer Beispielanalyse von Walthers 'Preislied' konkretisiert. Zum Schluss erfolgt ein kurzes Fazit, bei welchem die Ergebnisse der Analyse zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterungen zum Untersuchungsgegenstand
- Minnesang als Gefühlsausdruck, Spiel oder Veredelungsprinzip? - Ein Forschungsüberblick
- Der frühe Minnesang als Repräsentationsakt
- Referenzialität, Fiktionalität und Sprecherrolle
- Analyse und Interpretation von Walthers "Ir sult sprechen willekommen"
- Überlieferungssituation
- Inhaltlicher Aufbau
- Formaler Aufbau
- Erzeugung von Ambiguität am Beispiel von miete und lôn
- Interpretationshypothesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle des Minnesängers im frühen Minnesang, indem sie die Kommunikationssituation und die Funktion des Sängers in der höfischen Gesellschaft beleuchtet. Hierbei werden verschiedene literaturhistorische Deutungsansätze zum Konzept des Minnesangs analysiert und die Frage nach dem gestalterischen Freiraum des Sängers untersucht.
- Die unterschiedlichen Interpretationsansätze zum Minnesang
- Die Kommunikationssituation des Minnesangs als Teil höfischer Lebenspraxis
- Die Rolle des Minnesängers als gestalterisches Element
- Die Analyse von Walthers 'Preislied' als Beispiel für die Erzeugung von Ambiguität
- Die Bedeutung der Sprecherinstanz im Minnesang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Minnesangs und die Schwierigkeiten seines Zugangs für moderne Leser ein. Sie stellt die Problematik der fehlenden konkreten Bezüge und der nicht rekonstruierbaren Aufführungssituation heraus. Die Arbeit verfolgt einen pragmatischen Ansatz, indem sie sich auf die Funktion und die Mittel des Minnesangs konzentriert, wobei die Sprecherinstanz im Mittelpunkt steht.
Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene literaturhistorische Deutungsansätze zum Konzept des Minnesangs, wobei es die drei Hauptstränge nach Wapnewski aufgreift: die idealistische Sichtweise des 19. Jahrhunderts, die den Minnesang als Ausdruck des inneren Seelenlebens interpretiert, die Sichtweise als künsterlisches Spiel, die den Minnesang als formale Kunst betrachtet, und die Sakralisierung der Minnethematik, die den Minnesang als Medium zur Verbreitung eines Verhaltensprogramms der feudalen Gesellschaft versteht. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten werden diskutiert, wobei kritische Stimmen zu der Minne-Ideologie und ihrer Gefahr, die Polyvalenzen des Minnesangs zu untergraben, aufgezeigt werden.
Das dritte Kapitel analysiert Walthers 'Preislied' mit Fokus auf seine Überlieferungssituation, den inhaltlichen und formalen Aufbau sowie die Erzeugung von Ambiguität am Beispiel von 'miete' und 'lôn'. Die Analyse soll die Funktion des Sängers und seine gestalterische Freiheit in der Kommunikationssituation des Minnesangs verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Minnesang, Sprecherrolle, Kommunikationssituation, höfische Gesellschaft, Repräsentationsakt, Referenzialität, Fiktionalität, Literaturhistorische Deutungsansätze, Spiel, Veredelungsprinzip, Preislied, Walther von der Vogelweide, Ambiguität, 'miete', 'lôn'.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit zum Minnesang?
Die Arbeit untersucht den unbestimmten Rollencharakter der Sprecherinstanz im frühen Minnesang am Beispiel von Walthers „Preislied“.
Warum ist der Zugang zum Minnesang für moderne Leser oft schwierig?
Wegen fehlender konkret-situativer Verweise, ungesicherter Bezüge und der nicht authentisch rekonstruierbaren performativen Aufführungssituation.
Welche drei Hauptdeutungsansätze zum Minnesang werden diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Minnesang als Gefühlsausdruck, als künstliches Spiel und als gesellschaftliches Veredelungsprinzip.
Was wird am Beispiel von „miete“ und „lôn“ analysiert?
An diesen Begriffen wird die Erzeugung von Ambiguität (Mehrdeutigkeit) im „Preislied“ von Walther von der Vogelweide aufgezeigt.
Welche Rolle spielt die höfische Lebenspraxis?
Der Minnesang wird als Repräsentationsakt innerhalb der höfischen Gesellschaft verstanden, bei dem der Sänger einen gewissen gestalterischen Freiraum genießt.
- Citation du texte
- Juliane Ito (Auteur), 2012, Unbestimmte Rollencharakter als gestaltendes Mittel im Frühen Minnesang am Beispiel vom "Preislied" bei Walther von der Vogelweide (L56,14), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005120