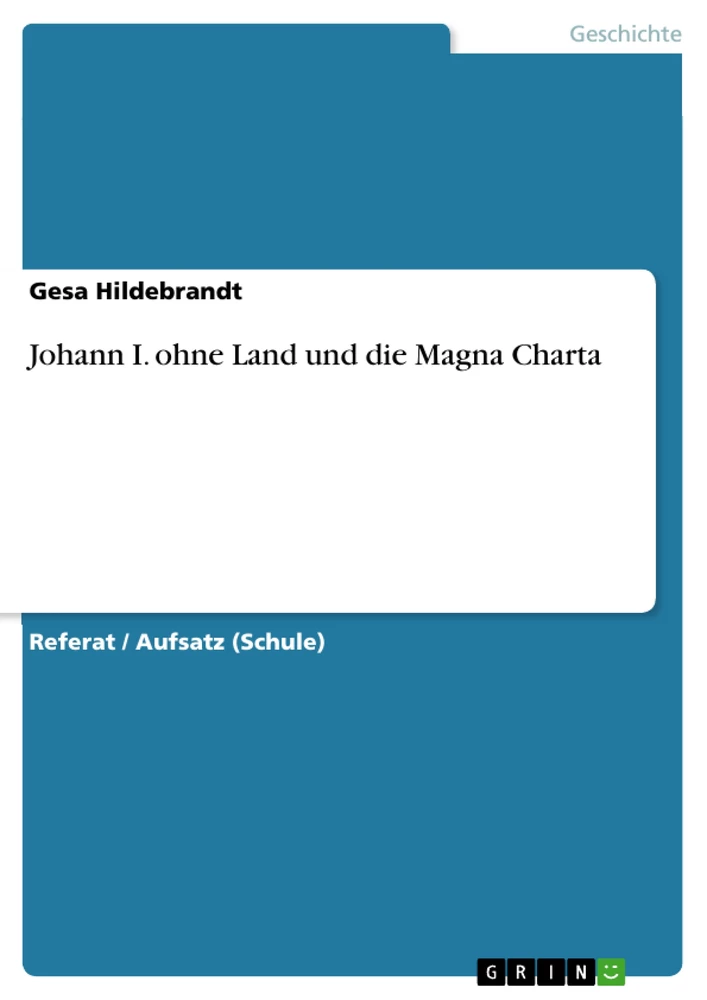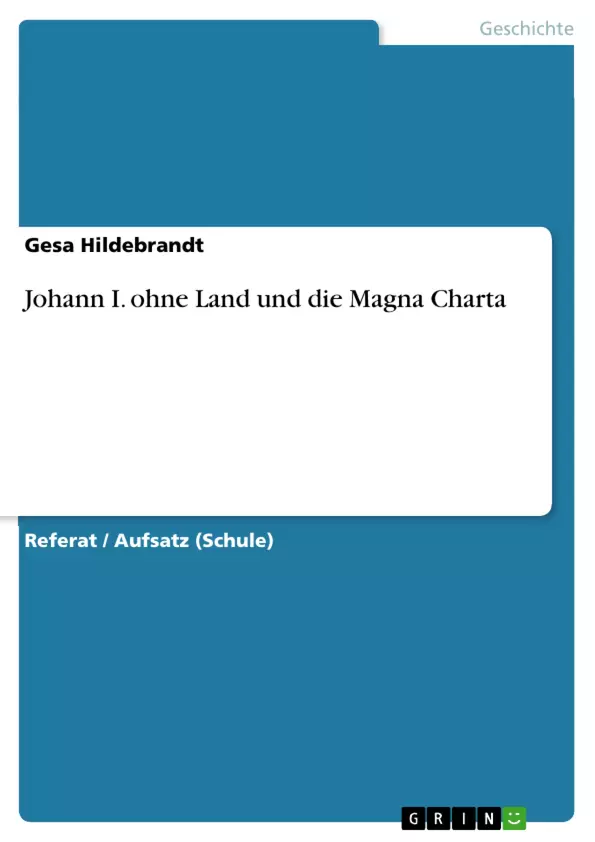Stellen Sie sich vor, ein König, der im Schatten seines Bruders stand, gezwungen, sein Reich dem Papst zu überlassen, und konfrontiert mit rebellierenden Baronen. Tauchen Sie ein in das England des 13. Jahrhunderts, eine Epoche des Umbruchs und der politischen Intrigen, in der Johann Ohneland, ein Monarch, der für seine militärischen Misserfolge und seine Konflikte mit der Kirche bekannt ist, gezwungen wird, die Magna Charta zu unterzeichnen. War dies ein Akt der Schwäche oder ein genialer Schachzug, um seine Krone zu retten? Diese fesselnde Darstellung entführt Sie in eine Zeit, in der das Recht des Königs nicht unantastbar war und der Widerstand gegen die absolute Macht begann, sich zu formieren. Erforschen Sie die komplexen Beziehungen zwischen König, Kirche und Adel, die letztendlich zur Entstehung eines der bedeutendsten Dokumente der Rechtsgeschichte führten. Entdecken Sie, wie die Magna Charta, ursprünglich ein Vertrag zum Schutz der Privilegien der Barone, im Laufe der Jahrhunderte zu einem Eckpfeiler der Freiheit und des Rechtsstaats wurde, dessen Prinzipien bis heute in modernen Verfassungen widerhallen. Analysieren Sie die unterschiedlichen Interpretationen dieses historischen Dokuments, von der romantischen Verklärung als Bollwerk gegen Tyrannei bis zur nüchternen Einschätzung als Instrument zur Wahrung feudaler Interessen. Begleiten Sie uns auf einer Reise in eine Zeit, in der der Grundstein für die moderne Demokratie gelegt wurde und die Frage, wer die Macht kontrolliert und wem sie dient, neu definiert wurde. Erleben Sie die Geburt eines Rechtsstaates aus den Wirren des mittelalterlichen Englands, ein Vermächtnis, das die Welt veränderte und uns bis heute prägt. Dieses Buch ist nicht nur eine historische Analyse, sondern eine Einladung, über die Wurzeln unserer Freiheit und die fortwährende Bedeutung des Rechtsstaats nachzudenken – ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Politik und die Entwicklung der Menschenrechte interessieren. Ergründen Sie die vielschichtigen Motive und die langfristigen Konsequenzen eines der wichtigsten Ereignisse der englischen Geschichte.
Johann I. ohne Land und die Magna Charta (Soziale Gruppe und Individuum)
Johann I. ohne Land (engl. John Lackland),
*Oxford 24.Dez. 1167, + Schloß Newark (Nottinghamshire) 18. oder 19. Okt. 1216, König (seit 1199). Jüngster Sohn Heinrichs II:; Nachfolger seines Bruders Richard I. Löwenherz, verlor bis 1206 die engl. Festlandsbesitzungen nördl. der Loire an den frz. König Philipp II. August. Die Opposition der engl. Barone versuchte er durch Lehennahme Englands vom Papst einzudämmen; musste 1215 die Forderungen der Magna Charta libertatum anerkennen.
Magna Charta (M: C: libertatum "große Urkunde der Freiheiten"; Magna Charta, engl. The Great Charter), am 15. Juni 1215 (Datum der Urkunde; endgültige Einigung am 19. Juni) zw. König Johann ohne Land und Vertretern der aufständ. Barone sowie der Kirche abgeschlossener Vergleich in 63 Artikeln. Die Forderungen der Aufständischen betreffen im wesentlichen die rechtl. Sicherung der Vasallen (u.a. gegen Missbrauch der königl. Justiz und der lehnsrechtl. Verpflichtungen; Regelung der Erhebung von Schuld- und Hilfsgeldern) und sind selbst da, wo sie auf eine Rechtssicherung nichtfeudaler Gruppen (Schutz der Bauern und Kaufleute, Bestätigung der städt. Freiheiten, Begünstigung Londons) abzielen, zumeist mit einem Eigeninteresse der Barone verknüpft. Jedem Freien wird in Art. 39 zugestanden, dass er nicht willkürlich verfolgt, sondern nur durch seine Standesgenossen und nach dem Gesetz des Landes abgeurteilt werden kann. Art. 61 bestellt zur Wahrung der verbrieften Freiheiten gegenüber dem König einen Kontrollausschuss von 25 Baronen und institutionalisiert damit das feudale Widerstandsrecht. So ist die M. C. in erster Linie Satzung geltenden Lehnrechts, wurde aber im Lauf der Zeit zum fundamentalen Grundgesetz engl. Verfassungsrechts aufgewertet.
Aus: Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden, 4. Auflage 1992
1. Ersttext
Wodurch sah sich Johann I. ohne Land gezwungen, die Magna Charta zu unterschreiben?
Schon immer hatte Johann im Schatten seines beliebten Bruders Richard Löwenherz gestanden. Und seine Position wurde weiter geschwächt: Unter seiner Regentschaft verlor England im Konflikt mit König Philipp II. August von Frankreich fast alle französischen Besitzungen, durch die Einkerkerung und Ermordung seines Konkurrenten um die Krone Arthur von der Bretagne hatte sich Johann viele Feinde geschaffen. Papst Innozenz III. exkommunizierte ihn. Viele sahen ihn als "glaubensverachtenden Zyniker", der ganz alleine regieren wollte, ohne Einmischung seitens der Barone. Diese jedoch sägten weiter "an seinem wackeligen Thron" und zwangen ihn zuletzt dazu, die Magna Charta zu unterschreiben.
Die Autorin des Textes, Silke Umbach stellt aus dem Leben Johann Ohnelands hauptsächlich seine Misserfolge dar, um zu zeigen, wie viel "Pech" der König hatte.
- Um König zu bleiben, musste er seinen Neffen und Rivalen um den Thron, Arthur von Bretagne, einkerkern und ermorden lassen.
- Er verlor fast alle französischen Besitzungen im Konflikt mit König Philipp II. August von Frankreich.
- Papst Innozenz III. exkommunizierte ihn.
- Er musste der Magna Charta zustimmen.
- Der Thronschatz versank im Treibsand, weil Johann mit seinem ,,königlichen Troß" keinen Umweg in Kauf nehmen wollte.
2. Zweittext
Wodurch sah sich Johann I. ohne Land gezwungen, die Magna Charta zu unterschreiben?
Johann war nur König geworden, weil die Feudalherren ihn dem eigentlichen Thronfolger, Arthur von der Bretagne, der unter der Vormundschaft des französischen Königs stand, vorzogen und Johann zum König wählten. Auch die Kirche stimmte nur zu, da sie so ihre Auffassung vom freien Königswahlrecht bestätigt sah. Die Barone besaßen somit eine politische Machtstellung gegenüber Johann.
Von da an schwächten viele Ereignisse die Position des Königs. Zum einen war es der Streit mit Kirche und Papst. 1206 starb der Erzbischof von Canterbury. Der Papst wollte seinen eigenen Kandidaten, Stephen Langton, zum neuen Erzbischof machen, Johann jedoch wollte sein Wahlrecht behaupten. Er konfiszierte die Landgüter der Kirche, worauf Innozenz III. das Interdikt über England verhängte. Als Johann, nun erst recht, weiter konfiszierte, exkommunizierte ihn der Papst. Damit befreit er dessen Untertanen vom Treueid. Jene, die gegen ihn kämpften, konnten sich jetzt als Kreuzfahrer im Heiligen Krieg bezeichnen.
Der Papst verband sich nun mit dem König von Frankreich gegen Johann. Dieser konnte diesem Druck nicht mehr standhalten und unterwarf sich 1213 Innozenz. Der Papst gab ihm England als ,,Sühne-Lehen" zurück und besaß damit auch weiterhin Macht über Johann.
Der Krieg mit Frankreich missfiel Johanns Vasallen und dem Erzbischof Langton. Sie mussten erhöhte Steuern zahlen, in den Krieg ziehen und waren jetzt von der teuren Hilfe des Papstes abhängig. Auch der Verlust des Krieges schwächte Johanns Stellung.
Der Erzbischof von Canterbury, Stephen Langton, brachte die Barone dazu, den König der "despotischen Rechtsbrechung" zu beschuldigen und ihn zu einer Garantie ihrer Rechte zu zwingen. Diese Garantie sollte den alten Grundsatz "Das Recht steht über dem König" sichern. Stephen Langton konnte auf den Krönungseid der angelsächsischen Könige verweisen, der dem Volk ,,rechtliches Wohlverhalten der Krone" zusagte.
3. Gegenwartsbezug
"Die Regierung sollte von nun an etwas anderes bedeuten als die willkürliche Herrschaft irgendeines Menschen, und Brauch und Recht mussten noch über dem König stehen." (aus: Churchill: Geschichte I. - Die Geburt Britanniens)
Noch heute finden wir diesen Grundsatz in unseren Gesetzen. Nicht nur gilt die Magna Charta als eine der Grundlagen der englischen Verfassung, auch im deutschen Grundgesetz ist dieser Hauptgedanke der Magna Charta vertreten:
Art. 20:
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. (aus: GG für die BRD)
Es gibt viele verschiedene Auffassungen über die geschichtliche Bedeutung der Magna Charta.
Churchill sieht die größte Leistung darin, ein Gesetz zu schaffen welches bezeugte, dass die "Macht der Krone nicht absolut war". Der "Grundgedanke von der Souveränität des Gesetzes" hätte zwar schon vorher bestanden, doch erst die Magna Charta erhebe ihn zu einer "Doktrin des Nationalstaates".
Kurt Kluxen schreibt in seiner "Englischen Geschichte": "Die Freiheitsurkunde von 1215 wurde der Grundstein des englischen Verfassungsrechts."
Jochen Schmidt-Liebich behauptet in seinen "Daten der englischen Geschichte": "Die Bedeutung der Magna Charta ist überschätzt und von der liberalen englischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts zu einer Verfassungslegende stilisiert worden." Er meint, sie bedeute nichts mehr als die Bestätigung des seit Wilhelm dem Eroberer ohnehin geltenden Rechts. Er kritisiert, die Rechte, Freiheiten und Privilegien gelten allein für Magnaten und Ritter, das Volk werde nicht bedacht.
Auch Bernd Rill, der Autor des Zweittextes, möchte die Bedeutung der Magna Charta nicht überschätzen: "Sie war gewiss ein Meilenstein in der Entwicklung des Rechtstaates, aber von "Herrschaft des Volkes" konnte 1215 keine Rede sein, eher von Verhinderung absoluter Herrschaft der Krone. Die Freiheitsrechte galten ausschließlich zugunsten der Adelsklasse; das Volk trat als Inhaber eigener Rechte in der Magna Charta nicht auf".
Hans Christoph Schröder dagegen sieht in seiner "Englischen Geschichte" die Bedeutung der Magna Charta im Vergleich zu ähnlichen Werken anderer europäischer Länder hauptsächlich darin, dass die Magna Charta "überständisch und überregional" sei. Die in ihr gewährten Privilegien hätten allgemeinen Charakter und nähmen somit nicht die Form adliger oder provinzieller Immunität und städtischer Unabhängigkeit an.
Dabei verweist er auch auf Leopold von Ranke, der in seiner "Englischen Geschichte" schreibt: "Auch in anderen Ländern haben sich Kaiser und Könige in dieser Epoche zu sehr umfassenden Bewilligungen an die verschiedenen Stände herbeigelassen: das Unterscheidende in England ist, dass sie nicht jedem Stande für sich, sondern allen zugleich gemacht wurden."
Zeitliche Einordnung
Hochmittelalter im 13. Jahrhundert, was sonst noch geschah:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellenangaben:
Ersttext:
Stern-Millennium Nr. 3 (1200 - 1299), S. 24f
Zweittext:
Geschichte Mit Pfiff 1/94 (Der Westminsterclan), S. 18f
Gegenwartsbezüge:
Jochen Schmidt-Liebich: Daten der englischen Geschichte, S. 29
Churchill: Geschichte I, Die Geburt Britanniens, S. 252, S. 255f
Hans-Christoph Schröder: Englische Geschichte, S.15
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in den Texten über Johann I. ohne Land und die Magna Charta?
Die Texte behandeln Johann I. ohne Land, seine Regentschaft, die Umstände, die zur Unterzeichnung der Magna Charta führten, und die Bedeutung der Magna Charta selbst. Es werden verschiedene Perspektiven auf Johanns Herrschaft und die Relevanz der Magna Charta dargestellt.
Wer war Johann I. ohne Land?
Johann I. ohne Land (John Lackland) war König von England (seit 1199). Er war der jüngste Sohn Heinrichs II. und Nachfolger seines Bruders Richard I. Löwenherz. Seine Herrschaft war geprägt von Konflikten, insbesondere dem Verlust französischer Besitzungen und Auseinandersetzungen mit den Baronen und dem Papst.
Was ist die Magna Charta?
Die Magna Charta (Magna Charta libertatum) ist eine "große Urkunde der Freiheiten", die 1215 zwischen König Johann ohne Land und Vertretern der aufständischen Barone sowie der Kirche abgeschlossen wurde. Sie enthält 63 Artikel, die im Wesentlichen die rechtliche Sicherung der Vasallen, den Schutz nichtfeudaler Gruppen und das Widerstandsrecht gegenüber dem König betreffen.
Welche Ereignisse führten zur Unterzeichnung der Magna Charta durch Johann I.?
Mehrere Faktoren führten zur Unterzeichnung der Magna Charta: der Verlust französischer Besitzungen, Konflikte mit dem Papst (Exkommunikation), die Ermordung seines Rivalen Arthur von der Bretagne, die Schwächung seiner Position durch die Barone und deren Forderung nach rechtlicher Sicherung ihrer Rechte. Die Barone zwangen ihn, die Magna Charta zu unterschreiben, um seine Macht einzuschränken.
Welche Rolle spielte die Kirche im Konflikt zwischen Johann I. und den Baronen?
Die Kirche spielte eine bedeutende Rolle. Papst Innozenz III. exkommunizierte Johann I. wegen eines Streits um die Besetzung des Erzbischofs von Canterbury. Dies befreite Johanns Untertanen vom Treueeid und ermöglichte es seinen Gegnern, sich als Kreuzfahrer im Heiligen Krieg zu bezeichnen. Der Papst verbündete sich später mit dem König von Frankreich gegen Johann, was diesen zusätzlich unter Druck setzte.
Was waren die Hauptforderungen der Barone in der Magna Charta?
Die Hauptforderungen der Barone betrafen die rechtliche Sicherung ihrer Vasallen, den Schutz vor Missbrauch der königlichen Justiz und der lehnsrechtlichen Verpflichtungen, die Regelung der Erhebung von Schuld- und Hilfsgeldern, und die Bestätigung ihrer feudalen Widerstandsrechte.
Welche Bedeutung hat die Magna Charta heute?
Die Magna Charta gilt als eine der Grundlagen der englischen Verfassung und wird oft als ein Meilenstein in der Entwicklung des Rechtsstaates angesehen. Sie etablierte den Grundsatz, dass das Recht über dem König steht. Ähnliche Prinzipien finden sich auch in modernen Verfassungen, wie z.B. im deutschen Grundgesetz.
Wie wird die historische Bedeutung der Magna Charta von verschiedenen Historikern bewertet?
Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die historische Bedeutung der Magna Charta. Einige sehen sie als den Grundstein des englischen Verfassungsrechts (Kurt Kluxen, Leopold von Ranke, Hans Christoph Schröder), während andere ihre Bedeutung relativieren und betonen, dass ihre Rechte und Privilegien hauptsächlich für Magnaten und Ritter galten (Jochen Schmidt-Liebich, Bernd Rill).
Welche Quellen wurden für die Texte verwendet?
Die Texte basieren auf verschiedenen Quellen, darunter: Stern-Millennium Nr. 3 (1200 - 1299), Geschichte Mit Pfiff 1/94 (Der Westminsterclan), Jochen Schmidt-Liebich: Daten der englischen Geschichte, Churchill: Geschichte I, Die Geburt Britanniens, Hans-Christoph Schröder: Englische Geschichte, Kurt Kluxen: Geschichte Englands.
- Citation du texte
- Gesa Hildebrandt (Auteur), 2000, Johann I. ohne Land und die Magna Charta, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100532