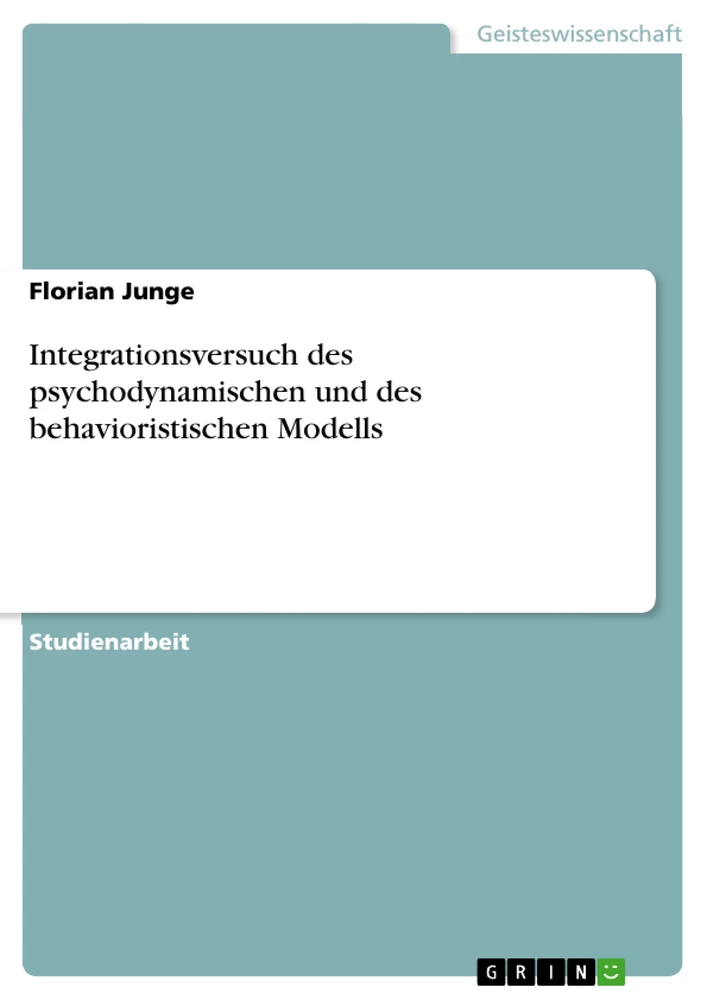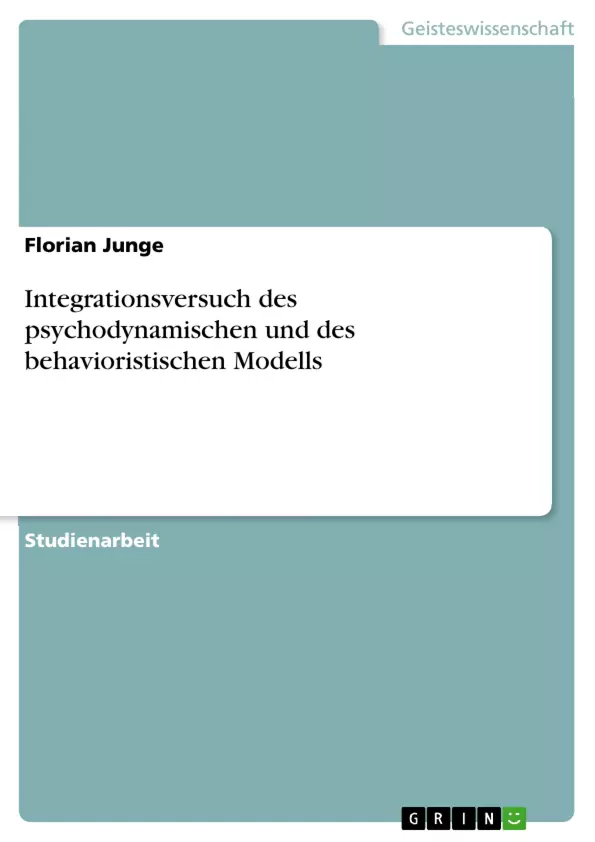Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Modelle des Menschen
2.1 Das psychodynamische Modell
2.2 Das behavioristische Modell
2.3 Der Behaviorismus aus der Sicht der Kritischen Psychologen
2.4 Gegenüberstellung
3. Der Einfluß von Freuds psychoanalytischen Modell auf die Lerntheorie
4. Hulls hypothetisch deduktives System
4.1 Partiell antizipierende Zielreaktionen
4.2 Die Gewohnheitshierarchie
5. Dollard und Miller: „Personality and Psychotherapy“
5.1 Freuds Realitätsprinzip im Sinne von „höheren mentalen Prozessen“
5.2 Abwehrmechanismen des Ich
5.2.1 Verdrängung
5.2.2 Regression
5.2.3 Verschiebung
5.2.4 Rationalisierung
5.2.5 Phantasie (hallucinations)
5.2.6 Projektion
5.2.7 Reaktionsbildung
6 Beispiele und Bewertung experimenteller Untersuchungen
6.1 Beispiel eines Versuches zur Verdrängungshypothese
6.2 Beispiel eines Versuches zur Projektion
6.3 Beispiel eines Versuches zur Regression
6.4 Bewertung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung:
Eines der größten Probleme der Psychologie ist die Uneinigkeit der Forscher über ein angemessenes Modell vom Menschen, über Untermodelle, Theorien und Thesen, sowie über die korrekte methodische Vorgehensweise. In einigen Bereichen (wie zum Beispiel in der Kreativitätsforschung) kann man bereits davon ausgehen, daß die Anzahl unterschiedlicher Theorien nicht wesentlich kleiner ist als die Zahl der Personen, die sich auf diesem Gebiet der Psychologie engagieren.
Dies sollte aber nicht unbedingt als negativ bewertet werden. Vielleicht ist ja die Uneinigkeit der psychologischen Forschung auch der größte Vorteil, den sie gegenüber anderen Wissenschaften besitzt. Denn aufgrund dieses Ideenpluralismus ist der Bereich des für die Psychologie Interessanten theoretisch unbegrenzt und eine Bereicherung durch Theorien aus anderen Wissenschaften (Beispielsweise durch die Evolutionstheorie der Biologie) möglich. Ein Nachteil besteht darin, daß es für den Laien kaum einsichtbar ist, welche Feststellung aus welchem Modell erfolgte, und wie sie dementsprechend einzuschätzen ist. Dies ist gerade deswegen nicht zu unterschätzen, da sich die Psychologie einer wachsenden Aufmerksamkeit durch die Medien erfreut und sich auch immer häufiger in Publikationen nicht psychologischer Wissenschaft, in Statements einflußreicher Persönlichkeiten und vielen anderen Verbreitungsquellen finden läßt.
Doch zurück zum Kern der Sache: Es gibt also keine allumfassende Theorie, die das menschliche Verhalten in seiner gesamten Komplexität erfaßt. Auch wenn dies so einige Forscher für ihre Theorie in Anspruch nehmen wollen, wird es so eine Theorie vermutlich nie geben. Was für eine Sichtweise soll ein Modell vom Menschen einnehmen? Soll sie sich ausschließlich auf overtes (sichtbares, meßbares) Verhalten konzentrieren, oder sollte sie sich eher um das Innenleben des Menschen (wie zum Beispiel Gedanken, Erinnerungen, Emotionen, usw.) kümmern? Läßt sich menschliches Verhalten angemessen mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchen und erklären oder benötigt man zur Untersuchung des besonderen Phänomens der menschlichen Psyche auch ein besonderes Erklärungsprinzip?
In dieser Arbeit soll verständlicher Weise keine Antwort auf diesen uralten und immer noch anhaltenden Streit gegeben werden, und es ist auch zu bezweifeln, ob es tatsächlich eine direkte Antwort auf die Frage gibt, welcher Ansatz denn nun der richtige sei. Statt dessen sollen hier die Eigenschaften, die Gegensätze und die Gemeinsamkeiten des behavioristischen und des psychoanalytischen Modells dargelegt und kritisch betrachtet werden. Im Anschluß darauf wird das zentrale Thema dieser Arbeit behandelt: Der Integrationsversuch beider Modelle nach Dollard und Miller. Abschließend werden noch einige wenige Experimente vorgestellt, welche die Freudschen Aussagen überprüfen sollten. Auch diese sollen kritisch betrachtet werden.
2. Modelle des Menschen
2.1 Das psychodynamische Modell:
Im psychodynamischen Modell nimmt der Begriff der Motivation einen zentralen Aspekt ein. Jegliche Handlung eines Organismus ist determiniert durch das Handlungsziel der „Spannungsreduktion“. Die Spannung manifestiert sich in ererbten, biologisch festgelegten Trieben und in Konflikten zwischen den persönlichen Bedürfnissen des Individuums und den gesellschaftlichen Ansprüchen, denen das Individuum unterliegt. Der Wunsch, diese Konflikte zu lösen und die Triebe zu befriedigen, stattet das Verhalten mit Energie aus, so daß der Organismus erst aufhört zu handeln, wenn diese Triebkräfte reduziert wurden.
Sigmund Freud (1856-1939) lieferte hier den wichtigsten Beitrag mit seinem Modell der Psychoanalyse, in dem er von einem psychischen Determinismus ausging. Dieser besagt, daß die Psyche durch die ererbten Prinzipien in Kombination mit Erlebnissen in der frühen Kindheit vollständig determiniert wird. Das Verhalten des Kleinkindes wird durch den Selbsterhaltungstrieb und dem Streben nach angenehmen Empfindungen gesteuert, die es jedoch nicht lernen muß. Konflikte und traumatische Ereignisse in dieser Zeit legen die spätere Persönlichkeit vollständig fest. Das Modell, welches Freud erstellte, war zu seiner Zeit in soweit einzigartig, da es von der Irrationalität des menschlichen Verhaltens ausging. Handlungen können von Motiven bestimmt werden, die nicht Bestandteil der bewußten Aufmerksamkeit sind. Seine Herangehensweise war stark durch die damals vorherrschende Instinkttheorie beeinflußt, die ebenfalls von einer ererbten Disposition des Organismus ausgeht.
Im Mittelpunkt Freuds Theorie stand die Struktur der Persönlichkeit. Diese ist aufgeteilt in zwei miteinander ständig im Konflikt liegenden Teilen, dem Es und dem Über-Ich, zwischen denen der dritte Teil, das Ich, ständig zu vermitteln hat.
Das Es wird als primitiver, unbewußter Teil der Persönlichkeit betrachtet, als Sitz der primären Triebe. Bestimmt vom Lustprinzip, dem ungesteuerten Streben nach Befriedigung, häufig sexueller, körperlicher Lust, arbeitet es irrational und impulsgetrieben.
Das Ü ber-Ich ist der Sitz der Werte, einschließlich der erworbenen, in der Gesellschaft geltenden moralischen Einstellungen. Es entspricht in etwa dem, was man allgemein als Gewissen bezeichnet und repräsentiert die „Gesellschaft im Individuum“. Daher steht es in einem ständigen Konflikt mit dem trieborientierten Es.
Das Ich verkörpert den realitätsorientierten Aspekt der Persönlichkeit, der in diesem Konflikt zwischen den Impulsen des Es und den Anforderungen des Über-Ich abwägt und vermittelt. Das Ich verkörpert das, was wir die „Attitüde eines Individuums“ nennen, nämlich die Auffassung, die das Individuum von der physischen und der sozialen Realität hat. Beherrscht vom Realitätsprinzip, stellt das Ich vernünftige Entscheidungen über lustbetonte Wünsche. Freuds psychologisches Konzept analysiert das menschliche Verhalten auf einer molaren Ebene, das heißt, daß der Mensch ganz allgemein in Abhängigkeit von seinen inneren Trieben und Konflikten betrachtet wird. Seine Ideen und Vorstellungen basieren weniger auf systematischer Forschung oder gar auf strikt kontrollierten Experimenten. Dieser beeindruckende, einzigartige Theorienkomplex beruht einzig und allein auf seiner Fähigkeit, sich und seine Mitmenschen genauestens zu beobachten und zu analysieren. Hierbei griff er hauptsächlich auf seine Erfahrungen als Nervenarzt mit psychisch gestörten Menschen zurück. Seiner Ansicht nach beruht das gestörte Verhalten seiner Patienten auf den selben Prinzipien wie bei „normalen“ Menschen.
Kritik: Die Hauptkritikpunkte gelten Freuds wissenschaftlicher Vorgehensweise. Hier werden vor allem die unscharfen und nicht operational definierten Begriffe seiner Theorien bemängelt, da sie eine empirische Überprüfung seiner Aussagen meist nicht zulassen. Einige seiner Thesen sind prinzipiell unwiderlegbar, und daher in ihrem allgemein theoretischen Status fragwürdig. Hierbei stößt auch die Auffassung der Allgemeingültigkeit seines psychiatrischen Wissens bei der Theoriebildung auf große Skepsis. Aus Erfahrungen, die Freud mit psychisch kranken Patienten sammelte, könnten keine Schlußfolgerungen auf die geistigen Prozesse normaler Menschen gezogen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kritik betrifft die retrospektive Herangehensweise Freuds. Diese erlaube keine zuverlässige Vorhersage von Verhalten, da das Hauptaugenmerk auf historische Stimuli (z.B.: frühe Kindheitserfahrungen) liegt, und gegenwärtige Stimuli, die das Verhalten in Gang bringen und aufrechterhalten können, außer Acht gelassen werden. Des weiteren wird die Reliabilität der von seinen Klienten gemachten Kindheitserinnerungen in Frage gestellt. Nicht nur daß diese den Prozessen des Vergessens und der Verzerrung unterliegen, oftmals werden Erinnerungen, die der Realität entsprechen könnten, vom Therapeuten als Phantasien mißgedeutet.
2.2 Das behavioristische Modell:
Das Interesse der Behavioristen ist ausschließlich auf sichtbares Verhalten und dessen Beziehungen zu Reizgegebenheiten in der Umwelt des Individuums gerichtet. Ziel ist es, herauszufinden, wie bestimmte Stimuli (Reize) in der Umwelt Reaktionen bedingen. Dies soll die Vorhersagbarkeit und Beeinflussung von Verhalten ermöglichen. J.B. Watson (1878- 1958) war maßgeblich an der Entstehung des Behaviorismus beteiligt, wobei er selbst stark durch die Forschungen des russischen Physiologen I. P. Pawlow (1849-1936) beeinflußt wurde. Während aber Pawlow mehr das Erlernen der Verbindung zwischen einem konditionierten und einem unkonditionierten Reiz interessiert, ging es Watson vornehmlich um das Erlernen des Zusammenhangs (Kontingenz) zwischen dem eigenen Verhaltens und einer darauf folgenden Konsequenz. Unterschieden werden diese beiden Herangehensweise also durch die Art der Konditionierung. Pawlow praktizierte die klassische Konditionierung, Watson und seine Schüler die instrumentelle Konditionierung, bei der das Verhalten als Instrument (Mittel) gesehen wird, um die erlernte Konsequenz erneut herbeizuführen.
Der Behaviorismus in seiner klassischen Form nahm an, daß Umweltbedingungen vollständig das Verhalten bestimmen. Damit widersprach der Behaviorismus dem damals vorherrschenden Glauben an die Bedeutung von Instinkten, also von nicht beobachtbaren ererbten Mechanismen, die Persönlichkeit und Verhalten erklären sollten.
Behavioristen waren die ersten Psychologen, die das „methodische Prinzip“ formulierten, daß nur overtes Verhalten Gegenstand der Psychologie sein dürfe. Innere und mentale Ereignisse seien der Wissenschaft nicht zugänglich und daher nicht Forschungsgegenstand. Sie erhoben ihre Daten daher in kontrollierten Laborexperimenten. Computer und anderes elektrisches Gerät wurden dazu genutzt, Reize darzubieten und Reaktionen aufzuzeichnen. Die methodischen Ideale der Behavioristen waren die Quantifizierbarkeit, genaue operationale Definitionen und am strengen naturwissenschaftlichen Ideal orientierte Normen der Beweisführung. Die Quantifizierung (Messung) erfolgt durch z.B. Lidschlagreflex oder durch das Drücken eines Hebels.
Ihre Daten erhoben sie häufig an Versuchstieren, da es hierbei leichter fiel, alle Bedingungen zu kontrollieren. Zudem gingen die Behavioristen davon aus, daß es generelle artübergreifende Verhaltensprinzipien gibt, die sowohl für den Mensch als auch für das Tier gelten.
Kritik: Einige Kritiker vertreten die Meinung, daß den Behavioristen vor lauter Interesse an den Umweltgegebenheiten der Kontakt zum Menschen verloren gegangen ist. Auch wird kritisiert, daß es sich bei einem Großteil der von den Behavioristen beobachteten Lernvorgängen lediglich um Leistungen handelt, die aufgrund des motivierenden Mangelzustandes (z.B. Durst, Hunger) oder dem Fehlen von Ausweichmöglichkeiten (andere Verstärker und Handlungen), verstärkt wurden. Zudem stellt sich die Frage, wie durch Wiederholung zuvor verstärkter Reaktionen sich neues Verhalten, kreative Leistungen und Empfindungen entwickeln können.
Andere Kritiker weisen das Modell auch deswegen zurück, da jegliche Möglichkeit der Wahl und der Freiheit, sich zur eigenen Historie bewußt zu verhalten, von den Behavioristen kategorisch abgelehnt wird.
2.3 Der Behaviorismus aus der Sicht der Kritischen Psychologen
Durch die Behavioristen kam es zu einer Umorientierung der Wissenschaft auf das psycho- pragmatische Problem. Das psycho-pragmatische Problem äußert sich in der für den Behaviorismus typischen theoretischen und methodologischen Orientierung, in dem die Wiederspiegelungsfunktionen der Psyche geleugnet werden und neuropsychologische Strukturen und Prozesse weitestgehend außer Acht gelassen werden. Somit beschränkt sich der Gegenstand der Psychologie auf die Untersuchung des Verhaltens in seiner Anpassungsfunktion des Organismus an die Umwelt. Trotz positiver Resultate der behavioristischen Psychologie muß deutlich unterstrichen werden, daß sie aufgrund ihrer philosophischen und theoretischen Ausgangssituation eine wissenschaftliche Psychologie nicht begründen konnte, da sie erstens wesentliche Seiten des Psychischen aus dem tatsächlichen Gegenstand der Wissenschaft ausschließt und zweitens aufgrund einer mangelnden Auffassung menschlichen Verhaltens, in der die Struktur menschlichen Verhaltens nicht auf seinen gegenständlichen Charakter bezogen wird. Die Aufdeckung innerer, nicht beobachtbarer Strukturen, die dem overten Verhalten zugrunde liegen, werden durch reine Beobachtungsaussagen über Muskelbewegungen und Drüsensekretion völlig außer Acht gelassen und von vorne herein ausgeschlossen (was wiederum den Zugang zum Psychischen verhindert).
Die um die Jahrhundertwende vorherrschende Psychologie war durch eine dualistische Lösung des psychophysischen Problems geprägt. Es gab die Auffassung, daß die Seele (das Bewußtsein) als gesonderte Substanz (wie ein „kleiner innerer Mensch“) dem Körper gegenübersteht und Einfluß auf das Verhalten nimmt. Beim naturwissenschaftlich geprägten Behaviorismus herrscht der umgekehrte, frühe Dualismus vor, indem man versuchte, eine Psychologie ohne Psyche aufzubauen: Auf der einen Seite Psyche ohne Verhalten, auf der anderen Seite Verhalten ohne Psyche. Abschließend kann man sagen, daß die Methodologie der Behavioristen zwar in der Lage ist, eine Reihe von wesentlichen Fehlern der alten dualistischen Bewußtseinspsychologie zu umgehen, jedoch kommt es aufgrund der extremen empirischen Position zu einer Reihe neuer Fehler.
2.4 Gegenüberstellung:
Bei einem Vergleich des psychodynamischen Modells mit dem behavioristischen Modell werden die unterschiedlichen Ansichten und Vorgehensweisen noch einmal verdeutlicht. Der Freudsche Ansatz bezieht sich stark auf die Anlage- bzw. Erbposition. Die behavioristische Position betont die Umwelt als Determinante des Verhaltens. Der psychoanalytische Ansatz hat die Vorstellung innerer Determinanten in Form von angeborenen Gesetzen des Verhaltens, wobei der behavioristische Ansatz Lernprozesse für das Verhalten verantwortlich macht. Zudem legt die Psychoanalyse den Schwerpunkt auf die Erfahrungen in der frühen Kindheit. Behavioristen rücken frühere Verstärkungen und gegenwärtige Kontingenzen in den Vordergrund. Die Theorie Freuds befaßt sich unter anderem auch mit mentalen Vorgängen und unbewußten Prozessen, die beim behavioristischen Modell völlig außer Acht gelassen werden. Anhänger des psychodynamischen Modells gehen von einer inneren Disposition aus und stehen demnach im Gegensatz zum behavioristischen Modell, welches situative Faktoren in den Vordergrund stellt.
3. Der Einfluß von Freuds psychoanalytischen Modell auf die Lerntheorie:
Die große Bedeutung der Psychoanalyse für die Entwicklung des psychologischen Denkens in unserem Jahrhundert hat zu einer Reihe von Bemühungen geführt, Begriffe und Theorien der Tiefenpsychologie und der akademisch orientierten allgemeinen Psychologie zu vergleichen, in ein gemeinsames Bezugssystem zu bringen und unter Umständen zu verschmelzen. Trotz der sehr offensichtlichen Widersprüche des psychoanalytischen und des behavioristischen Modells gibt es gewisse Parallelen in ihren Grundannahmen und Forschungsaussagen, die eine Ausweitung des für den Lerntheoretiker interessanten Themenbereichs ermöglichten. An erster Stelle der Parallelen steht hier die philosophische Grundannahme des adaptiven Hedonismus, welches zurückzuführen ist auf den britischen Philosophen Jeremy Bentham (1748-1832). Dieses Prinzip erklärt, daß die Motivation menschlichen Handelns allein nach dem Gewinn von Lust und der Vermeidung von Schmerz ausgerichtet ist. Ein Zitat aus Freuds Buch „Jenseits des Lustprinzips“ legt Freuds Standpunkt dar: „ In der psychoanalytischen Theorie nehmen wir unbedenklich an, daßder Ablauf der seelischen Vorgänge automatisch durch das Lustprinzip reguliert wird, das heißt, wir glauben, daßer jedesmal durch eine unlustvolle Spannung angeregt wird und dann eine solche Richtung einschlägt, daßsein Ergebnis mit einer Herabsetzung dieser Spannung, also einer Vermeidung von Unlust oder Erzeugung von Lust, zusammenfällt. “ 1 Das Parallelprinzip zu Freuds Lustprinzip in der behavioristischen Lerntheorie trägt dort Namen wie „ Gesetz der Auswirkung “ (Thorndike) oder „Verstärkungstheorie“. Auch Freuds Erklärung anhand der „Spannungsreduktion“ wird unter anderem Namen von den Lerntheoretikern anerkannt. Der Physiologe Walter Cannon (1934) beschrieb Reize (bei Freud sind dies Triebe) wie Hunger oder Durst, welche die Aufrechterhaltung der „optimalen inneren Bedingungen“ garantieren, als Glieder eines homöostatische Mechanismus. Diese Definition erschien den Lerntheoretikern selbst während des Höhepunktes des Behaviorismus als objektiv genug, um von Spannung und von Reduktion zu sprechen Sie vermieden jedoch den von Freud benutzten Begriff der Lust. Erst seit Ende der 40-er, Anfang der 50-er Jahre richtete man unter den Behavioristen das Interesse wieder auf die Affektivität (Gesamtheit der Gefühlsregungen). So wurden nun psychologische Probleme zum Forschungsgegenstand, deren Phänomene früher als nicht overt, also als nicht direkt beobachtbar galten. Es handelte sich dabei unter anderem um konfliktreduzierende Abwehrmechanismen wie der Verdrängung, der Projektion, der Identifikation, der Fixierung und der Regression. Zu nennen seien hier die Forschungen von Dollard und Miller, Erikson und Kuehte, Bobbit, Sears, Mc Clelland, Mowrer und vielen anderen, deren Ergebnisse im letzten Abschnitt dieser Arbeit kritisch betrachtet werden.
Es sei noch zu erwähnen, daß es keine einfache Aufgabe ist, den Gedanken Freuds eine Lerntheorie zu entnehmen. Zum einen wurden beide Theorien relativ unabhängig voneinander entwickelt. Weder waren damals die Untersuchungen zu dem Gesetz der Auswirkung oder dem Problemlöseverhalten auf eine Überprüfung Freuds Aussagen angelegt, noch orientierten sich Freuds Theorien an den Ergebnissen der Experimentalpsychologen. Zum anderen liegt diese Schwierigkeit in Freuds Theorie selbst. Liefert Freuds psychoanalytische Theorie auch einen noch so großen Fundus an Ideen zur Ausweitung der lernpsychologischen Thematik, so ist sie auch gleichzeitig zu komplex und zu wenig formalisiert, als daß man ihr System von Aussagen problemlos zum Gegenstand einer experimentellen Überprüfung machen könnte.
Und so warnten auch Hilgard und Bower in einem lerntheoretischen Überblick: „ Das psychoanalytische Denken pflegt sehr komplex und unscharf formuliert zu sein, so daßman nicht leicht herausfinden kann, was wesentlich, und was entbehrlich ist, wo innere Widersprüche liegen. Wir brauchen eine sorgfältige kritische Systematisierung alles dessen, was durch klinische Erfahrung und durch andere wissenschaftliche Belege noch am ehesten als bewiesen gelten darf, so daßUnerhebliches und Widersprüchliches entweder weggelassen oder in einer Form dargestellt werden kann, die eine entscheidende Ü berprüfung möglich macht. “ 2
Einer der wichtigsten Versuche in dieser Richtung wurde von behavioristisch orientierten Forschern unternommen, die mit Hilfe experimenteller Methoden psychoanalytische Annahmen auf ihre Allgemeingültigkeit und Beweisbarkeit in kontrollierten Situationen überprüft haben. Dollard und Miller, deren Forschungen im folgenden Kapitel dargestellt werden sollen, zählen mit zu den am häufigsten zitierten Experimentalpsychologen, die diesen Versuch unternahmen, allerdings hauptsächlich auf theoretischer und weniger auf experimenteller Basis. Doch bevor die Theorien dieser beiden Forscher genauer behandelt werden, sollten noch die Forschungsergebnisse eines anderer Neobehavioristen besprochen werden, der einen maßgeblichen Einfluß auf den Ansatz von Dollard und Miller gehabt hat.
4. Hulls hypothetisch deduktives System:
Clark L. Hull (1884-1952) argumentierte als Behaviorist schon recht früh mit Begriffen, die eindeutig der Psychoanalyse entliehen waren, wie zum Beispiel Trieb, Hemmung, Gewohnheit und Freuds Prinzip der Spannungsreduktion. Jedoch zeichnet sich die Entwicklung seines hypothetisch deduktiven Systems (aus Hypothesen folgernd), bestehend aus 17 Postulaten, 133 spezifischen Theoremen und zahlreichen Subthesen, durch die typischen Eigenschaften der behavioristischen Forschung aus, wie zum Beispiel die Vorliebe für Objektivität, Präzision, experimentelle Strenge und der Annahme, das menschliche Verhalten lasse sich allein aus Reizen und Reaktionen ergründen (S-R Theorie). Hull behandelte jedoch diese beiden Faktoren wesentlich detaillierter als seine behavioristischen Vorgänger. Reize bestehen nach Hull aus einer großen Anzahl antezedenter, den Organismus beeinflussender Bedingungen, welche zu bestimmten Verhaltensweisen (Reaktionen) führen können, aber nicht müssen. Antezedente Bedingungen sind nach Hull die Input-Variablen
(Reizvariablen), Reaktionen sind die Output-Variablen. Die zentrale Stellung im Hullschen System nehmen jedoch die intervenierenden Variablen ein. Diese sind im Gegensatz zu den Input- und Output-Variablen nicht overt, also nicht direkt beobachtbar und meßbar. Hull geht dennoch davon aus, daß die intervenierenden Variablen eine direkte Verbindung mit den externen Variablen (Input- und Output-Variablen) besitzen, indem sie zwischen dem Reiz und der Reaktion stehen und bestimmen, ob eine Reaktion auf einen Reiz hin stattfindet oder nicht. Somit ist jede Input-Variable mit einer intervenierenden Variable verknüpft. Es soll hier ausreichen, nur die wichtigsten und für uns relevanten Variablen und Mechanismen vorzustellen, da das gesamte Hullsche System viel zu komplex ist, als daß es hier in Kürze erläutert werden könnte.
Zu den wichtigsten intervenierenden Variablen gehören die Gewohnheitsstärke und die Antriebsstärke. Die Gewohnheitsstärke ( [sHr]; „habit“ = Gewohnheit) entspricht der Anzahl der vorangegangenen Paarungen des Reizes mit einer Reaktion, unter der Voraussetzung, daß jede Paarung verstärkt wurde ( [N] = Input-Variable). Die Antriebsstärke ( [D]; „drive“ = Antrieb) entspricht der Input-Variable der Antriebsbedingung, also dem Motivationszustand des Organismus ( [Cd] ), und hat dabei folgende Funktion: Lernen ist nach Hull ein Prozeß, bei dem Reaktionen mit Reizen verbunden werden, wenn durch die Verbindung eine Reduktion des Antriebes stattfand. Genauer gesagt handelt es sich um die Reduktion der Anzahl/Intensität der Reize, die mit dem Antrieb in enger Verbindung stehen. Dabei unterscheidet man zwischen primären und sekundären Antrieben. Primäre Antriebe hängen eng mit den Bedürfnissen des Körpers zusammen (Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme). Sekundäre Antriebe werden durch zeitliches Zusammentreffen mit primären Antrieben definiert (ähnlich dem Prinzip der sekundären Verstärkung).
Nach Hull kommen dem Antrieb drei Funktionen zu:
1. Antrieb sorgt für Verstärkung, ohne die das Lernen nicht stattfinden würde.
2. Antrieb aktiviert die Gewohnheitsstärke. Ohne Antrieb würde Verhalten also gar nicht erst stattfinden, selbst wenn vorher eine sehr starke Gewohnheit vorhanden war.
3. Antriebsreize werden durch den Lernprozeß an spezifische Verhaltensweisen gebunden. Diese Differenziertheit der Antriebsreize garantieren angemessenes Verhalten und bestimmen, ob eine Reaktion verstärkt wird oder nicht.
Eine weitere interessante intervenierende Variable ist die Verhaltensoszillation ( [sOr] ; Oszillation des Reaktionspotentials), welche Hulls Annahme entsprang, daß das Reaktionspotential nicht genau fixiert ist, sondern um einen mittleren Wert herum variiert. Sie entspricht der Tatsache, daß selbst bei ausreichender Information über die Input- Variablen, Vorhersagen nicht immer ganz exakt sein können.
Zwei weitere Konzepte, welche Hull im Verlauf der Überprüfung seiner Theoreme und Subthesen aufstellte, sind noch zu erwähnen: Das Konzept der „ partiell antizipierenden Zielreaktionen “ und die „ Gewohnheitshierarchie “.
4.1 Partiell antizipierende Zielreaktionen:
Hull unterschied zwischen direkten, instrumentellen Reaktionen und solchen, welche selbst als diskriminative Reize für weitere Reaktionen wirken. Solche sogenannten „cue-producing responses“ (Hinweisreiz-produzierende Reaktionen) können auf verschiedene Weise wahrgenommen werden, wie zum Beispiel durch Wörter (verbal), Zeichen (visuell), Gerüche (olfaktorisch), usw. Die Hauptaufgabe einer solchen Reaktion ist es, einen diskriminativen Reiz zu liefern, der dann eine weitere Reaktion auslöst. Dieses Prinzip wird bei dem Prozeß des „chainings“ genutzt, bei dem es darum geht, eine ganze Handlungskette zu konditionieren. Dabei wird zunächst die Zielreaktion durch einen primären Verstärker konditioniert, die dann wiederum selbst als sekundärer Verstärker für jede vorhergehende neue Reaktion. Jede vorhergehende Reaktion übernimmt dann die Doppelrolle eines sekundären Verstärkers für die ihm vorangehende Reaktion und eines diskriminativen Reizes für die folgende Reaktion. Ein Beispiel für eine cue-producing response könnte das Zählen von Wechselgeld sein. Diese Handlung macht alleine für sich gesehen wenig Sinn, wiederum im Zusammenhang mit dem Hinweisreiz, den sie produziert, schon mehr. Dieser besteht aus einem Betrag, den die Person überprüfen kann, und der dann mindestens zwei mögliche Reaktionen auslösen kann. Entweder der Betrag stimmt, und das Geld wird eingesteckt, oder der Betrag stimmt nicht und wird daher reklamierter. (Also: Reaktion (zählen) löst Hinweisreiz aus (Betrag), Hinweisreiz löst Reaktion aus (wegstecken oder reklamieren)).
Eine spezielle Rolle kommen den partiell antizipierenden Zielreaktionen3 ( [rg]; „fractional antedating goal-response“) zu. Diese zählen im gewissen Sinne selbst zu den cue-producing responses, mit der Ergänzung, daß sie selbst sekundär verstärkend wirken, da sie durch den kurzen zeitlichen Abstand zur Zielreaktion gewissermaßen mit dieser assoziiert werden. Solche Reaktionen beinhalten eine Reihe von Reaktionen des Organismus auf die Umweltreize. Im Beispiel eines Versuchs mit einer Ratte, die in einem Labyrinth den richtigen Weg zum Futter finden soll, können partiell antizipierende Reaktionen beim Putzen der Nase, beim unmotivierten Schnüffeln, usw. beobachtet werden. Diese Reaktionen sind wichtig, da sie Reize hervorrufen ( [sg] ), die das zielgerichtete Verhalten aufrecht erhalten.
4.2 Die Gewohnheitshierarchie:
Weil ein Organismus im Verlaufe der Aneignung einer Gewohnheit zahlreiche Wege zur Zielerreichung einschlagen kann, lernt er dementsprechend auch eine Reihe von verschiedenen Reaktionen auf den selben Reiz. Die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten lassen sich anhand gemeinsamer partiell antizipierenden Zielreaktionen in Gewohnheitsklassen („habit-family“) integrieren. Hull ging davon aus, daß alle zur Erreichung eines Zieles möglichen Reaktionen eine Hierarchie bilden. An der Spitze steht die Gewohnheit, die in der Vergangenheit am meisten verstärkt wurde. In der Regel ist dies auch die Reaktion, die zur Zielerreichung gewählt wird. Findet jedoch durch irgendwelche Umstände eine Blockierung dieser Reaktion statt, tritt an ihrer Stelle die in der Gewohnheitshierarchie folgende Reaktion in Kraft.
5. Dollard und Miller (1950): „Personality and Psychotherapy“
Beim Lesen des Buches „Personality and Psychotherapy“ von Dollard und Miller (1950) ist unverkennbar, daß es sich hier um einen Integrationsversuch der psychoanalytischen und behavioristischen Ansätze handelt. Allein die Widmung „ To Freud and Pavlov and Their Students “ zeugt unmißverständlich von diesem Versuch . Wie Dollard und Miller sich einen solchen Versuch vorstellen, machen sie bereits in ihrer Einleitung deutlich: „ The ultimate goal is to combine the vitality of psychoanalysis, the rigor of the natural-science laboratory, and the facts of culture. We believe that a psychology of this kind should occupy a fundamental position in the social sciences and humanities — making it unnecessary for each of them to invent ist own assumptions about human nature and personality. “ 4
Wie Freud gehen sie davon aus, daß Ergebnisse von Studien, die sich mit Neurotikern beschäftigen, übertragbar sind auf „normale“ Menschen. Die selben Variablen, die in einem extremen Ausmaß bei Neurotikern wirken, sind ebenfalls in normalen Menschen präsent, nur daß sie hier leichter erkennbar und damit leichter zu untersuchen sind. Der Vorteil liegt nicht nur in der eindeutigeren Diagnostizierbarkeit des Verhalten. Die Psychotherapie beschäftigt sich auch deshalb hauptsächlich mit neurotischen Patienten, da genau diese den Hauptanteil ihrer Klientel ausmacht. Menschen, die dahingehend normal sind, daß sie keine sich und ihre Umwelt störenden, neurotische Verhaltensweisen zeigen, haben im Allgemeinen wenig Motivation, Geld und/oder Zeit in eine Psychotherapie zu investieren.
Der Psychotherapie kommen daher zwei Aufgaben zu: Zum einen die isolierte Untersuchung von anormalem Verhalten und zum anderen die Beschreibung des Prozesses, in dem Normalität hergestellt wird. Auf diese Weise gewann auch Freud seine Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeit des mentalen Lebens, wie beispielsweise die Wichtigkeit von den Faktoren Motivation und Konflikt, der Rolle der Familie in der frühen Kindheit und des unbewußten mentalen Lebens. Dollard und Miller fordern nun die empirische Überprüfung der genannten Gesetzmäßigkeiten. Sie gehen davon aus, daß sich Neurosen funktional verhalten und somit erlernt sein müssen. Wenn sie erlernt sind, müßten sie sich auf bereits bekannte, experimentell überprüfte Lerntheorien stützen oder auf neue, noch unbekannte Theorien. Dies bedeutet, daß neurotisches Verhalten durch ein bestimmtes „Training“ ebenso korrigiert werden kann, wie zum Beispiel eine schlechte Körperhaltung beim Tennis. Dem Therapeuten kommt also eine ähnliche Aufgabe zu wie dem Trainer.
5.1 Freuds Realitätsprinzip im Sinne von „ höheren mentalen Prozessen “:
Als Freud bemerkte, daß Verhalten nicht allein durch das Lustprinzip zu erklären war, nahm er eine erste Ergänzung durch das Realitätsprinzip vor. Es besagt, daß der Organismus nicht mehr auf unmittelbare Triebbefriedigung besteht, sondern den „ langen, indirekten Weg zur Lust “ 5 einschlägt. Das Realitätsprinzip wurde bereits bei der Beschreibung des Ich erwähnt. Das Ich trägt, gesteuert durch das Realitätsprinzip, zur Vermittlung zwischen den Anforderungen des Es und denen des Über-Ich bei und ermöglicht so häufig eine Kompromißlösung.
Dollard und Miller erörtern das Realitätsprinzip im Sinne von „höheren mentalen Prozessen“, dem (normalen) Gebrauch des Verstandes beim Lösen (emotionaler) Probleme. Sie verwenden dabei nicht direkt den Begriff „Realitätsprinzip“, sondern ersetzen ihn durch den Begriff der „ Ich-Stärke “ (ego-strength) . 6 Die Ich-Stärke wird hier als Fähigkeit zur Realitätsbewältigung verstanden. Äußern tut sich das Realitätsprinzip in den mentalen Prozessen des Schlußfolgerns und Planens („reasoning and planing“)7. Die zentrale Rolle spielen hier die bereits erwähnten „cue-producing responses“, wie sie Hull bereits 1930 formulierte.
Schlußfolgern („reasoning“) ist ein alternativer Prozeß des Problemlösen zum instrumentellen, overten „trial and error“- Verfahren. Reasoning beinhaltet zwar häufig auch trial and error, jedoch liegt ein Vorteil in der gedanklichen Bearbeitung des Problems. Sicherere und weniger aufwendigere cue-producing responses (zum Beispiel verbaler oder visueller Art) ersetzen zeit- und arbeitsaufwendigere, manchmal auch gefährlichere, overte, instrumentelle Handlungen.
Wie bereits erwähnt, beinhaltet der Prozeß des reasoning trial and error. Doch es muß betont werden, daß die Hinweisreiz-auslösenden Handlungen nicht dem Zufall unterliegen. Sie sind abhängig von den inneren Antrieben, den äußeren Reizen und von der Art und Weise, wie die Person das Problem angeht (dazu später mehr).
Der Vorteil des Schlußfolgerns liegt jedoch nicht allein in der mentalen Variante der ansonsten instrumentellen trial and error Handlung. Jede Reaktion besteht aus vielen verschiedenen Einzelhandlungen. Bei der instrumentellen, overten Reaktion, die ohne reasoning abläuft, ist aufgrund der Struktur unserer Umwelt meistens nur ein einziger Versuch, sprich nur eine Sequenz von Einzelhandlungen möglich, die mit Glück zu Erfolg führt. Anders verhält es sich beim reasoning, welches mental abläuft, und cue-producing responses beinhaltet. Nach Hulls Theorie der partiell antizipierenden Zielreaktionen (s. S. 11), tragen einzelne Handlungen, die vor dem Zielerreichen auftreten, Hinweisreize des Ziels und besitzen sogar eine verstärkende Funktion. Dollard und Miller erklären nun, daß es in Gedanken (verbaler oder visueller Art ) möglich ist, in der Sequenz der einzelnen Hinweisreiz tragenden Handlungsmöglichkeiten vorzurücken und damit an Hinweise zu gelangen, die ein direktes Erreichen des Ziels wahrscheinlicher machen. Eine ähnliche, noch radikalere Möglichkeit ist es, am Ende der Handlungssequenz anzufangen (also beim Ziel), und diese dann „rückwärts abzuspulen“. Wie dies in der Realität aussehen kann, veranschaulichen Dollard und Miller im folgenden Beispiel:
Ein Autofahrer will an einer Kreuzung nach links abbiegen, um auf der gewünschten Straße in die gewünschte Richtung fahren zu könne (dies entspricht dem Ziel). Das Problem besteht darin, daß viele Autofahrer die selbe Absicht besitzen und somit einen Stau verursachen. Das reasoning in seinem in seinem Kopf könnte ungefähr wie folgt aussehen: Am liebsten würde er wohl einfach die Spur wechseln, am Stau vorbeifahren und einfach versuchen, an der Kreuzung links abzubiegen. Diese direkte zielgerichtete Reaktion wird jedoch von der Vorstellung gestoppt, daß er womöglich von den anderen Autofahrern daran gehindert würde und sich damit nicht nur in eine peinliche Situation bringen würde, sondern obendrein auch noch seinen Platz in der Autoschlange verliert. Also überlegt er weiter und versucht das Problem von einer anderen Seite anzugehen. „Wenn ich doch nur von der anderen Seite kommen würde.“ wünscht er sich. Dieser Gedanke entstand durch die Beobachtung, daß es auf der Gegenfahrbahn keinen Stau gibt und entspricht einer zielgerichteten, Hinweisreiz- produzierenden Reaktion. Er beginnt eine mögliche Sequenz von Handlungen rückwärts zu entwickeln und kommt somit auf die Lösung des Problems. Statt an der Kreuzung links abzubiegen fährt er zunächst einmal geradeaus, um dann so bald wie möglich zu wenden, um auf die Gegenfahrbahn zu gelangen, von wo aus er ohne Probleme auf die gewünschte Straße abbiegen kann.
Ein Aspekt, der bisher nur kurze Erwähnung fand, ist die Wichtigkeit, wie der Organismus das Problem angeht. Zur Veranschaulichung wählten Dollard und Miller ein vielleicht triviales, aber dennoch kniffliges Problem. Frage: „Wie baue ich ein Haus, dessen vier Außenwände alle nach Süden zeigen?“ Viel einfacher ist jedoch die Frage zu beantworten „Wo baue ich ein Haus, dessen vier Außenwände nach Süden zeigen?“ — nämlich am Nordpol. In dem Beispiel des eiligen Autofahrers läßt sich die Wichtigkeit dieses Aspektes ebenso verdeutlichen. Die Frage „Wie kann ich schnellst möglich links abbiegen?“ weicht der Fragestellung „Wie komme ich schnellst möglich auf die gewünschte Straße?“, worauf er beobachtet, daß Autos auf der Gegenfahrbahn kein Problem haben, dieses Ziel zu erreichen.
Auf diese Art und Weise können jedoch auch essentiellere Probleme (zum Beispiel emotionaler Art) gelöst werden. Dollard und Miller verwenden hier das Beispiel eines Piloten, der erst seit kurzem einen neuen Flugzeugtyp fliegt und seither arge Probleme beim Landen hat. Er konzentrierte sich zunächst auf verschiedene Landetechniken, mußte jedoch feststellen, daß seine Probleme nichts mit seiner Flugtechnik zu tun hatten. Statt sich also zu fragen „Was mache ich falsch?“, stellte er sich eine neue Frage: „Habe ich Angst?“ Er hatte nämlich erfahren, das dieser Flugzeugtyp eine sehr eigenenwillige Sackflug - Charakteristik haben soll. Dies ist der Ansatz einer Selbst - Therapie, wobei der Pilot sich selbst die Angst nahm, indem er den Sackflug in sicherer Höhe mehrfach praktizierte, und sich so mit dem neuen Flugzeugtyp vertraut machte.
Planen funktioniert im Prinzip ähnlich wie Schlußfolgern, die Betonung liegt jedoch im Gegensatz zu letzterem viel stärker auf dem Zukunftsaspekt von Handlungen, als auf sofortigen unmittelbaren Problemlösung. Da relativ viel Zeit zwischen Planen und Handeln besteht, können Handlungen viel weiter durchdacht und deren Konsequenzen gegeneinander abgewogen werden. Deshalb spricht man beim Lösen von emotionalen Problemen wie im Beispiel des Piloten eher von Planen als von Schlußfolgern.
5.2 Die Abwehrmechanismen des Ich:
5.2.1 Verdrängung:
Wie bereits beschrieben, läßt Freud dem Ich eine Art Vermittlerrolle zwischen den trieborientierten Forderungen des Es und den moralischen Einschränkungen des Über- Ich zukommen. Dabei kann es passieren, daß ein einfacher Kompromiß nicht zulässig ist und extreme Wünsche des Es verdrängt werden. Verdrängung ist also eine psychische Maßnahme des Ich, starke und nicht akzeptable Es-Impulse in das Unterbewußte zu verschieben, wodurch ihr öffentlicher Ausdruck kontrolliert wird. Dies geht soweit, daß eine Person, die zum Beispiel die Emotion Haß gegen ihre Eltern verdrängt, sich diesen Gefühlen in keinster Weise bewußt wird. Das Leugnen der vom Es gesteuerten Impulsen bedeutet jedoch nicht, daß sie damit nicht mehr von Relevanz sind. Sie werden weiterhin in der Person existent sein und bei entsprechenden Gegebenheiten ins Vorbewußte drängen. Auf diese Weise wird der verdrängte Impuls dann zum Problem. Die Person erkennt beispielsweise die Irrationalität ihres Handelns oder ihrer Gefühle, kann sie aber nicht erklären. Die Person bemerkt zum Beispiel, daß sie ihre Eltern nicht leiden kann. Da dies aber kein akzeptables Gefühl ist, sucht die Person nach einer logischen Erklärung. Diese Suche ist wiederum motiviert durch die Angst, die durch die vorbewußte Wahrnehmung des Konfliktes entstanden ist. Angst ist also ein Warnsignal für nicht erfolgreiche Verdrängung. In einem solchen Fall greifen weitere Abwehrmechanismen des Ich ein, wozu unter anderem Regression, Verschiebung, Rationalisierung, Phantasien, Projektion oder Reaktionsbildung zählen. Auf die genannten Abwehrmechanismen gehen nun Dollard und Miller im einzelnen mehr oder weniger ausführlich ein, indem sie diese nach den Lerngesetzen Hulls definieren.
5.2.2 Regression:
Die Regression ist ein Abwehrmechanismus des Ich, das sich dahingehen äußert, daß das Individuum auf eine frühere Entwicklungsstufe mit primitiveren Reaktionen zurückzieht.
Dollard und Miller erklären die Regression anhand Hulls Prinzip der Gewohnheitshierarchie (s.S.12) . „ Wenn eine vorherrschende (dominant) Gewohnheit durch einen Konflikt verhindert oder durch ausbleibende Verstärkung gelöscht wird, tritt an dessen Stelle die nächst stärkste Reaktion auf. “ 8 Dabei beziehen sie sich vermutlich auf den Konflikt, in dem das Ich zwischen Es und Über-Ich nicht mehr vermitteln kann und die Forderung des Es nicht mehr erfüllt werden können. Dollard und Miller gehen davon aus, daß an nächster Stelle der Gewohnheitshierarchie häufig eine in der Kindheit gelernte Reaktion steht, auf die dann zurückgegriffen wird. Ist dies der Fall, liegt Regression vor, die sich nach den Regeln der Gewohnheitshierarchie verhält:
Je stärker Reaktionen in der Kindheit verstärkt wurden, desto wahrscheinlicher ist es, daß sie an zweiter Stelle der Gewohnheitshierarchie stehen und gegebenenfalls zur Regression führen.
Je schwächer eine Reaktion, die im Erwachsenenalter erlernt wurde, etabliert ist, desto kleiner braucht der Konflikt zu sein, der die Regression auslöst. Belegt werden diese Gesetzmäßigkeiten durch Befunde experimenteller Untersuchungen von Sears (1944) und die Beobachtung klinischer Fälle durch Freud (1925). Dollard und Miller gehen des weiteren davon aus, daß Handlungen, welche Hinweisreize liefern (cue-producing responses) oder Triebe hervorrufen (drive-producing responses), ebenso diesen Gesetzmäßigkeiten der Regression unterliegen.
Es muß betont werden, daß diese Dynamik der Gewohnheitsstärke, wenn sie auch der Regression zugrunde liegt, sich nicht zwangsläufig regressiv verhalten muß. Häufig greift der Organismus auf Verhaltensweisen zurück, die nicht nur in der Vergangenheit erfolgreich waren, sondern auch in der Gegenwart zu einer Lösung führen. Nur wenn die Gegebenheiten (bedingt durch Veränderungen, welche die Umwelt oder das Individuum betreffen) sich drastisch seit dem Erlernen der alternativen Gewohnheit verändert haben, wird das Individuum Schwierigkeiten haben, da sein regressives Verhalten nicht mehr angemessen ist. Dies ist häufig der Fall bei pupertierenden Jugendlichen, die bedingt durch den Reifungsprozeß häufiger einem Wechsel der an sie gestellten Erwartungen unterliegen. Selten ist es der Fall, daß bei einer Regression die alternative Handlung zu 100% dem Verhaltensmuster der Vergangenheit entspricht. Statt dessen handelt es sich doch meistens um einen Kompromiß zwischen den alten und den neuen (aktuellen) Gewohnheiten.
5.2.3 Verschiebung:
Bei der Verschiebung handelt es sich um einen Abwehrmechanismus des Ich, bei dem aufgestaute, gewöhnlich feindselige Gefühle auf Objekte gerichtet werden, die weniger gefährlich sind als diejenigen, welche die Emotionen ursprünglich ausgelöst haben. Im Falle einer Person, die Aggressionen gegen die eigenen Eltern hegt, diese aber verdrängt, da eine solche Emotion nicht zulässig ist, würde sich eine Verschiebung zum Beispiel in Aggressionen gegen andere Autoritäten (wie zum Beispiel einem Lehrer) äußern.
Es gibt zahlreiche Faktoren, welche die Stärke von Reaktionen (im Sinne der Extinktionsresistenz) beeinflussen. Dazu zählt die Triebstärke während des Lernens, die Häufigkeit und Art (intermittierend, oder partiell) der Verstärkung, die Generalisierbarkeit der Verstärkung in anderen Situationen, usw. Bei der Regression spielt die Verstärkung einer Reaktion in der Vergangenheit eine Rolle, bei dem Abwehrmechanismus der Verschiebung hingegen entscheidet die Generalisierbarkeit des auslösenden Reizes über die Verschiebungseigenschaft einer Reaktion. Je mehr der Reiz sich generalisieren läßt, desto wahrscheinlicher unterliegt die Reaktion dem Prozeß der Verschiebung.
Der Verschiebung widmete sich vornehmlich Miller in einer sowohl theoretischen als auch experimentellen Auseinandersetzung.9 In einer genauen Analyse der einzelnen Faktoren, die in dem Mechanismus der Verschiebung wirken, unterscheidet Miller zwischen zwei Verschiebungsursachen. Reaktionen können zum einen durch Abwesenheit des auslösenden Reizes verhindert werden, zum anderen aber auch durch den Konflikt zwischen Es und Über- Ich.
Der erste Fall wäre beispielsweise gegeben, wenn eine geliebte Person verstirbt. Es kann dann unter Umständen vorkommen, daß der oder die Zurückgelassene sich in naher Zukunft einen neuen Partner sucht, der dem verstorbenen in spezifischen Merkmalen sehr ähnlich ist. Die Reaktion (in unserem Fall Liebe oder Zuneigung) der Person unterliegt also einem Generalisierungseffekt. Es ist zu erwarten, daß, je ähnlicher neue Reize (neue Bekanntschaften) dem alten Reiz (ehemaliger Partner) sind, die Reaktion (Liebe) um so stärker ausfallen wird.
Die zweite Situation, in der eine Reaktion durch einen Konflikt verhindert wird, ist vergleichsweise komplexer. Nehmen wir als Beispiel das klassische Problem der Ödipussage, bzw. das gegengeschlechtliche Beispiel der Elektrasage. Die (sexuelle) Zuneigung zu einem der Elternteile wird hier durch das Inzest-Tabu nicht zugelassen. Auch hier ist eine Verschiebung durch Generalisierung zu erwarten. Es gibt jedoch zwei mögliche Varianten, wie diese ablaufen könnte. Zum einen könnte die verhindernde Reaktion in dem Maße generalisiert werden wie die verhinderte Reaktion selbst. Das Inzestverbot, welches die sexuelle Zuneigung zur Mutter verhindert, wird also zu einem allgemeinen Verbot von sexueller Zuneigung zu Frauen generalisiert, die der Mutter in den entsprechenden Eigenschaften ähneln. Die Reaktion der sexuellen Zuneigung zu neuen Bekanntschaften würde ebenso verhindert werden wie in der ursprünglichen Situation. Zum anderen könnte aber die verhindernde Reaktion weniger dem Prozeß der Generalisierung unterliegen als die verhinderte Reaktion, was bedeuten würde, daß eine Verschiebung stattfinden würde, wie sie als klinisches Phänomen beschrieben wird. Im Unterschied zu der Reaktion, in der die Abwesenheit des auslösenden Reizes die entsprechende Reaktion verhinderte, verhält sich die Generalisierung hier nicht linear. Tatsächlich wird hier die stärkste Reaktion (sexuelle Zuneigung) durch Reize (neue Bekanntschaften) ausgelöst, die einen intermediären Grad der Ähnlichkeit zu dem ursprünglichen Reiz (Elternteil) aufweisen.
Zwei weitere beeinflussende Faktoren sind zum einen der Trieb, der im Zusammenhang mit dem Konflikt steht (Angst), und zum anderen der Trieb, der die ursprüngliche Reaktion motivierte. Eine Studie von Brown10 legt nahe, daß eine Steigerung des Triebes, der durch den Konflikt entstand, den Gradienten der Generalisierung ansteigen läßt. Das heißt, je mehr Angst der Konflikt hervorruft, desto stärker ist die Generalisierung der Reaktion und desto unähnlicher wird der neue Partner dem Elternteil sein. Konträr verhält es sich mit dem Trieb, der die ursprüngliche Handlung motivierte. Je stärker dieser ist, desto ähnlicher werden die Objekte der sexuellen Begierde dem Elternteil sein.
Miller geht davon aus, daß nicht nur Reize, sondern auch Triebe und Reaktionen dem Prozeß der Generalisierung unterliegen können. So wird zum Beispiel ein Reiz, der erfolgreich zur Reduzierung eines Triebes geführt hat, ebenfalls Ziel der Reduzierung anderer Triebe. Babys, die lernen, bei Hungergefühlen ihre Mutter zur Stillung ihres Hungers aufzusuchen, werden auch bei anderen Trieben wie zum Beispiel Angst automatisch ihre Mutter als Zufluchtsort aufsuchen. Interessant sind auch Beobachtungen der Reaktionsgeneralisierung. Es ist bekannt, daß durch die Verstärkung einer Reaktion andere ähnliche Reaktionen ebenfalls mitverstärkt werden. Wenn nun im Falle des Ödipuskomplex ein Junge sexuelle Zuneigung zu seiner Mutter hegt, diese jedoch durch das Inzest-Tabu nicht zugelassen werden, so kann es zu Ersatzhandlungen komme, die einer Befriedigung der sexuellen Zuneigung entsprechen, wie zum Beispiel Masturbation oder Kuscheln mit der Mutter.
Auch wenn Dollard und Miller die Reaktionsgeneralisierung als Mechanismus der Verschiebung beschreiben, entspricht er doch mehr dem Abwehrmechanismus der Sublimierung, auf den sie in ihrem Buch gar nicht eingehen. Eine Sublimierung liegt vor, wenn nicht erfüllte (sexuelle) Bedürfnisse durch Ersatzhandlungen befriedigt werden, die den gesellschaftlichen Moralvorstellungen nicht widersprechen. Die Ersatzhandlungen werden dabei durch ihre angstreduzierende Eigenschaft verstärkt und somit bald zur Gewohnheit.
5.2.4 Rationalisierung:
Rationalisierung, wie Freud sie als Abwehrmechanismus des Ich beschrieb, ist der Versuch, sich einzureden, daß das eigene Verhalten verstandesgemäß begründet und so vor sich selbst und vor anderen Personen gerechtfertigt ist.
Der Rationalisierungsmechanismus nach Freud deckt sich mit der Annahme von Dollard und Miller, daß dem menschlichen Verhalten das Streben nach logischen Erklärungen zugrunde liegt. In Fällen, in denen wahre Erklärungen Angst auslösen, etwa wenn verdrängte Konflikte ins Vorbewußte rücken, wirken andere logische Erklärungen, die keine Angst auslösen, verstärkend im Sinne der Spannungsreduktion. Sollte der Person in Zukunft durch irgendeinen Umstand ein weiteres Mal die angstauslösenden (aber realen) Gründe für sein Verhalten in den Kopf kommen, würden diese von vornherein durch die logische alternative Erklärung blockiert werden. Diese Blockierunsfunktion wirkt als zusätzlicher Verstärker. Extreme Rationalisierung nennen Dollard und Miller Selbsttäuschung (delusion). Diese unterscheidet sich in soweit nur quantitativ von der Rationalisierung, als daß der Trieb (also die Angst), der diesem Mechanismus zugrunde liegt, viel stärker ist und daß eine alternative gesellschaftlich akzeptierte Begründung viel schwieriger zu entwickeln ist. Die Größe der Verstärkung, die aus dieser Spannungsreduktion resultiert, verhält sich proportional zu der Triebstärke.
5.2.5 Phantasie (hallucinations):
Der Mensch entwickelt Phantasien aus nicht befriedigten und dadurch frustrierend wirkenden Wünschen. Sie sind also eine Art imaginäre Wunscherfüllung (zum Beispiel Tagträume).
Dollard und Miller behandeln diesen Abwehrmechanismus unter dem Begriff der Halluzination, was den unbewußten Aspekt dieses Vorgangs vielleicht besser verdeutlicht. Dabei gehen sie von der Hypothese aus, daß cue-producing responses, eingeschlossen mentale Bilder und Wahrnehmungen, den selben Gesetzen der Generalisierung folgen wie einfache (externe) Reaktionen. Ist dies der Fall, ergeben sich folgende zwei Gesetzmäßigkeiten: Je mehr der wahrgenommene Reiz den Merkmalen des originalen Reizes entspricht, desto wahrscheinlicher ist es, daß er die selben Hinweise liefert. Dies entspricht jedermanns Alltagserfahrung, da man bestimmte Dinge aufgrund ihrer Ähnlichkeit verwechselt. Es soll schon häufiger vorgekommen sein, daß der Tee überraschender Weise salzig statt süß geschmeckt hat. Ähnlich verhält es sich mit der Stärke des Triebes, der zu der wahrnehmenden Reaktion führt. Je stärker dieser ist, desto eher kommt es aufgrund stärkerer Generalisierung zu Verwechslungen. Jemand, der sehr durstig ist, wird eine ungenießbare Flüssigkeit eher für trinkbar halten, als jemand, der keinen Durst verspürt. Ist der Trieb besonders stark, kann es vorkommen, daß eine Person eine Verhaltensweise auf einen Reiz zeigt, die für Außenstehende keinen Zusammenhang mit den Reiz erkennen läßt. Ein sehr geeigneter Trieb scheint hier die Angst zu sein. Jeder von uns wird in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, was passieren kann, wenn man alleine im Dunkeln ist. Häufig stellt sich nach kurzer Zeit Angst ein, die sich sehr rasch dadurch steigert, daß man in nicht zuordenbaren Schatten und Schemen angsteinflößende Gestalten oder Gegenstände zu erkennen glaubt.
Dollard und Miller gehen zudem davon aus, daß Wahrnehmung ebenso wie andere Reaktionen dem Lernprozeß unterliegt. Kinder lernen zwischen realen und erfundenen Bildern zu unterscheiden und die realen zu bevorzugen. Wann immer eine imaginäre Wahrnehmung mit einer realen konkurriert, werden, jedenfalls in unserer Kultur, Reaktionen auf die reale Wahrnehmung belohnt, also verstärkt. Da Wahrnehmung offensichtlich den Lernprozessen, wie wir sie kennen, unterliegt, muß es auch möglich sein, jemanden so zu konditionieren, daß er eher auf imaginäre Wahrnehmung reagiert. Diese Behauptung findet ihre Begründung in einer Untersuchung von Murdock11. In seiner kulturvergleichenden Studie berichtet er, daß in Kulturen, in denen soziales Lernen imaginäre (spirituelle) Wahrnehmung bevorzugt, häufiger Halluzinationen beobachtet werden können.
5.2.6 Projektion:
Ein weiterer Abwehrmechanismus, mit dem das Ich auf den Konflikt zwischen Es und ÜberIch reagieren kann, ist die Projektion. Mit der Projektion ist der Vorgang gemeint, bei dem das Individuum Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die es selbst besitzt (und die meist negativ besetzt sind bzw. abgelehnt werden) bei anderen Personen wahrnimmt. Ein geflügeltes Wort, welches der beschuldigenden Person Projektion vorwirft, ist der sinnbildlich gemeinte Ausspruch: „Faß‘ Dir mal lieber an die eigene Nase.“
Dollard und Miller legen der Projektion soziales Lernen zugrunde. Eine projizierende Person hat zumindest gelernt, daß andere Personen ähnlich reagieren wie sie selbst und daß es von persönlichem Vorteil ist, wenn jemand anderen die Schuld trifft als einen selbst. Ersteres lernt die Person aus folgenden drei Gegebenheiten: a) Menschen neigen dazu, aufgrund ihrer biologisch ähnlichen Struktur, ähnlich zu reagieren. b) Des weiteren werden Ähnlichkeiten an Personen beobachtet, die einen ähnlichen sozialen Hintergrund haben. Dies liegt an der Tatsache, daß Menschen meistens ihres Gleichen suchen. c) Emotionale Äußerungen übertragen sich häufig direkt auf Mitmenschen, so daß auch hier ähnliches Verhalten beobachtet werden kann. Beispielsweise sagt man ja auch, daß Lachen anstecken kann.
Das zweite zugrunde liegendes Prinzip wird durch die Verstärkung gelernt, die daraus resultiert, daß die Person einer Bestrafung entkommen konnte, weil er jemand anderen anschwärzen konnte.
Die projizierende Person „labelt“ (engl.: etikettieren, beschriften) nicht nur das Opfer der Projektion falsch, sie vermag auch nicht, ihre eigenen Motive korrekt zu benennen.
5.2.7 Reaktionsbildung:
Von Reaktionsbildung spricht man, wenn angstbeladene Wünsche vermieden werden, indem gegenteilige Intentionen und Verhaltensweisen überbetont werden.
Auch die Reaktionsbildung erklären Dollard und Miller anhand ihres spannungsreduzierenden Effekts. Das Verneinen der eigenen unmoralischen Motive und die Konzentration auf Motive, die erlaubt oder gar angesehen sind und den eigenen Motiven entgegenstehen, scheint ein Weg zu sein, diese zu unterdrücken. Die darauf folgende Spannungsreduktion wirkt verstärkend auf die neuen Motive.
6. Beispiele und Bewertung experimenteller Untersuchungen:
Alle Versuche, die eine experimentelle Untersuchung der psychoanalytischen Theorie anstrebten, stießen auf erhebliche theoretische und methodische Schwierigkeiten, so daß sowohl von experimentalpsychologischer als auch von psychoanalytischer Seite massive Kritik an diesen Bemühungen nicht ausbleiben konnte. Zum einen muß darauf hingewiesen werden, daß die zur Überprüfung herangezogenen Begriffe und die ihnen zugrunde liegenden Prozesse in das System der psychoanalytischen Theorie eingebettet sind und von daher nur schwer in ein völlig anderes Bezugsystem übertragen werden können. — Einige Kritiker vermuten, daß dies überhaupt nicht möglich sei. Zum anderen beziehen sich Freuds Deskriptionen auf individuelle Biographien. Die beobachteten Prozesse verlaufen allesamt unbewußt und liegen zumindest auf der Grenze zum Pathologischen. Daher erscheint die Überprüfung auf der Basis eines hohen Allgemeinheitsgrades zumindest problematisch.
Diese genannten Schwierigkeiten lassen vermuten, weshalb es vergleichsweise nur wenig experimentelle Untersuchungen gibt, die sich mit Freuds Abwehrmechanismen des Ich befassen. Die große Bedeutung von Begriffen wie „Verdrängung“, „Regression“, „Fixierung“, „Verschiebung“, „Rationalisierung“, „Projektion“ usw. für die Allgemeine Psychologie, die Persönlichkeitspsychologie und für die klinische Psychologie haben jedoch einer Reihe von Forschern einen Anlaß gegeben, trotz der beschriebenen Probleme experimentelle Untersuchung zu diesen Begriffen anzulegen. Es ist nur schwer zu beantworten, ob die dabei verwendeten Begriffe und die untersuchten Prozesse mit den von Freud ursprünglich gemeinten Sachverhalten übereinstimmen oder zumindest interpretierbare Analogien aufweisen.
Auf diese Schwierigkeit verweist Feger (1965)12 anhand des Begriffes der „Verdrängung“: Feger bemerkt, daß schon Freud den Begriff der „ Verdrängung nicht einheitlich verwendet “. Im allgemeinen beschreibt Freud Verdrängung als einen Abwehrmechanismus des Ich, durch den nicht akzeptable, angststiftende Impulse vom Bewußtsein ferngehalten werden. Als genauere Definition führt Feger die vier Aspekte der Verdrängung nach Blum an. Demnach beinhaltet Verdrängung:
„(1) disturbing ideas related to conflict-provoking impulses;
(2) unconscious processes whereby the ideas are removed from awareness;
(3) continued striving for some sort of expression while in check; and
(4) renewed availability for conscious expression under benign conditions.“13
Eriksen und Kuethe, zwei Forscher, die sich selbst mit der Verdrängungshypothese experimentell befaßten, verlangten entsprechend den ersten beiden Punkten, daß Studien, die den Prozeß der Verdrängung als von der Psychoanalyse beschriebenes Phänomen untersuchen, eine Eliminierung angstauslösender Impulse ohne Wissen des Versuchsteilnehmer miteinschließen müssen. In vielen Studien wird bereits von Verdrängung gesprochen, wenn in einem Wahrnehmungsexperiment eine spezifische Erschwerung des Wiedererkennens beobachtet wird, wie auch in Lernversuchen selektives Vergessen von Material, welches mit irgendeinem negativen Affekt assoziiert wird, als Verdrängung gedeutet wird.
6.1 Beispiel eines Versuches zur Verdrängungshypothese:
Eriksen und Kuethe14 überprüften die Annahme von Dollard und Miller, nach der — entsprechend der Verdrängungshypothese — Vorstellungen unterdrückt werden, die Angst hervorrufen. Sie verwendeten dabei die Methode der verbalen Vermeidungskonditionierung. Es handelte sich um einen Assoziationsversuch, in dessen ersten Teil bestimmte Schlüsselworte mit einem elektrischen Schock kombiniert wurden. Im zweiten Teil, in dem die Versuchspersonen davon ausgingen, daß der eigentliche Versuch bereits beendet war und keine weitere Bestrafung mehr erfolgt, sollten die Probanden Kettenassoziationen zu den Reizwörtern bilden. Zum Abschluß wurden die Versuchspersonen interviewt, um zu überprüfen, ob sie an sich selbst eine Verhaltenveränderung festgestellt hatten.
Die Ergebnisse zeigten, daß alle Versuchsteilnehmer die bestraften Assoziationen vermieden. Jedoch hatte eine Gruppe der Versuchspersonen ihre Verhaltensveränderung bemerkt, bei der anderen Gruppe geschah diese Verhaltensveränderung völlig unbewußt. Diese Gruppe wies interessanter Weise auch wesentlich geringere Reaktionszeiten auf.
Nur bei der zweiten Gruppe kann man von Verdrängung sprechen, da hier die bestraften Assoziation-Reaktionen völlig unbewußt aus dem aktuellen Verhaltensrepertoire eliminiert wurden.
6.2 Beispiel eines Versuches zur Projektion:
In einem Experiment ließ Sears15 ca. 100 Studenten ihre Kommilitonen anhand negativer Eigenschaften (z.B. Geiz, Eigensinn, Unordentlichkeit, Schüchternheit, usw.) einordnen. Der Grad einer negativen Eigenschaft (z.B. Geiz) eines Studenten wird durch den Mittelwert der Einschätzungen durch seine Kommilitonen repräsentiert. Ein weiterer Mittelwert wird aus den Angaben des Studenten, wie er seine Kommilitonen bezüglich der einzelnen negativen Eigenschaften (z.B. Geiz) einschätzt, gebildet. Der erwartete Zusammenhang zwischen beispielsweise einem hohen Grad an eigenem Geiz und der Wahrnehmung von Geiz bei anderen zeigte sich nur bei Personen, deren Selbsteinschätzung sich nicht deckte mit der Einschätzung durch andere, die sich ihres (unterstellten) Geizes also nicht bewußt waren. Studenten, deren Selbsteinschätzung sich mit der Fremdeinschätzung deckte, die also Einsicht in Ihre negative Angewohnheit hatten, zeigten eine negative Korrelation was die ihnen unterstellte Eigenschaften und die Eigenschaften, die sie ihren Kommilitonen unterstellten, betrifft. Das heißt, daß jemand, der als geizig eingeschätzt wird und der sich dieser negativen Eigenschaft nicht bewußt ist, eher zur Projektion seiner negativen Eigenschaften neigt als jemand, der sich seiner negativen Eigenschaft bewußt ist.
6.3 Beispiel eines Versuches zur Regression:
Ein Großteil der Experimente zur Regressionshypothese wurde an Tieren (Ratten) durchgeführt. Jedoch kann es nicht ernsthaft Sinn der Sache sein, Freuds Theorien in Hypothesen umzuwandeln und diese dann an Ratten zu überprüfen. Auch wenn Freud seine Aussagen nicht auf Ratten bezog, gelang es u.a. Sears, Freuds These, daß Regression eine Funktion der Fixierung (und diese gleich der Gewohnheitsstärke) sei, anhand von Tierexperimenten zu unterstützen.
Das bekannteste Experiment, welches Freuds Theorie der Regression an Menschen untersuchte, ist das von Barker, Dembo und Lewin. Sie untersuchten das Spielverhalten von Vorschulkindern mit überdurchschnittlicher Intelligenz. Die Kinder wurden unter zwei verschiedenen Bedingungen beobachtet. Zunächst spielten die Kinder mit beliebtem und begehrtem Spielzeug. Später wurden sie daran gehindert, indem sie von dem Spielzeug durch ein Drahtnetz ferngehalten wurden und nun mit weniger beliebtem Spielzeug spielen mußten.
Die Konstruktivität ihres Spiels wurde auf einer „constructiveness-of-play-scale“ mit den Lebensmonaten als Einheit bewertet. Die Ergebnisse zeigen, daß nach der Frustration (Entzug des beliebten Spielzeuges) eine deutliche Regression im Spielverhalten zu beobachten war. Des weiteren zeigte sich, das diejenigen Kinder, die am meisten frustriert waren, auch am meisten „regredierten“.
6.4 Bewertung:
Die Kritik an derartigen Versuchen kommt, wie bereits gesagt, nicht allein von experimentalpsychologischer Seite. Anna Freud ist der Meinung, daß beschriebene Versuche nicht das überprüfen, was Sigmund Freud unter Abwehrmechanismen verstand. So sagt sie, daß Projektion im ursprünglichen Sinne als primitiver Mechanismus nicht an normalen Erwachsenen (Sears untersuchte Studenten), sondern nur an kleinen Kindern und Psychotikern aufzuweisen sei. Untersuchungen zur Regression, wie sie von Barker, Dembo und Lewin durchgeführt wurden, kritisierte sie, da Störungen im Spielverhalten von Kindern grundsätzlich nicht vergleichbar seien mit gewichtigen emotionalen Störungen.
Eine gute Zusammenfassung von Kritikpunkten, die diese Art von Untersuchungen betreffen, liefert Rapaport: „ Die meisten der Untersuchungen … nahmen eine psychoanalytische Feststellung aus dem Zusammenhang heraus und prüften die Feststellung anstelle der Theorie. … Außerdem benutzten sie Testmethoden, die den Beobachtungen nicht entsprachen, denen die Feststellung und ihre Terminologie entstammte. … Die psychoanalytische Psychologie, die zwar klinischen Zwecken adäquat ist, wird viel systematischer werden müssen, ehe sich Experimente konstruieren lassen, die nicht nur einfach ihre Lehrsätzen bestätigen oder widerlegen, sondern sie spezifizieren oder modifizieren. Daher mußder Experimentalpsychologe, der sich mit ihr befaßt, die Verantwortungübernehmen, die Lehrsätze, die er prüfen will, theoretisch zu klären und zu spezifizieren. “ 16
Sears17, der selbst Untersuchungen dieser Art anlegte, sieht verständlicher Weise die Sachlage mit anderen Augen. Er bezweifelt, ob die direkte Überprüfung der psychoanalytischen Theorie eine geeignete Aufgabe für die experimentelle Psychologie sein kann. Auch wenn er selbst ein Vertreter der experimentalpsychologischen Methodologie ist, bemerkte er, daß die ihr zur Verfügung stehenden Verfahren viel zu schwerfällig sind, als daß sie dem komplexen Inhalt der psychoanalytischen Theorie gerecht werden könnten.
Hilgard und Bower teilen die Meinung von Rapaport, die psychoanalytische Theorie nicht nur zu überprüfen, sondern auch zu spezifizieren und modifizieren. „ Freud hat so manche Gedanken geäußert, die wohl für fast jeden Wissenschaftler unannehmbar sein dürften. Hierzu gehören etwa die Vorstellung von der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften sowie einige metaphorische Aussagenüber den Ort gewisser Funktionen im Gehirn. Uns kann es dabei nicht darum gehen, daßwir erraten, was Freud „ wirklich “ gemeint hat, um ihn sodann zu verteidigen oder zu widerlegen. Wir sollten vielmehr herauszufinden versuchen, was daran war ist, wobei es keine Rolle spielt, von wem die Behauptungen stammen. Freud hat einige interessante Hypothesen aufgestellt. Wir müssen sie möglichst sorgfältig formulieren und sie sodann prüfen. “ 18 Hilgard und Bower gingen ebenfalls auf die seit den 60-er Jahren aufgekommene, gegen Freud gerichtete Tendenz ein. Sie beobachteten, daß die Psychoanalyse immer mehr aus dem Anwendungsbereich verdrängt wurde, und fanden die Gründe sowohl in den Nachteilen der psychoanalytischen Herangehensweise, als auch in den Vorteilen, welche die alternativen Behandlungsmöglichkeiten beinhalten. Die Psychoanalyse erwies sich im Vergleich als zu zeitaufwendig und zu kostspielig. Therapien die mit Tranquilantien arbeiteten, oder das Verhalten durch Konditionierung modifizierten boten diesbezüglich eindeutige Vorteile. Außerdem konnten einige psychische Krankheiten durch die Fortschritte der modernen Biochemie auf genetische Ursachen zurückgeführt werden. Diese konkurrierenden Behandlungsalternativen wurden begleitet durch eine harsche Kritik nicht nur an der psychoanalytischen Behandlungsmethode, sondern auch an der psychoanalytischen Theorie überhaupt. Diese Ausweitung der Kritik auf die gesamte psychoanalytische Theorie beurteilten Hilgard und Bower als unangemessen, da sie an einigen Schwachpunkten der Theorie festgemacht wurde, ohne das zu berücksichtigen, was man aus ihr lernen könnte. „ Das Streben nach Objektivität in der psychologischen Wissenschaft verdient zwar unsere Unterstützung, doch geht damit die Gefahr einher, daßman sich dazu verleiten l äß t, auf tiefschürfende Fragen leichtfertige und oberflächliche Antworten zu geben. Wir sollten uns auch weiterhin Fragen von jener Art stellen, auf die uns Freud aufmerksam gemacht hat, wobei wir sie durchaus in unseren eigenen Begriffen neu formulieren könne. “ 19
Literaturverzeichnis:
- Blum, G. S. (1953). Psychoanalytic theories of personality. NY.
- Brown, J. S. (1942), The generalization of approach responses as a funktion of stimulus intensity and strength of motivation. Journal of comp. Psychology, 33, S.209-226.
- Dollard, J. & Miller, N. E. (1950). Personality and psychotherapy. An analysis in terms of learning, thinking, and culture. NY: Mc Graw-Hill Book Company.
- Eriksen, C. W. & Kuethe, J. L. (1956). Avoidance conditioning of verbal behavior without awareness: a paradigm of repression. Journal of abnormal social Psychology, 53, S.203- 209.
- Feger, H. (1965). Beiträge zur experimentellen Analyse des Konflikts. In Thomae, H. (Ed.), Handbuch der Psychologie 2. Band, Allgemeine Psychologie II, Motivation. Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Freud, S. (1920).Jenseits des Lustprinzips. In Freud, S. Gesammelte Werke, Band XII, 4. Auflage, S. 3, Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag.
- Friedrich, W. (1979). Zur Kritik des Behaviorismus. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag.
- Hilgard, E. R. & Bower, G. H. (1970) Theorien des Lernens I., Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Lefrancois, G. R. (1976). Psychologie des Lernens.. Berlin: Springer-Verlag.
- Miller, N. E. (1948). Theory and experiment relating psychoanalytic displacement to stimulus response generalization. Journal of abnormal science and psychology, 43, S.155- 178.
- Murdock, G. P. (1934). Our primitive contemporaries., NY: Macmillan.
- Rapaport, D. (o. J.). Die Struktur der psychoanalytischen Theorie. Zitat nach Feger, H. (1965). Stuttgart.
- Sears, R. R. (1936). Experimental studies of projektion. Journal of social Psychology, 7, S.151-163.
- Sears, R. R. (1944). Experimental Analysis of psychoanalitic phenomena. In J. Mc. V. Hunt (Ed.), Personality and the Behavior Disorders. NY.
- Zimbardo, P. G. (1995). Psychologie. Berlin: Springer-Verlag.
[...]
1 Freud, S. (1920). „Jenseits des Lustprinzips“. S.3.
2 Hilgard, E. R. und Bower, G. H. (1970) S.362.
3 Hilgard und Bower (1970) zitieren Hulls Prinzip mit: „fractional antedating goal-response“ (S.173), während Dollard und Miller (1950) von „anticipatory goal-responses“ (S.111) sprechen.
4 Dollard, J. und Miller, N. E. (1950); S.3.
5 Freud, S. (1920). S.6.
6 Dollard und Miller (1950), S.9-10.
7 Ebd. S.110-115.
8 Ebd. S.171.
9 Miller, N. E. (1948) S.155-178.
10 Brown, J. S. (1942), S.209-226.
11 Murdock, G. P. (1934). S.258-279.
12 Feger, H. (1965) S.390 ff.
13 Blum, G. S. (1953), S. 121.
14 Erikson, C. W. & Kuethe, J. L. (1956) S.203-209.
15 Sears, R. R. (1936). S.151-163.
16 Rapaport, D. (o.J.). Zitat nach Feger, H. (1965) S.395 f.
17 Sears, P. S. (1944), S.329.
18 Hilgard und Bower (1970). S.362-363.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse der behavioristischen und psychoanalytischen Modelle des Menschen, mit besonderem Fokus auf den Integrationsversuch dieser Modelle durch Dollard und Miller in ihrem Buch "Personality and Psychotherapy". Es werden die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und kritischen Punkte der beiden Modelle dargelegt. Darüber hinaus werden experimentelle Untersuchungen vorgestellt, die Freudsche Aussagen überprüfen sollten, und diese kritisch bewertet.
Welche Modelle des Menschen werden im Detail betrachtet?
Es werden das psychodynamische Modell (basierend auf Freuds Psychoanalyse) und das behavioristische Modell ausführlich beschrieben und gegenübergestellt.
Was sind die zentralen Aspekte des psychodynamischen Modells?
Das psychodynamische Modell, insbesondere Freuds Psychoanalyse, betont die Bedeutung der Motivation, Triebe (Es), Werte (Über-Ich) und des vermittelnden Ichs. Es geht davon aus, dass das Verhalten von unbewussten Motiven und Konflikten bestimmt wird, die oft auf frühe Kindheitserfahrungen zurückzuführen sind.
Was sind die zentralen Aspekte des behavioristischen Modells?
Das behavioristische Modell konzentriert sich ausschließlich auf beobachtbares Verhalten und dessen Beziehung zu Umweltreizen. Es betont die Rolle des Lernens durch Konditionierung (klassische und instrumentelle) und lehnt die Bedeutung von Instinkten oder inneren mentalen Prozessen ab.
Wie unterscheidet sich der Behaviorismus aus Sicht der Kritischen Psychologen?
Die Kritische Psychologie bemängelt am Behaviorismus, dass er die Wiederspiegelungsfunktionen der Psyche leugnet und neuropsychologische Strukturen und Prozesse weitestgehend außer Acht lässt, was den Zugang zum Psychischen verhindert.
Welchen Einfluss hatte Freuds psychoanalytisches Modell auf die Lerntheorie?
Trotz offensichtlicher Widersprüche gibt es Parallelen in den Grundannahmen (adaptiver Hedonismus) und Forschungsaussagen, die eine Ausweitung des für den Lerntheoretiker interessanten Themenbereichs ermöglichten, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von Affektivität und Abwehrmechanismen.
Was ist Hulls hypothetisch-deduktives System?
Hulls System ist ein Versuch, behavioristische Prinzipien mit psychoanalytischen Konzepten (Trieb, Hemmung) zu verbinden, indem er intervenierende Variablen (Gewohnheitsstärke, Antriebsstärke) zwischen Reiz und Reaktion postuliert. Er prägte Konzepte wie partiell antizipierende Zielreaktionen und die Gewohnheitshierarchie.
Was ist der Inhalt von Dollard und Millers Buch "Personality and Psychotherapy"?
Das Buch ist ein Integrationsversuch der psychoanalytischen und behavioristischen Ansätze. Es werden psychoanalytische Konzepte (wie das Realitätsprinzip und Abwehrmechanismen des Ich) im Rahmen lerntheoretischer Prinzipien erklärt und interpretiert.
Wie interpretieren Dollard und Miller Freuds Realitätsprinzip?
Sie interpretieren es im Sinne von "höheren mentalen Prozessen" und "Ich-Stärke", wobei sie die Fähigkeit zur Realitätsbewältigung und die Prozesse des Schlußfolgerns und Planens hervorheben.
Welche Abwehrmechanismen des Ich werden von Dollard und Miller behandelt?
Dollard und Miller behandeln ausführlich die Verdrängung, Regression, Verschiebung, Rationalisierung, Phantasie (Halluzinationen), Projektion und Reaktionsbildung, indem sie diese nach den Lerngesetzen Hulls definieren.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der experimentellen Überprüfung psychoanalytischer Theorien?
Es gibt erhebliche theoretische und methodische Schwierigkeiten, da die psychoanalytischen Begriffe in ein spezifisches theoretisches System eingebettet sind und sich auf individuelle, oft pathologische Fälle beziehen. Die Übertragung auf experimentelle Settings mit hohem Allgemeinheitsgrad ist problematisch.
Welche Kritik gibt es an experimentellen Untersuchungen zur Überprüfung psychoanalytischer Theorien?
Die Kritik kommt von experimentalpsychologischer und psychoanalytischer Seite. Anna Freud argumentierte, dass viele Versuche nicht das überprüfen, was Sigmund Freud unter Abwehrmechanismen verstand. Rapaport kritisierte, dass Feststellungen aus dem psychoanalytischen Zusammenhang herausgenommen und mit unpassenden Methoden geprüft werden.
Welche Alternativen werden zur direkten Überprüfung psychoanalytischer Theorien vorgeschlagen?
Sears bezweifelte, ob die direkte Überprüfung der psychoanalytischen Theorie eine geeignete Aufgabe für die experimentelle Psychologie sein kann. Hilgard und Bower schlugen vor, die Theorie nicht nur zu überprüfen, sondern auch zu spezifizieren und modifizieren.
- Quote paper
- Florian Junge (Author), 2001, Integrationsversuch des psychodynamischen und des behavioristischen Modells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100587