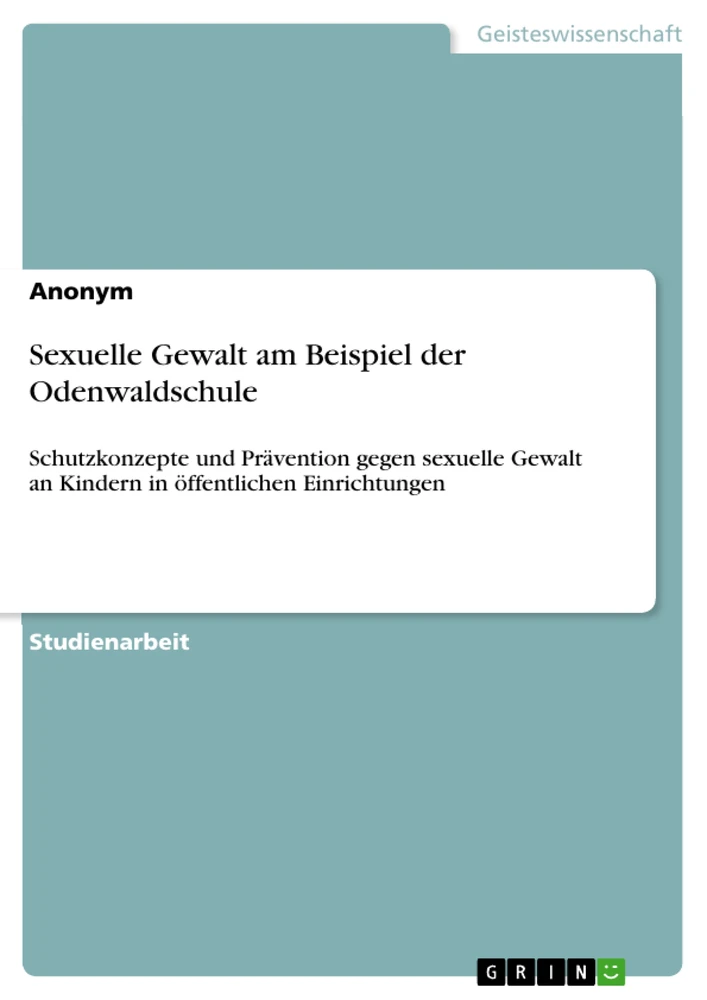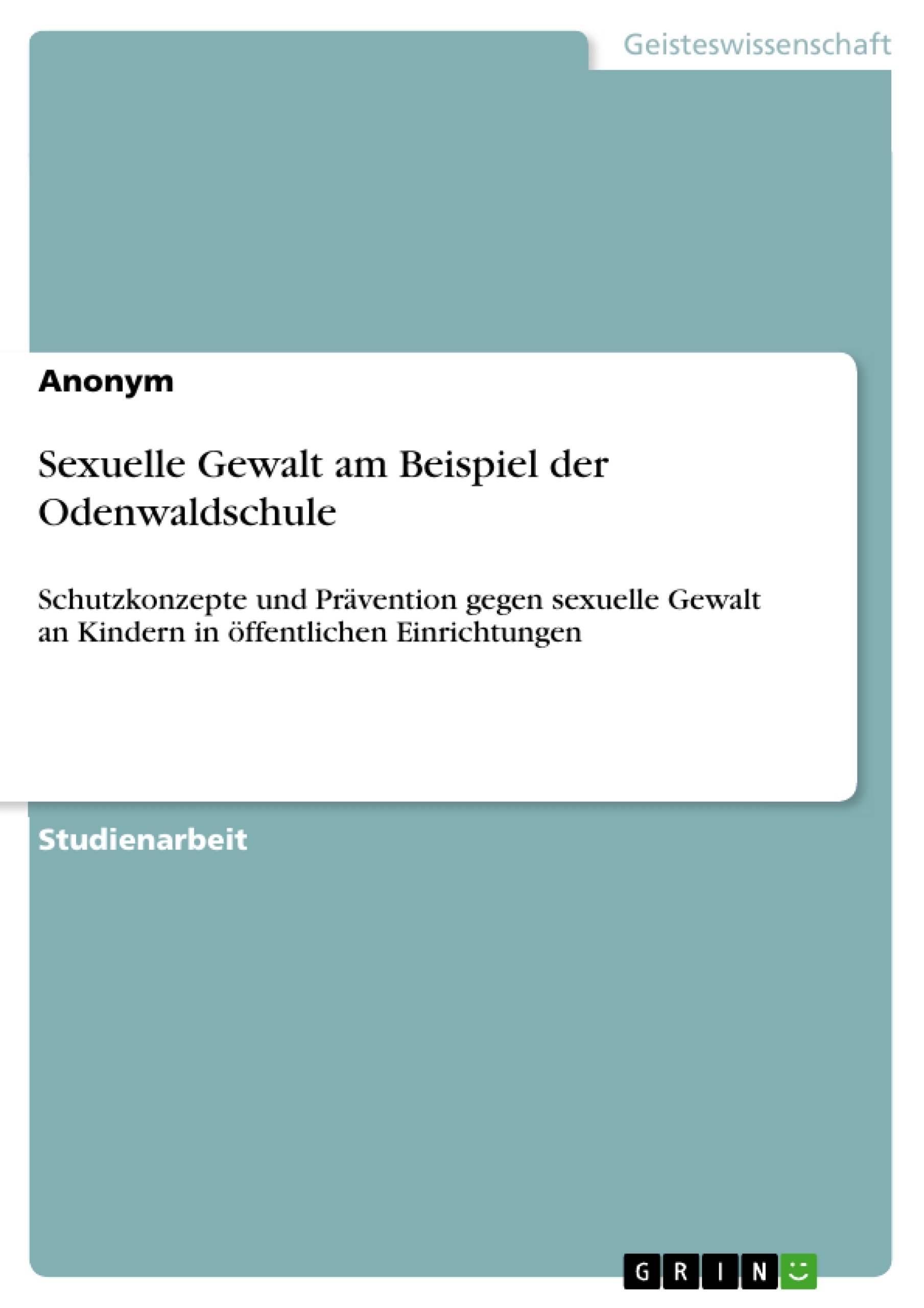Es stellen sich die Fragen, wie es zu den Übergriffen von sexueller Gewalt an Schülerinnen und Schülern an der Odenwaldschule kommen konnte, wie kann es sein, dass die Opfer über 30 Jahre schwiegen und selbst als sie ihre Sprache fanden, nicht gehört wurden?
Zum besseren Verständnis wird zu Beginn der Begriff ‚sexuelle Gewalt‘ definiert und begründet, warum hier nicht von sexuellem Missbrauch gesprochen wird. Im Folgenden werden die Grundlagen der Thematik der sexuellen Gewalt an Kindern thematisiert, dazu werden die Täterstrategien erläutert und sexuelle Gewalt an Kindern und speziell an Jungen aufgezeigt. Die Arbeit geht daraufhin zum Thema sexuelle Gewalt in Institutionen über. Im vierten Kapitel wird die Gründung der Odenwaldschule und das pädagogische Konzept vorgestellt. Im Anschluss daran wird die Frage beantwortet, wie die sexuelle Gewalt an der Odenwaldschule begünstigt wurde und mit welchen Strategien der Haupttäter vorging. Durch die Aufdeckungsarbeiten stellte sich heraus, dass sich die Vorfälle von sexueller Gewalt innerhalb der Amtszeit des Schulleiters Gerold Becker häuften, er wird somit als Haupttäter betrachtet und somit wird sich die Arbeit im weiteren Verlauf auf diesen Zeitraum beschränken.
Es wird analysiert, inwieweit die Bestandteile der reformpädagogischen Elemente der Odenwaldschule - die Nähe zum Kind, die Abgeschlossenheit der Internatsfamilien – für sexuelle Gewalt an Kindern genutzt wurden. Darauf folgt die Veröffentlichung der Vorfälle durch Huckele und seine Mitschüler, es wird gezeigt, welche Rolle die Medienberichte spielen und welche gesellschaftlichen Konsequenzen sich aus der Veröffentlichung ergeben. Die Arbeit bezieht sich zum großen Teil auf das Buch von Andreas Huckele (bis November 2012 unter Pseudonym Jürgen Dehmers geschützt). Zum Schluss des vierten Kapitels wird die Umsetzung des Films von Röhl über die sexuelle Gewalt an der Odenwaldschule erläutert. Im letzten Abschnitt zeigt die Arbeit Schutzkonzepte und Ansätze der Prävention gegen sexuelle Gewalt an Kindern in öffentlichen Einrichtungen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen zum Thema Sexuelle Gewalt
- Begriffserklärung: Sexualisierte Gewalt
- Täterstrategien
- Sexuelle Gewalt an Kindern
- Sexuelle Gewalt an Jungen
- Sexuelle Gewalt in Institutionen
- Das Beispiel Odenwaldschule
- Gründung und Pädagogisches Konzept
- Sexualisierte Gewalt an Schülern und Schülerinnen
- Begünstigungen für sexualisierte Gewalt an der Odenwaldschule
- Veröffentlichung der Missbrauchsfälle
- Medienberichte und gesellschaftliche Konsequenzen
- Der Film von Röhl
- Schutzkonzepte
- Was tun bei sexueller Gewalt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio befasst sich mit dem Thema sexuelle Gewalt und beleuchtet die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule. Ziel ist es, die Hintergründe und Täterstrategien zu analysieren, die zu den Übergriffen führten und die Folgen für die Opfer aufzuzeigen. Das Portfolio untersucht zudem die Rolle der Institution und der Gesellschaft im Umgang mit sexueller Gewalt.
- Begriffserklärung und Definition von sexueller Gewalt
- Täterstrategien und die spezifischen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche
- Die Rolle von Institutionen bei der Prävention und dem Umgang mit sexueller Gewalt
- Das Beispiel der Odenwaldschule: Entstehung, Pädagogisches Konzept und die Begünstigung sexueller Gewalt
- Schutzkonzepte und Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Thematik der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Kontext pädagogischer Einrichtungen. Sie zeigt die Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema auf.
Kapitel 2 beleuchtet die Begriffserklärung der sexuellen Gewalt. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Gewalt durch den Täter gegenüber dem Opfer zu betonen.
Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Täterstrategien und die spezifischen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Verantwortung eindeutig den Tätern zuzuweisen.
Kapitel 4 stellt die Odenwaldschule vor und beleuchtet das pädagogische Konzept sowie die Entstehung der Missbrauchsfälle.
Kapitel 5 zeigt die Medienberichte und gesellschaftlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen an der Odenwaldschule auf.
Kapitel 6 befasst sich mit Schutzkonzepten und Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Kindern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen sexueller Gewalt, sexueller Missbrauch, Täterstrategien, pädagogische Einrichtungen, Institutionen, Schutzkonzepte, Prävention, Odenwaldschule, Medienberichte, gesellschaftliche Konsequenzen und Reformpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah an der Odenwaldschule im Bereich sexueller Gewalt?
Über Jahrzehnte kam es zu systematischen Übergriffen durch Lehrer und Erzieher auf Schüler. Besonders unter dem Schulleiter Gerold Becker häuften sich die Fälle, wobei reformpädagogische Ideale missbraucht wurden.
Warum schwiegen die Opfer so lange?
Die Täter nutzten Strategien der Manipulation und emotionalen Abhängigkeit. Zudem gab es innerhalb der Institution eine Kultur des Wegsehens, die es Opfern fast unmöglich machte, Gehör zu finden.
Welche Rolle spielte die Reformpädagogik bei den Missbräuchen?
Elemente wie die „Nähe zum Kind“ und die Abgeschlossenheit der „Internatsfamilien“ wurden von Tätern instrumentalisiert, um Grenzen zu überschreiten und Schutzräume für Gewalt zu schaffen.
Wer ist Andreas Huckele?
Andreas Huckele (bekannt unter dem Pseudonym Jürgen Dehmers) ist ein ehemaliger Schüler und Hauptzeuge, dessen Berichte und Buch maßgeblich zur Aufdeckung des Skandals an der Odenwaldschule beitrugen.
Welche Schutzkonzepte gibt es heute gegen sexuelle Gewalt in Institutionen?
Moderne Konzepte setzen auf Prävention durch klare Verhaltenskodizes, externe Beschwerdestellen, Schulungen für Personal und die Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Sexuelle Gewalt am Beispiel der Odenwaldschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006833