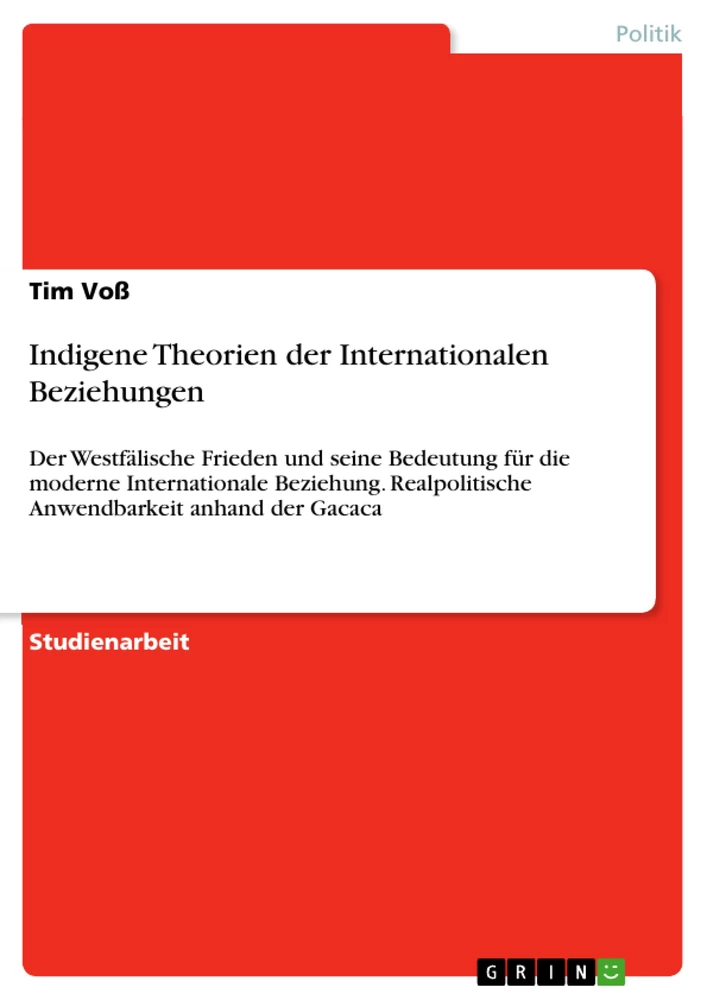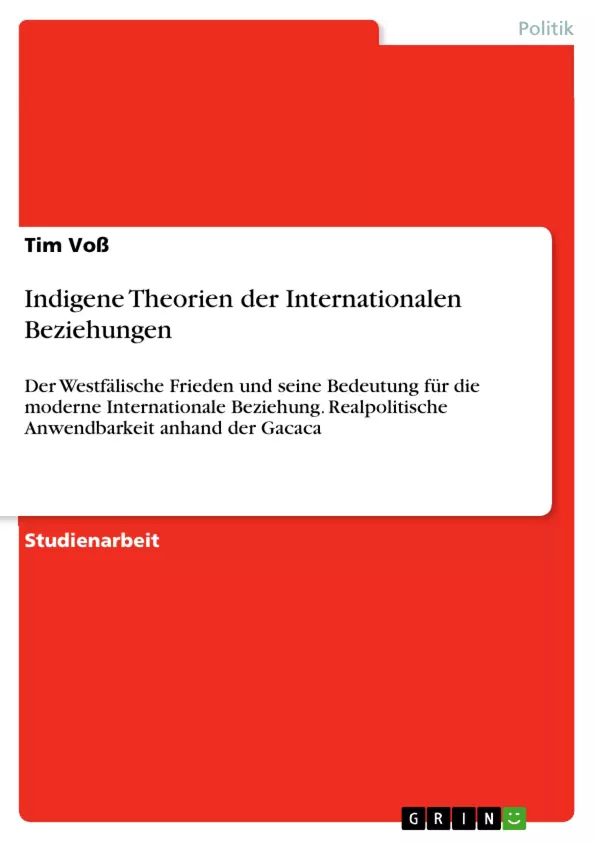Die Theorien der Internationalen Beziehungen (IB) platzieren die Geburt des souveränen Nationalstaatssystems in die frühen Stunden des modernen Kapitalismus und des Beginns der modernen Wissenschaft: ins Europa nach dem dreißigjährigen Krieg. Die Mehrheit der gängigen Theorien der IB projizieren ein westfälisches Staatsmodell, basierend auf den Regeln die dem, den dreißigjährigen Krieg beendenden, westfälischen Frieden zugrundeliegen. Ein roter Faden in der Disziplin der IB ist also zwangsläufig staatszentrisches Denken als Basis aller gängigen Theorien. Die Entwicklung Europas in der folgenden Aufklärung und der kapitalistischen Weltwirtschaft ist simultan mit jener, der europäischen Kolonialisierung der dritten Welt, der Versklavung indigener Völker und dem Aufkommen von patriarchalen Rassenstrukturen. Im Umkehrschluss lässt dies die Möglichkeit aus, nichtstaatliche Denkweisen zuzulassen. Andersartige, gesellschaftliche Organisationsmodelle werden ebenfalls selten validiert, entsprechen sie nicht mindestens einer staatsphilosophischen Grundannahme. Unter dieser Prämisse scheitert die Anwendung der IB in den meisten afrikanischen Regionen aufgrund kolonialistisch beeinflusster Staatenbildung, da domestische Politik hier häufig zur internationalen wird. Indigene Kulturkonzepte lassen sich nicht durch Grenzziehung kontollieren, das westfälische Konzept von Staatlichkeit und Souveränität macht Politik außerhalb dieser Parameter undenkbar. Weil aber indigenes Politikverständnis häufig Grenzen zwischen Autorität und Souveränität verschwimmen lässt, ist es nur schwer möglich diese Prozesse in herkömmliche, binäre Theorien der IB zu übersetzen. IB die von und für den Westen gemacht werden definiert aufgrund ihrer Vormachtsposition also das „Story-Telling“, indem unpassende Narrative nicht in den Kanon mit aufgenommen werden, hauptsächlich weil sie als prä-modern und damit prä-staatlich abgeschrieben werden. Erreicht wird dies durch den selbst-proklamierten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit der allerdings laut Patrick Jackson lediglich Räume der ästhetischen Exklusion kreiert und dazu dient das Feld der IB zu disziplinieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Westfälische Frieden und seine Bedeutung für die moderne IB
- III. Indigene Konzepte der IB
- 1. Die Exklusion der Maori
- 2. Die Guarani & Kaiowa
- 3. Ubuntu
- IV. Realpolitische Anwendbarkeit am Beispiel der Gacaca
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des westfälischen Staatsmodells auf die Internationale Beziehungen (IB) und analysiert, wie indigene Konzepte und Perspektiven in diesem Kontext ausgeschlossen werden. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung der IB-Theorien, die hauptsächlich auf dem westfälischen Frieden und seinem Prinzip der staatlichen Souveränität basieren. Die Arbeit stellt die Frage, wie diese eurozentrische Perspektive indigene Gesellschaftskonzepte und politische Ordnungen ignoriert und welche Folgen dies für die Analyse und Gestaltung internationaler Beziehungen hat.
- Der Westfälische Frieden und seine Bedeutung für die moderne IB
- Die Exklusion indigener Konzepte in der IB
- Ontologischer Kolonialismus und die „ästhetische Exklusion“
- Die Bedeutung indigener Perspektiven für die Analyse von Globalisierung und Interdependenz
- Alternative politische Ordnungen und gesellschaftliche Organisationsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung erläutert den Ausgangspunkt der Arbeit: die eurozentrische Ausrichtung der IB-Theorien, die auf dem westfälischen Frieden und der Staatlichkeit basieren. Sie stellt die Frage nach der Exklusion von indigenen Konzepten und Perspektiven und argumentiert, dass diese Auslassung zu einem fehlenden Verständnis der internationalen Beziehungen führt.
II. Der Westfälische Frieden und seine Bedeutung für die moderne IB
Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des westfälischen Friedens und seine Auswirkungen auf die Entwicklung des modernen Staatensystems. Es beleuchtet die Bedeutung des Friedens für die Entstehung von Souveränität und Territorialität und analysiert, wie diese Konzepte in der IB-Theorie verankert sind.
III. Indigene Konzepte der IB
Dieses Kapitel stellt verschiedene indigene Konzepte der IB vor, die sich von dem westfälischen Modell unterscheiden. Es analysiert die Exklusion der Maori, der Guarani & Kaiowa und das Konzept von Ubuntu, um die Diversität indigener Perspektiven auf die internationalen Beziehungen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen und Themen: Internationale Beziehungen, Westfälischer Frieden, Staatlichkeit, Souveränität, Indigene Konzepte, Ontologischer Kolonialismus, Ästhetische Exklusion, Globalisierung, Interdependenz, Symbiose, Reziprozität, Ubuntu, Guarani & Kaiowa, Maori.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Bedeutung des Westfälischen Friedens für die IB?
Der Westfälische Friede gilt als Geburtsstunde des modernen, souveränen Nationalstaatssystems. Die meisten Theorien der Internationalen Beziehungen (IB) basieren auf diesem staatszentrischen Modell.
Warum werden indigene Konzepte in der IB oft ignoriert?
Indigene Denkweisen entsprechen oft nicht dem westfälischen Staatsmodell. Da sie Grenzen zwischen Autorität und Souveränität verschwimmen lassen, werden sie häufig als "prä-modern" oder "prä-staatlich" abgetan.
Was versteht man unter "Ubuntu" im politischen Kontext?
Ubuntu ist ein afrikanisches Philosophiekonzept, das Menschlichkeit und Gemeinschaft betont. In der IB bietet es eine alternative Sichtweise auf Kooperation und Zusammenleben jenseits westlicher Machtpolitik.
Was bedeutet "Ästhetische Exklusion" in der Wissenschaft?
Nach Patrick Jackson dient dieser Anspruch auf Wissenschaftlichkeit dazu, das Feld der IB zu disziplinieren und Narrative auszuschließen, die nicht in das westliche Schema passen.
Welche Beispiele für indigene IB-Konzepte werden genannt?
Die Arbeit nennt unter anderem die Konzepte der Maori, der Guarani & Kaiowa sowie das Ubuntu-Prinzip als Beispiele für alternative politische Ordnungen.
- Quote paper
- Tim Voß (Author), 2018, Indigene Theorien der Internationalen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007128