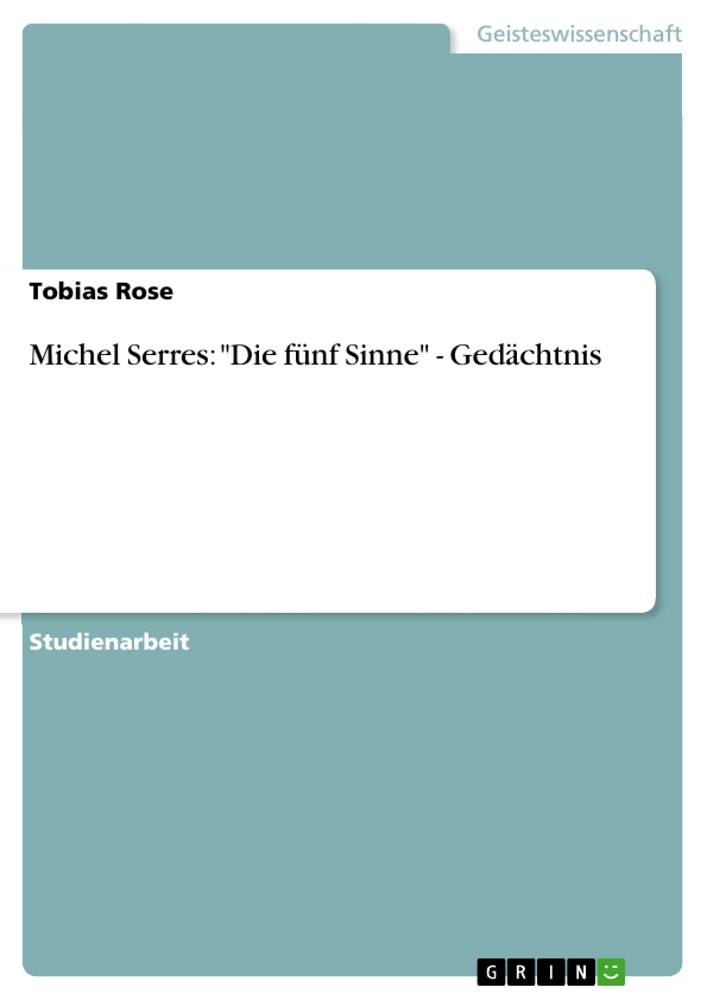Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwimmen, in der Wissenschaft nicht länger ein hierarchisches Gebilde, sondern ein dynamisches Netzwerk der gegenseitigen Durchdringung ist. Michel Serres entwirft in „Die fünf Sinne – Eine Philosophie der Gemische und Gemenge“ eine solche Welt, eine Philosophie des Transports, in der die traditionelle Analyse durch ein Verständnis von Relationen und Verschaltungen ersetzt wird. Das Subjekt verliert seine Vormachtstellung, während eine objektive Intelligenz erkennbar wird, in der menschliche Rationalität nur einen Spezialfall darstellt. Serres untersucht das Gedächtnis nicht als statische Akkumulation von Wissen, sondern als ein Produkt der Komplexität, ein "objektiv Transzendentales", das sich wie eine Matrix über die Dinge legt. Der Geruch, als spezifische und lokale Sinneserfahrung, wird zum Schlüssel, um diese objektive Intelligenz anzuzapfen, die Ebene, in der die Dinge sich gegenseitig informieren. Im Kontrast dazu steht das kulturelle Gedächtnis, das durch Wiederholung erzeugt wird und ein kollektives "Wir" formt. Serres vergleicht das Gastmahl Platons, ein Sinnbild des klassifizierenden Denkens, mit dem Abendmahl Jesu, einem Topos des zirkulierenden, verschmelzenden Denkens. Während im platonischen Gastmahl jede Figur ihren festen Platz in der Hierarchie einnimmt, repräsentieren die Jünger Jesu ihre Individualität und ermöglichen so den Informationsfluss. Das Archiv, traditionell ein Raum der Akkumulation, muss sich in ein dynamisches Dispositiv der Echtzeit verwandeln. Die Serressche Philosophie strebt nach einem Naturalismus, in dem Kultur als ein Effekt des Zusammentreffens von Subjekt und objektiver Komplexität entsteht. Seine Kritik richtet sich gegen die Vormachtstellung des Wortes, das die Dinge zu Zeichen reduziert und ihre komplexe Verknüpfung verkennt. Die Idee des Staates, basierend auf einem schriftlichen Vertrag, wird durch die Erkenntnisse der Wissenschaft relativiert. Entdecken Sie eine neue Perspektive auf Wissen, Kommunikation und die Welt, die uns umgibt – eine Welt der Gemische und Gemenge, in der die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwimmen und das Unerwartete zum Erkenntnisgewinn führt. Tauchen Sie ein in Serres' komplexes, aber lohnendes Werk und lassen Sie sich von seinen Ideen inspirieren, die unser Verständnis von Wissenschaft, Kultur und Gedächtnis revolutionieren könnten. Ein Muss für alle, die sich für Philosophie, Wissenschaftstheorie und die Zukunft des Wissens interessieren. Wagen Sie den Schritt in eine Welt, in der das Denken selbst zur Struktur wird und die Analyse durch ein tiefes Verständnis der Verbindungen ersetzt wird.
Einleitung - Komplexität und Kommunikation
In seinem Buch „Die fünf Sinne- Eine Philosophie der Gemische und Gemänge“1, führt Michel Serres das Projekt einer Philosophie des Transports weiter, deren Sprache „mehrere Eingänge haben muß“, um die theoretische Komplexität, als wissenschaftstheoretische Praxis fassen zu können und somit den theoretischen Rahmen für die gegenseitige Durchdringung der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, zu erarbeiten, welche, nach den Ausführungen Richard Jochums für Serres „ [...]kein Anspruch, keine Forderung oder ein Programm“ ist, „ sondern, was einen Unterschied macht, gängiger Usus der Wissenschaftspraxis, auf die lediglich die Theorie nur noch nicht angemessen genug reagiert hat“2. Es besteht für Serres also ein sogenannter Aufholbedarf des Selbstverständnisses im wissenschaftlichen Diskurs, durch den die traditionelle Doktrin einer zentralistisch, oder hierarchisch geordneten Wissenschaftslandschaft, zugunsten einer wissenschaftlichen Praxis aufgegeben werden sollte, die in der gegenseitigen, dynamischen Durchdringung der einzelnen Disziplinen, für die er den Begriff der Passage benutzt, wie ein Netzwerk funktioniert, daß wiederum nicht statisch, sondern einem ständigen Veränderungsprozeß unterworfen ist. Für Serres sind aber nicht die sich daraus ergebenden Wissensräume, innerhalb derer sich Wissen akkumulierte bzw. deren Grenzen von Interesse, um Komplexitäten analysieren zu können, sondern „der gefaserte Raum als solcher, den die Maschen des Netzes erzeugen“, wird von ihm untersucht, wodurch „die Knotenpunkte nichts anderes als die Gebiete selbst“3 sind, in denen Kommunikation stattfindet. Wissensräume sind für Serres Verknüpfungen, die sich aus der Konfiguration anderer Wissensräume und Ebenen ergibt, die wiederum selber keinen kontinuierlichen Raum determinieren, sondern temporäre Orte der Wissensverschaltung darstellen. Daraus folgt; Verschaltungen stellt an sich Wissen dar. Insofern wird es auch fraglich, ob der Begriff der Analyse, insofern dieser das zerkleinern, auseinanderlegen, zergliedern von zu untersuchenden Materialitäten meint, in dieser Form zutreffend ist. Denn das was zergliedert wird, sind Verschaltungen mit dynamischem Charakter. Man kann in diesem Zusammenhang auch von Relationen sprechen, die Wissen erzeugen, oder hervorrufen. Die Problematik dabei besteht jedoch gerade in der Analyse von Relationen, da diese aus ihrer Konfiguration gerissen, vielleicht noch einzelne Beziehungsstränge nachvollziehen lassen, jedoch das eigentlich produzierte Wissen nicht mehr nachvollziehbar wird, wenn man von der genannten These ausgeht, daß die Verschaltung selber Wissen ist. In diesem Sinne spricht Serres auch vom Fehlen der Referenz und Substanz, wenn er von der „Unerläßlichkeit“ spricht „eine Philosophie der Kommunikation zu schaffen, in der die Enzyklopädie ihren Ausdruck findet und die darstellt, was sie ist, geradeso wie sie die Welt zum Ausdruck bringt, die Welt, wie sie ist und wie die Wissenschaften sie lesen oder begründen,...“4.
Innerhalb der Theorie der Relationen, die zu schreiben Serres eigentliches Projekt darstellt, „verliert das Subjekt seine Vorteile“. Durch die Produktion von Passagen, die den Übergang des Globalen in das Lokale (oder umgekehrt) nachvollziehbar werden lassen, wird die Existenz einer objektiven Intelligenz erkennbar, innerhalb derer „die menschliche Intelligenz nur ein winziger Teil, [...]das Rationale ein Spezialfall des Realen, die Ordnung eine lokale Ausnahme in einem Meer von Unordnung“5 darstellt.
Folgende Frage muß gestellt werden: Wer erkennt?
Heutzutage besteht die Notwendigkeit nicht mehr unbedingt darin, die Dinge zu informieren, um das gesellschaftliche Umfeld zu generieren und Wissenschaft betreiben zu können. Ein relationäres Netzwerk, informiert sich selbst, bzw. die darin befindlichen Dinge unterliegen einem ständigen Dialog. Somit wird das Subjekt selbst zu einem informierten Ding, das „das theoretische Wissen, das embryonale Gemurmel der Objekte, die denkende Intersubjektivität“ anzapfen kann. So lautet für Serres die Antwort: „Das erste Netz erkennt ein zweites“6. Die Strategie der Reduktion durch Klassifikation muß aus diesem Grund aufgegeben werden, da in diesem Fall die Analyse von Wissen wieder auf ein Referenzobjekt abzielen würde, um diese zu rechtfertigen, wodurch das Umfeld der Verschaltung, woraus dieses Wissensobjekt hervorgeht, außerhalb des Betrachtungswinkels geriete und somit Informationsverlust die Folge wäre. So schreibt Serres: „Wenn das Problem der Reduktion sich auflöst, bleibt die Tra-duktion, die Übersetzung; wenn das Problem der Produktion verschwindet, bleibt die Kommunikation. Wenn das Problem der Referenz sich erschöpft, bleibt die Interferenz.“7 Wissen stellt demnach die Produktion von Überlagerungen dar, das als Konfiguration diskursiver Knotenpunkte operiert und aus der Sprache der objektiven Interferenzen, in die Sprache der theoretischen Interferenzen übersetzt werden muß.
Im Folgenden werde ich versuchen, das Kapitel „Gedächtis“ aus dem Eingangs erwähnten Buch Michel Serres` auf diese Aspekte hin zu untersuchen, um im Anschluß daran, auf die Frage einzugehen, inwieweit der Autor produktionsorientiert und nicht kritikorientiert schreibt, wonach er die Verbindung, oder auch Passage zwischen den „feinsinnig und loyal beobachtenden Naturwissenschaften“ und den überwachenden Humanwissenschaften zu finden versucht, bei denen er „vehement den Verlust von Welt, Objekt und Natur“8 kritisiert.
Kapitel: Gedächtnis
Das Kapitel, daß der Produktion von Gedächtnis gewidmet ist, beginnt mit der Frage nach dem Nullpunkt der sinnlichen Wahrnehmung. Zunächst wird angenommen, daß das Wasser diese Metafunktion übernähme, ähnlich dem „intelligible Raum Platos“, der die Ideenwelt darstellt, die dem Geist die Sicht auf das Metaphysische erlaubt. Diese These wird jedoch aus Gründen der materiellen Charakteristika des Wassers aufgegeben, da „das Wasser durchaus Geschmack und Farbe hat; wir spüren seine Nähe am Geruch, und mit geschlossenen Augen unterscheiden wir zwei Dutzend Geschmacksnuancen, stehendes, fließendes, stilles Wasser, solches aus der Stadt und solches aus den Bergen.“9 Es stellt also nicht die Materialität dar, die als Träger von Information, nicht selber informiert ist und dadurch eine freie Sicht auf die Relationen zwischen den Dingen zuließe. Denn durch die genannten Charakteristika „verschiebt sich der Nullpunkt“. Was entsteht, ist Rauschen. Demgegenüber scheint die Luft besser geeignet, um diese Systematik zu verdeutlichen. Ihre Neutralität zeigt sich anhand ihrer Nichtortbarkeit infolge von Allwesenheit, die dazu bestimmt ist, durch Materialitäten in Bewegung versetzt und diese selber in Bewegung zu versetzten - Träger, aber nicht Manipulator zu sein. Die Materialität der Luft stellt in diesem Zusammenhang das Ereignis der Dynamik selbst dar, die Komplexität, die alles miteinander in Beziehung setzt bzw. reine Beziehung ist10, „Grundmasse der Gemische“, und dadurch für ihn zum wichtigen Ausgangspunkt seiner Philosophie der Kommunikation wird, die „ohne Substanz, daß heißt ohne Festigkeit und Referenz ist“11. So bestimmt Serres schon in dem ersten Abschnitt dieses Kapitels das Gedächtnis als ein Produkt der Komplexität, als ein „objektiv Transzendentales“, daß sich wie eine Matrix über die Dinge und die dingabhängigen Subjekte legt und nicht Ergebnis subjektiver Intelligenz ist.
Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Geruch, als Verbindungsmedium zwischen der Umwelt und den Subjekten. Dazu ist es erforderlich, Serres Begriff der Kommunikation als Anlehnung an die physikalische Perspektive von Teilchenrelationen zu betrachten, in der es eben Festkörper sind, die in Relation miteinander stehen und nicht Aussagen (z.b. Zeichen), als Produkte des immateriellen, subjektiven Verstandes. Hierdurch wird die Eingangs erwähnte „Passage“ zwischen den Humanwissenschaften und den exakten Wissenschaften „befahren“, in der Kommunikation „im Sinne einer physikalischen Theorie der Ausbreitungsphänomene“12, auf das Gebiet der Sozial- und Kulturwissenschaft übertragen wird. Insofern ist die Kritik einer Wissenschaft gewidmet, die Serres daran festmacht, sich vorrangig mit Phänomenen der Optik und Akustik zu beschäftigen, wobei die nasale Ebene der epistemologischen Betrachtung aus der Sicht geraten ist. Dazu führt er Träger von Informationsmustern an, die in der Optik und Akustik vorkommen, wie die Form der Melodie und des Akkordes; Formen also, die wiederkehrende Relationsmuster auftreten lassen, in Verbindung mit den Subjekten. Die Konfiguration der Form, eine Struktur, die nach Serres als lokale Komplexität bezeichnet werden könnte, setzt ihre innere Konfiguration in der Verbindung zum kulturellen Diskurs (zu dem sie gehört) durch und überformt diesen, indem sie die Gegenwart rhytmisiert (die dadurch immer schon Vergangenheit ist), und auf diese Weise kulturelles Gedächtnis erzeugt.
Der Geruch unterscheidet sich demgegenüber, durch die Lokalität in Form von Spezifität. Die kognitive Entwicklung des Gedächtnisses tritt hier in Folge der Ungleichgewichtfunktion auf, die die symbolische Form Geruch im Verhältnis zu den ebenfalls symbolischen Formen Melodie und Akkord aufweist. Das Relationsmuster des Geruchs ist instabil, da es sich aus Materialitäten zusammensetzt, die schon ausserhalb des Subjektes ein hohes Maß an Komplexität bilden. So ist auch die Metapher des Bouquets auf die plurale Zusammensetzung dieser lokalen Konnexionen hin gerichtet, diesem zufälligen Ereignis der Ordnung innerhalb des umgebenden Rauschens.
„Der Gleichgewichtsfall wird zu einem singulären Ereignis “13 (die Wiederkehr ist Ereignis, unabhängig des wiederkehrenden Inhaltes). Es stehen sich also zwei Gedächtnisformen gegenüber; das Gedächntis, das durch die symbolische Form der Wiederkehr erzeugt wird, wodurch kulturelles Gedächtnis erst möglich wird, da sie auf die Intersubjektivität eines Subjektverbundes wirkt, indem ein wir erzeugt wird; und Gedächtnis als Produkt einer unwahrscheinlicher wiederkehrenden Konfiguration von Teilchen, die im Subjekt Erinnerung hervorruft, indem sie „ekstatisch blendet, aufgrund ihrer Nähe“14. Dieses Charakteristikum des Geruchs, wird jedoch durch die zunehmende Wiederkehr von Inhalten, also verschiedenen Geruchsnuancen modifiziert, welche die gegenwärtige kulturelle Überformung des Subjektverbundes hervorruft („Gestank inmitten des Lärms“). Das kulturelle, intersubjektive Gedächtnis überformt das spezifische, subjektive Gedächtnis. Doch gerade in der letztgenannten Gedächtnisform sieht Serres die Möglichkeit, „objektive Intelligenz“ anzapfen zu können, also die Ebene, in der die Dinge sich gegenseitig informieren, die Perspektive der Physik, im Gegensatz zur humanwissenschaftlichen Perspektive. So stellen sie einander konkurrierende Wissenschaftskulturen dar. Dieses Konkurrenzverhalten ist es, das nach Serres abgebaut werden muß, um komplexe Zusammenhänge im gesellschaftstheoretischen Diskurs zu erkennen. Hiermit wird eine Archäologie beschrieben, die Ereignisse untersucht, deren Voraussetzung die Offenheit von Systemen ist, welche wiederum die Eingrenzung der selben bewirkt und somit Erkenntnis ermöglicht.
Dies dreht er im vierten Abschnitt wiederum um, wonach die Einbalsamierung der Toten die Stauung des Geruchs bewirkt, also die Begrenzung einer lokalen Komplexität. Dadurch wird verdeutlicht, daß erkannte Konnexionen also Strukturen durch ihre Umgebung begrenzt sind, insofern Systeme abgegrenzt werden, indem sie sich öffnen. Der Geruch bildet die nicht analysierbare Umgebung der Dinge, die das Globale der Teilchenbewegungen (Chaos, objektive Intelligenz) mit dem Lokalen im Falle des Wiedererkennens verbindet.
Anhand dieser Unterscheidung werden zwei Arten von Wissen miteinander verglichen. Das Wissen, das durch das kulturelle Gedächtnis hervorgerufen wird, indem die Wiederholung dieses determiniert, und Wissen, welches unanalysiert und unreduziert, gleich einem chaotischen Punkt, inmitten von Rauschen Interferenzmuster hervorruft (Ort des Wiedererkennens, Ordnung innerhalb der Mischungsverhältnisse), die auf das Subjekt treffen und erst dadurch Gedächtnis produzieren. Für Serres stellt sich hierdurch eine Verbindung zwischen Raum und Zeit her, wobei der Raum den Topos des Analytischen, „der Operationen des Unterscheidens“ darstellt und die Zeit als Ebene der „direkten Operationen des Mischens“15 fungiert.
Der Duft bildet diesen kritischen Punkt, diese Interferenzinseln der Ordnung im Rauschen der Gerüche, indem er „Geist“ wird, also Erinnerung hervorruft.
Wie das Phänomen der Liebe, dieses unteilbare Gefühl, absorbiert der Duft das Subjekt, zieht es an sich und lässt es wissen, aufgrund dessen, daß dieser Zustand nicht herleitbar und dementsprechend nicht analysierbar ist. Dieser Zustand verkündet nicht mehr, als seine bloße Anwesenheit und verschwindet dort, wo versucht wird, ihn zu hinterfragen und abzuleiten. Demzufolge bildet Wissen, welches durch Anwesenheiten (unteilbare Konfigurationen) hervorgerufen wird, die Schnittstelle zum objektiven Aussen (dessen Inhalt wir darstellen), das in seiner Ganzheit zwar nicht erfasst werden kann, aber den epistemologischen Blick auf die Dinge selber richtet, wodurch die kulturelle Übercodierung der Realität eingeschränkt werden und der Bezug zum In-der-Welt-sein der erkennenden Subjekte verstärkt werden soll.
„Die Ausdünstung deines Körpers nannte meine Sprache einst `Geist´. Die heutige Sprache nennt sie ihrer aseptischen Art `Geruch´; ihr etwas griesgrämiges Wissen (kulturelle Überformung) sagte statt dessen `Parfüm´. Damit gibt sie zu verstehen, daß Geruch sich zu Parfüm verhält wie Gabe zu Vergebung.“16 Die kulturelle Überformung wirkt ausgleichend, die Singularität des Gegebenen ruft Ungleichgewichte hervor, die als Ereignisse zum Subjekt gelangen. In diesem Sinne wird Gabe von Vergebung unterschieden. Die Vergebung ist ein Akt des kulturellen Konsens infolge eines Gesellschaftsvertrages. Sie produziert ein Gleichgewicht z.b. zwischen Gläubiger und Schuldner und unterdrückt somit den Konflikt (das lokale Ereigniss), bzw. löst diesen auf. Ich vergebe (erlasse) jemandem seine Schuld mir gegenüber und drücke damit meine Überlegenheit und damit ein Mehr an Macht und Mitteln aus, daß durch das Wort („Ich vergebe dir“) dem Schuldner gegenüber kenntlich gemacht wird und einen Ausgleich produziert, indem es von der Position des Plus an Macht ausgesprochen wird und das Minus an Materialität (die Schuld) beim Gläubiger selber tilgt. Das Wort tritt an die Stelle des Soll und gleicht es aus, indem es ein im Vergleich dazu größeres Haben indiziert. Mit diesem Vorgang wird ein sich selbst regulierendes System (Gläubiger) kenntlich gemacht, daß autopoietisch handelt, infolge einer kulturell determinierten Konvention, dem Gesellschaftsvertrag. So ist denn auch Serres Formulierung zu verstehen, nach der Sie (die Sprache) über das Gegebene, das Sublime hinausgeht, bzw. dieses zur Unkenntlichkeit reduziert; „In allernächster Nähe des geliebten Körpers ersetzt die Sprache das Gegebene durch eine Formel.“17 Das Problem, daß sich für Serres damit ergibt, besteht in der Doktrin der Sprache, die aus ihrer eigenen Form heraus differenzierend auf die Dinge einwirkt und diese dadurch nicht in ihrer Komplexität erkennt, so daß „das Bett obszön auf die Straße fällt oder sich auf dem Bildschirm ausbreitet“. Somit wird das Singuläre der Liebe durch deren Aufzeichnung und das Singuläre des Duftes durch die synthetische Herstellung von Parfüm unter die Form der Wiederholung gedrängt, die eben diese Singularitäten zugunsten einer Universalität, der der Konsumtion, ausschließt.
Die Konfusion jedoch verbindet das Subjekt mit der Welt. Wird diese ausgeschlossen, entsteht Distanz zwischen beiden, die zu Unverständnis führt. Da die Welt aus Komplexitäten besteht und die Subjekte in ihr leben, führt diese Tendenz zum Unverständnis der Subjekte gegenüber sich selbst, welches ein existenzielles Problem darstellt.
Im Gegensatz zu Descartes, existiert für Serres ein direkter Zusammenhang zwischen der immateriellen Seele und dem sich in Raum und Zeit befindlichen Körper. Die Seele ist hierbei, ähnlich wie der Geruch, die Schnittstelle zwischen der, dem Subjekt nicht direkt zugänglichen Komplexität der sich gegenseitig informierenden Dinge in der Welt und dem subjektiv Singulären. Sie bedingt die präskriptive Aufnahme von Ereignissen im Subjekt, ermöglicht also das Wiedererkennen von Situationen, wie z.b. einen in der Vergangenheit aufgetretenen Duft. Es handelt sich hierbei um die komplexe Konstitution des Subjektes, in der Erkennen als Wiedererkennen möglich ist und Gedächtins konstituiert; in dem singuläre Konnexionen verglichen, kombiniert und auch synthetisiert werden können, wie es in Abschnitt IX. angeführt wird. Die Luft, der Wind stellen Objekte der Physik dar. Sie übernehmen die Funktion der Reiz- oder Signalübermittlung, insofern sie „Träger zu ihnen allen“ sind. Die Seele hingegen, als „Träger von allen“, bedingt die subjektive Gedächtnisfunktion. Sie konzentriert sich dort, wo Gedächtnis stattfindet und befähigt das Subjekt zur sinnlichen Verarbeitung dieser Signale.
Auch dieser Zusammenhang weist auf die angestrebte Passage zwischen den Natur- und Humanwissenschaften hin. Die Naturwissenschaften „übermitteln“ Signale aus der objektiven Komplexität (Welt), anhand exakter Messungen. Die „Verarbeitung“ dieser Signale in den Humanwissenschaften führt nach Serres zu verstärkter Objektbezogenheit, die diesen seiner Meinung nach abhanden gekommen ist.18 Das Beispiel des Weinkenners verdeutlicht dies noch, indem auf jene Präzision der sinnlichen Wahrnehmung insistiert wird, „die sonst nur den Ideen zugestanden werden, jene Höchstleistungen, von denen die Sprache sagt, nur sie sei dazu fähig.“19
Der Abschnitt X. verknüpft, für die abendländische Kultur bedeutende Gastmähler, die verschiedene Zugänge zum kulturellen Diskurs und in ihrer jeweiligen diskursiven Konfiguration auch verschiedene Modelle der Wissenszirkulation vorstellen. Das Gastmahl des Platon wird hierbei anhand der Figur des Sokrates zum Manifest des klassifizierend - hierarchisierenden Denkens, das Serres dem Abendmahl Jesu, als Topos des zirkulierenden, verschmelzenden Denkens gegenüberstellt, welches nur über das Andenken nachvollzogen werden kann. Das Gastmahl Platons wird hier als statisches Bankett dargelegt, in dem jede anwesende Figur, ihren festen Platz im „physischen“, wie auch im sozialen Sinne einnimmt. Es entsteht also eine Sitzordnung, die der Äußerlichkeit, oder besser dem sozialen Status entspricht, aus dem die betreffenden Figuren nicht ausbrechen können, selbst wenn sie wollten. Die äußere Statik verhält sich semantisch zur figurativen Statik, die ein hierarchisches Gebilde entstehen lässt, in dem die Anwesenden eingebunden sind und ohne dieses sie auch nicht sprechen könnten. Der Austausch von Informationen findet unter der Prämisse von Referenz und Abgrenzung statt, womit Serres die traditionelle Denkweise der Wissenschaft anführt. Die semantische Ordnung der Figuren findet ihre allegorische Entsprechung in der Philosophie des Sokrates, welcher die wichtigste Figur in diesem literarisch-philosophischen Werk sowie allgemeiner in der Philosophie Platons einnimmt.
Sokrates Denken konzentriert sich auf die Frage nach der Möglichkeit der objektiven Selbsterkenntnis. Dabei geht das sokratische Denken davon aus, daß der Begriff eines Wertes, dem eigentlichen Wert, woran sich die einzelnen Subjekte orientieren und gemessen werden können, vorausgehen muß, um objektiv zu sein. Diese Problematik ergibt sich z.b. aus der Frage nach einem abstrakten Begriff, wie Freundschaft. Diese kann nicht aus den ihr äußerlichen Charakteristika abgeleitet werden, da diese jeweils subjektiv ausfallen und somit kein allgemeingültiger Nachweis für die Wesensform der Freundschaft erbracht werden kann. Es stellt sich also die Frage, wie dieser Wertmaßstab erlangt werden kann. Dies ist im Sokratischen Denken entscheindend für die gesellschaftliche Funktionstüchtigkeit der Polis, indem die Gesamtheit der Einzelindividuen zum Guten (Tugendhaften) streben muß, so daß dieses Gesellschaftssystem seiner ideelen Form gemäß existieren kann. Dem gegnüber steht jedoch die Divergenz zwischen der individuellen Vorstellung vom Guten, aus dem das gesellschaftliche Geschick sich ergibt und dem tatsächlichen gesellschatflichen Ergebnis (welches angestrebt wird). Das Auseinanderfallen der Einzel- und Gesellschaftsinteressen fällt also mit dem Problem der Erkenntnis abstrakter, allgemeingültiger Wertbegriffe zusammen, die als Maßstab subjektiver Intentionen gelten könnten, bzw. diese zu steuern vermögen. Zusammengefasst heißt das, daß der Begriff unabhängig des zu erkennenden Gegenstandes erfasst wird, bzw. die Begrifflichkeiten nicht direkt vom Gegenstand ableitbar sind. Bei Platon bleibt diese Fragestellung zentral und wird zum allgemeingültigen Diskurs ausgeweitet, also nicht nur auf Fragen der Ethik begrenzt und somit ontologisch abgestützt; „In der materiellen, empirischen Welt sind die gesuchten Werte nicht zu finden. Also können sie nur in der ideellen, nur dem Denken zugänglichen Welt, in der Welt der Ideen geschaut werden.“20 Die Bedeutung der Platonischen Philosphie besteht in der Begründung des „objektiven Idealismus“, auf dessen Problematik des Auseinandertretens von ideeller und sinnlich-wahrnehmbarer Welt und dem Modus der Klassifikation Serres sich bezieht.
Anders als im Gastmahl Platons verhält sich das Individuationsprinzip der Anwesenden des Abendmahls der Eucharistie. Während nach den Darstellungen Serres die Figuren des Gastmahls als bloße Stellvertreter ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Funktionen fungieren und sich dadurch der Verlust der Individualität ergibt, so daß sie über die Liebe nur sprechen, ohne sie zu erleben (Sokrates), repräsentieren die Jünger Jesu ihre jeweilige Individualität, indem sie „[...]trinken, um zu trinken. Um zu kosten. Sie trinken und kosten schweigend.“21 Das Schweigen lässt sie Subjekte sein, innerhalb der Gemeinschaft. Nur dadurch kann der Wein zirkulieren, kann sich dt der Wein dabei die Funktion einer Informationseinheit, die auf offene, wenig formalisierte bzw. nicht formatierte Systeme (Jünger) trifft, womit ein Zustand beschrieben wird, der für die Wissenschaftstheorie Serres von zentraler Bedeutung ist. In dem 1. Kapitel des Buches „Hermes II. Interferenz“22 äußert sich der Autor zur Problematik der Möglichkeit einer peripheren Beobachterposition (Wissenschaft der Wissenschaften), von welcher aus die dikursive Konfiguration von Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet werden kann, sozusagen eine Landkarte des Wissens erstellt werden könnte. Diese Möglichkeit wird jedoch ausgeschlossen, aufgrund dessen, daß „der Raum der Wissenschaft in sich selber geschlossen ist“23. Es existiert insofern kein peripherer Ort der Betrachtung. Die Enzyklopädie (als Allegorie der Einheit der sich schreibenden wissenschaftliche Diskursvernetzung) nimmt jede Äußerung, die über sie gemacht wird wieder in sich auf, negiert diese also, indem sie innerhalb der Diskursvernetzung ihre Autonomie (die sie nicht haben kann, da sie geschrieben/gewusst wurde) „verliert“. Das von der Epistemologie zu betrachtende Objekt/Relation stellt für Serres die „blinde Ordnung“ dar. Er schreibt: „Die Involution einer globalen Theorie zu einer lokalen, in einer blinden und in sich geschlossenen Ordnung angesiedelten Wissenschaft, [...] schließt die Möglichkeit aus, daß die Enzyklopädie sich selbst vollkommen transparent würde, führt zu einem residualen Unbewußten,...“.24 Dieses residuale Unbewußte stellt die reine Struktur der Relationen dar, durch welche Wissen ausgetauscht wird, den Transmitter von Aussagen, oder die Schalteinheit, die Aussagen erst ermöglicht. Die Untersuchung dieser Effekte stellt Serres als Anspruch, an eine zukünftige Epistemologie dar, wenn er schreibt: „Ich behaupte, der zentrale Gegenstand der Epistemologie ist mehr noch vielleicht als die Wissenschaft selbst das Ungewußte der Wissenschaft, zumindest wenn sie sich weigert, die bloße Kopie jener regionalen Epistemologie zu bleiben, die jede Wissenschaft [...] heute von sich selbst entwickelt“25. So kann er auch behaupten, daß „um dem Labyrinth zu entkommen, den Knoten mit einem Streich zu durchschlagen, spricht, wer von der Wissenschaft spricht, vom Nichtwissen her, mit Blick auf das Wissen der Wissenschaft“26.
In diesem Sinne sind die Jünger des Abendmahls geradedurch ihr Nichtwissen (sie sprechen nicht) dazu befähigt, dem Wein als indizierendem Transmitter ihrer Zusammenkunft seine Information (Geschmack) und deren Funktionalität zu entlocken, wodurch die Verschiedenheit der Individualitäten zugunsten der Intersubjektivität aufgegeben wird, oder um es anders auszudrücken; die individuelle Vorstellung des Guten und Schönen (das Tugendhafte an sich) wird zum Allgemeingut durch die Transzendenz der Intersubjektivität, wodurch die Divergenz zwischen dem subjektiv Guten und dem gemeinschaftlichen Ergebnis gegen Null tendiert. Der Begriff formt sich aus der verbindenden Relation, der Möglichkeit der Übertragung durch eine allgemeine Form (Wein), die wiederum die Gesamtheit der zu ihrer Existenz erforderlich gewesenen Informationen anwesend sein läßt. Das, was das platonische Denken anhand von idealistischer Begriffsbildung, Klassifikation und hierarchischer Unterteilung, als Metaphysik, nicht vollbringt (den Rückbezug ideeller Begriffe auf die gesellschaftliche Praxis), vollzieht Serres Auffassung nach die Philosophie des Transports, die Perspektive der reinen Struktur, die einer filigranen Anwesenheit gleich, inmitten des dynamischen Prozesses der Aussagenverschaltung ihren Platz einnimmt und somit in direktem Bezug auf die in Wechselwirkung stehenden Objekte (Wissenschaften, Personen des Abendmahls) fungiert und betrachtet werden kann. In diesem Sinne ist es auch zu verstehen, wenn Serres von der „zum Subjekt gewordenen Relation“27 spricht, die nur über das tatsächliche Handeln der Gemeinschaft (Weiterreichen des Weinkelches) erzeugt werden kann und somit immer wieder erzeugt werden muß. Es erhebt sich somit der Anspruch, daß jegliche Betrachtung, wiederum bewußt als Teil der Übertragungen begriffen wird.
Das Archiv als Produkt des klassifizierenden Denkens und Beobachtens muß selber an diesen dynamischen Prozeß angekoppelt werden, indem es den Status eines bloßen Akkumulationsraums verliert und infolge des Dispositivs der Echtzeit transformiert wird; um es mit den Worten Foucaults zu paraphrasieren - „Die Bibliothek /muß/ steht in Flammen /stehen/“28.
Die aus Dokumenten hergeleitete Geschichte wird den zu bestimmten Zeiten aufgekommenen Relationsmustern entgegengestellt; die Wiederkehr von Aussagen den Strukturen29, die diese Aussagen ermöglichten. Die Aussage ist passiv, insofern sie übernommen, kopiert oder rezitiert wird und so zu einer Kultur prägenden Aussage wird (je öfter, desto sicherer). Die Struktur hingegen muß aktiv erzeugt werden, da sie nicht die Aussagen repräsentiert, sondern deren Verhältnis untereinander. Würde sie selber zum Diskurs (in Sprache verwandelt werden), wäre sie nicht mehr Struktur, sondern selber Aussage und insofern der Philosophie des Transports nicht zugänglich.
Das XIV. Kapitel bringt eine Wendung mit sich, indem die Notwendigkeit von sogenannten Stauräumen bedacht wird. Diese ergeben sich jedoch nicht aus der bewußten Konstitution, etwa dem Einrichten von Museen, Bibliotheken oder Lagerhäusern, sondern aus dem Umlauf des Wissens selber. Solche, wie die genannten Institutionen sind, wie schon vorhergehend angedeutet, Produkte einer klassifizierenden und hierarchisch untergliederten Sicht auf Wissen und Kultur, die sich gegenseitig bedingen. Serres sieht solche Räume „an denen die Zeit erstarrt“ nicht mehr als notwendig zu konstruierende Orte, sondern beschreibt diesen Zustand als Effekt, der sich notwendigerweise aus dem Austausch von Informationen zwischen Systemen und Individuen ergibt. Die Verengung von Kanälen, die Unterbrechung des Informationsflusses muß nicht (darf nicht) bewußt bewirkt werden, weil sie dem vernetzten Austausch schon immanent ist. Diese These geht auf die Erkenntnis zurück, nach der Systeme, die offen sind (die also die Zeit fließen lassen bzw. Information) in den Bereichen der Überlagerung und gegenseitigen Reflektion, durch ihre Umgebung begrenzt werden.
Damit erhält der Begriff der Interferenz doppelte Bedeutung. Zum einen wird hiermit ein Ereignis beschrieben, daß den Austausch von Informationen ermöglicht und zugleich den Wirkungsgrad eines Systems an den Randgebieten, oder um mit Deleuze zu sprechen, die Deterritorialisierungslinien der rhizomatischen Konnexionen bestimmt, Grenzgebiete erkennbar macht. Das Rauschen, oder wie Serres sich ausdrückt, der Lärm der nicht ausgeschlossen werden kann, ist selber das Ergebnis der Verknüpfungen. Insofern ist es ableitbar, daß so etwas, wie Metasysteme nicht existieren können, ohne die Betrachtung der Verschaltungen zu verschleiern. Es gibt nur die Ereignisse der Interferenz, die jeweils lokal und aus singulären Begebenheiten sich ergebend bestimmte Effekte erzielen, anhand derer Wissen zirkuliert. Dieses Wissen ist jedoch nicht mit einem bestimmten Diskurs gleichzusetzen, sondern mit der Verknüpfung, Überlagerung und Konkurrenz der Systeme, in denen bestimmte Diskurse zirkulieren. Der Raum als solcher (der intelligible Raum) erfordert zu seiner Betrachtung die Analyse durch Klassifikation; die Vielzahl der Verknüpfungen, die diese Räume definieren ereignen sich innerhalb eines bestimmten Grades an Offenheit, den Serres auch Unwissenheit nennt.
In diesem Sinne gehört z.b. die Photographie der Vorstellung des intelligiblen Raumes an, da sie einen Raum darstellt, in dem die Zeit eingefroren ist, infolge des Festhaltens eines Zeitausschnittes. Sie gehört aber auch der Interferenz an, da sie, anders als die Malerei, das reale Licht, direkt in chemisch-physikalische Informationen umwandelt und dadurch das Chaos der unendlichen Möglichkeiten der Bewegung des Lichtes auf einen Zustand bringt - einen Querschnitt der Zeit erzeugt, welcher als solcher jedoch nicht wahrgenommen werden kann. Das „punctum“ in der Theorie Roland Barths könnte in diesem Zusammenhang mit dem residualen Unbewußten bei Serres verglichen werden. Überträgt man diesen Begriff auf den Informationsaustausch zwischen Systemen, erleutert dieser das Erkennen einer Relation, die sich in der Zufälligkeit des Augenblicks (Photographie) ergibt, indem sie sich von ihrem realen Gegenstand distanziert, Autonomie gewinnt und auf andere Systeme anwendbar wird (in der Photographie wäre es die Möglichkeit der Verfielfältigung anhand des Negativfilms und dessen technischer Manipulation). Anders als bei diesem technischen Ablauf jedoch, da dieser das Dispositiv der Echtzeit ausschließt, verhält sich die Betrachtung von dynamischen Prozessen, mit denen sich Serres beschäftigt. Das „punctum“ der Photographie würde, wenn man es übertrüge, eine sich in der Zeit extrapolierende Form darstellen - man müßte diesem Begriff also einen Zeitvektor hinzufügen. In dieser Perspektive wird die Relation, die sich in der Zeit erstreckt, bzw. selber Zeit ist zum Gedächtnis im Serresschen Sinne. Demnach ist das Gedächtnis der Serresschen Theorie nicht das Ergebnis einer Akkumulation innerhalb eines definierten Raumes, der durch ein Katalogsystem zugänglich und durch Adressen untergliedert wäre, sondern Ereignis der sich zufällig einstellenden Ordnung, infolge chaotischer Wechselbeziehungen - der chaotische Punkt30 selber. Interferenz. Das Gedächtnis stellt keine Konstitution dar, sondern einen Effekt, bewirkt durch den Austausch zwischen autopoietischen Systemen.
Somit wird auch die Eingangs formulierte Bemerkung denkbar, nach der „das Subjekt seine Vorteile verliert“. Nicht die Subjekte konstatieren Gedächtnis, denn sie sind selber Teil dieses nicht beobachtbaren Ablaufs, der Gedächtnis produziert. Insofern verliert das Subjekt seine Vormachtstellung in der Welt. Die traditionelle Vorstellung von Gedächtins, die Geschichte wird selber historisch, indem sie zum Effekt dessen reduziert wird, was Serres Gedächtnis nennt.
(„Sollten diese Düfte und dieser Geschmack in ihrer reichen Vielfalt sich, in sanfte Signale verwandelt, auf eine Folge von Sätzen beschränken? Und dieses Gedächtnis, ist das nur ein schriftlicher Vertrag?“)31
Insofern strebt die Serressche Theorie notgedrungen zu einem Naturalismus hin, der im Zusammentreffen mit dem Subjekt den Effekt erzielt, den wir Kultur nennen. Die Kulturwissenschaft gerät dadurch in den Bereich der Biochemie, der Genetik. Die Kammern des menschlichen Körpers, in denen die Informationen der eigenen Art, die Gene gespeichert sind, sind dem Subjekt nicht zugänglich. Diese Blackbox bringt das Produkt der Vereinigung zweier Individuen hervor, das nicht im Voraus in seiner Wesensart, seinen Eigenschaften, seiner genetischen Zusammensetzung exakt berechnet werden kann. Es stellt sich als Konglomerat einer nicht überschaubaren Anzahl von Einflüssen dar, die es generieren und die für die Individuen, die es zeugten, nicht nachvollziehbar sind, bzw. beeinflußbar. Dennoch trägt dieses neue Geschöpf die Informationen seiner Art weiter. Es existiert also eine relative Konstante innerhalb der sich gegenseitig überlagernden Komplexionen, nur ist diese nicht subjektiv erfahrbar. Wenn die Büchse der Pandora die Welt bedeutet, so wie es Serres ausdrückt, dann geht es darum, die Offenheit der Komplexität nachzuahmen, um diese „anzapfen“ zu können.
„Sie trinken den Wein, vergießen das Blut, verlieren ihre Besonderheit, gießen sie in die Gemeinschaft, alte und neue Legierungen, Mischungen, Bündnisse, immer noch und immer wieder Zusammenfließen, Konfusion, Heraufkunft einer neuen Zeit und neuer Versprechungen, Erinnerungen.“32
Wenn die Struktur, sobald sie als in einem definierten Raum befindliche aufgefaßt wird (der Besonderheiten infolge der Analyse konstituiert) zerfällt, insofern sie dann nicht auf die sie determinierenden Faktoren hin untersucht werden kann, da sie davon abgeschnitten ist, so muß das Denken selber zur Struktur werden, den Raum negieren - innerhalb der eigenen Funktionalität begriffen werden.
Seine Kritik richtet sich letztlich gegen die Vormachtstellung des Wortes gegenüber den damit zum Zeichen reduzierten Dingen, die in ihrer gegenseitigen komplexen Verknüpfung verkannt werden und somit einer wissenschaftlichen Bürokratie Umgebung, Ordnungsmuster ergeben. Der hier genannte Begriff der Interferenz kann in diesem Sinne mit dem Serres verglichen werden.
unterworfen werden, welche die den Dingen eigene Wesenheit, bzw. deren „Vernunft auf Null gebracht worden ist“33. Das Fehlen des „raison d´etre“, oder dessen bewußt gesteuerte Verschleierung, womit die Kritik Serres sich zur politischen erhebt, ermöglicht erst die Idee des Staates, das Existieren „eines schriftlichen oder mündlichen Vertrages, der sagt, daß man sich eint...“34. Somit würde die Autorität des Staates durch die Wissenschaft relativiert und die Position Platons negiert, nach der gerade die Erkenntnis der Philosophen, bzw. Wissenschaftler für das Gedeien des Staates von herausragender Wichtigkeit ist. Die Verwaltung des Wissens und dessen Zirkulation führt nach Serres zum Archaischen. Man könnte es deutlicher ausdrücken, indem man sagt, die symbolische Form des Bürokratismus, die ihre Konsequenz in den Jahren von 1933-1945 gefunden hat, muß nun als residuales Ungewußtes erkannt und ausgeschlossen werden.
Literaturangabe:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Michel Serres: „Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische“, Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998
2 Richard Jochum: „Philosophie der Komplexität. Neuere Ansätze", in „Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften“ Nr. 4, Juni 1998, http://www.adis.at/arlt/institut/trans/4Nr/jochum.htm#3
3 Michel Serres: „Hermes II. Interferenz“, Merve Vlg., Berlin 1992, S.13
4 ebd., S. 13
5 Richard Jochum: „Philosophie der Komplexität. Neuere Ansätze“
6 Michel Serres: „Hermes II. Interferenz“, S. 16
7 ebd., S. 17
8 Richard Jochum: „Philosophie der Komplexität. Neuere Ansätze“
9 Michel Serres: „Die fünf Sinne“, S. 228
10 „Die Luft, dieses unbestimmte, leichte, subtile, instabile Gemisch, begünstigt Verbindungen aller Art; als Träger von allem widersetzt sie sich niemals.“
11 M. Serres: „Hermes II. Interferenz“, S. 13
12 ebd., S. 14
13 R. Jochum: „Philosophie der Komplexität“
14 M. Serres: „Die fünf Sinne“, S. 230
15 ebd., S. 233
16 ebd., S. 232
17 ebd., S. 232
18 siehe dazu ebenfalls R. Jochum „Philosophie der Komplexität“, 3. Abschnitt
19 M. Serres: „Die fünf Sinne“, S. 234
20 Vorwort von Helmut Seidel und Klaus-Dieter Eichler in: Platon „Das Gastmahl oder Über die Liebe“, Diederich´sche Vertragsbuchhandlung, Leipzig 1979, S. 27
21 M. Serres: „ Die fünf Sinne“, S. 237
22 Theoretische Interferenz: Tafel und Komplexität
23 ebd., S. 24
24 ebd., S. 25
25 ebd., S. 26
26 ebd,. S. 24
27 M. Serres: „Die fünf Sinne“, S. 238
28 Michel Foucault: „Die Phantasmen der Bibliothek“, als Nachwort zu Gustave Flaubert: „Die Versuchung des heiligen Antonius“, Insel Verlag, Frankfurt/Main, 1996, S. 224
29 In „Theoretische Interferenz: Tafel und Komplexität“ geht Serres genauer auf die
Übertragung oder besser den Import und Export von Schemata zwischen den verschiedenen Diskursen der Wissenschaften ein und vergleicht diese mit Netzwerken, die sich einander und über einander reflektieren, also gegenseitig bedingen. (S. 69- 84)
30 zum Begriff des chaotischen Punktes siehe: John Briggs, F. David Peat: „Die Entdeckung des Chaos“, dtv, München, 1993 (dt.) Hierin wird beschrieben, wie sich innerhalb isolierter, in Ordnung befindlicher Systeme, Chaos ereignet und umgekehrt, innerhalb einer chaotischen
31 M. Serres: „Die fünf Sinne“, S. 249
32 ebd., S. 246
33 ebd., S. 251
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Einleitung - Komplexität und Kommunikation"?
Der Text untersucht Michel Serres' Philosophie der Komplexität und Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf die gegenseitige Durchdringung wissenschaftlicher Disziplinen und die Rolle von Relationen und Interferenzen in der Wissensproduktion. Er analysiert Serres' Konzept der Passage und die Bedeutung von Netzwerken in der wissenschaftlichen Praxis.
Was ist Serres' Kritik an der traditionellen Wissenschaft?
Serres kritisiert die traditionelle, zentralistisch oder hierarchisch geordnete Wissenschaftslandschaft. Er plädiert für eine wissenschaftliche Praxis, die in der dynamischen Durchdringung der Disziplinen, also durch Passage, funktioniert.
Was versteht Serres unter "Wissensräumen"?
Für Serres sind Wissensräume Verknüpfungen, die sich aus der Konfiguration anderer Wissensräume und Ebenen ergeben. Diese Wissensräume determinieren keinen kontinuierlichen Raum, sondern stellen temporäre Orte der Wissensverschaltung dar.
Welche Rolle spielen Relationen in Serres' Theorie?
Relationen sind zentral für Serres' Theorie. Wissen entsteht durch Relationen, und die Analyse von Wissen muss die Relationen selbst berücksichtigen, da die Verschaltung das Wissen darstellt.
Was ist die Bedeutung des Kapitels "Gedächtnis" im Buch "Die fünf Sinne"?
Das Kapitel "Gedächtnis" untersucht die Produktion von Gedächtnis und beginnt mit der Frage nach dem Nullpunkt der sinnlichen Wahrnehmung. Es untersucht die Rolle von Luft und Geruch als Verbindungsmedien zwischen Umwelt und Subjekten.
Wie unterscheidet sich Serres' Begriff der Kommunikation von traditionellen Ansätzen?
Serres' Begriff der Kommunikation lehnt sich an die physikalische Perspektive von Teilchenrelationen an, in der es Festkörper sind, die in Relation miteinander stehen, und nicht Aussagen als Produkte des subjektiven Verstandes. Es ist eine Passage zwischen Human- und Naturwissenschaften.
Was sind die zwei Gedächtnisformen, die Serres unterscheidet?
Serres unterscheidet zwischen Gedächtnis, das durch die symbolische Form der Wiederkehr erzeugt wird (kulturelles Gedächtnis), und Gedächtnis als Produkt einer unwahrscheinlichen, wiederkehrenden Konfiguration von Teilchen (Erinnerung).
Was ist der Zusammenhang zwischen Raum und Zeit in Serres' Gedächtnistheorie?
Serres verknüpft Raum und Zeit, wobei der Raum den Topos des Analytischen und die Zeit als Ebene des direkten Mischens fungiert.
Wie beschreibt Serres das Verhältnis von Abendmahl und Gastmahl Platons?
Serres stellt das Gastmahl Platons als ein statisches Bankett mit hierarchischem Denken dar, während das Abendmahl Jesu als ein Topos des zirkulierenden, verschmelzenden Denkens verstanden wird.
Was ist Serres' Kritik an der Vormachtstellung des Wortes?
Serres kritisiert die Vormachtstellung des Wortes gegenüber den Dingen, die in ihrer komplexen Verknüpfung verkannt werden. Dies führt seiner Meinung nach zu einer wissenschaftlichen Bürokratie.
Welche Rolle spielt die Interferenz in Serres' Theorie?
Interferenz ermöglicht den Austausch von Informationen und bestimmt zugleich den Wirkungsgrad eines Systems an den Randgebieten. Lärm, der nicht ausgeschlossen werden kann, ist selbst das Ergebnis der Verknüpfungen.
Was bedeutet das Zitat "Das Subjekt verliert seine Vorteile" im Kontext von Serres' Theorie?
Das Subjekt verliert seine Vormachtstellung, da es selbst Teil des Ablaufs ist, der Gedächtnis produziert. Nicht die Subjekte konstatieren Gedächtnis.
Wie verhält sich Serres' Theorie zum Naturalismus?
Serres' Theorie strebt zu einem Naturalismus hin, der im Zusammentreffen mit dem Subjekt den Effekt erzielt, den wir Kultur nennen. Die Kulturwissenschaft gerät dadurch in den Bereich der Biochemie und der Genetik.
- Arbeit zitieren
- Tobias Rose (Autor:in), 1999, Michel Serres: "Die fünf Sinne" - Gedächtnis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100735